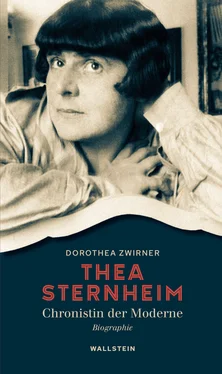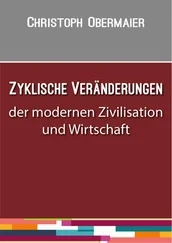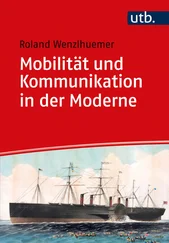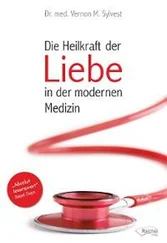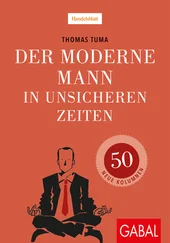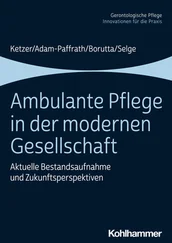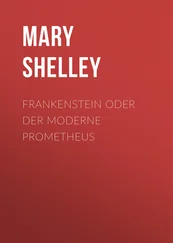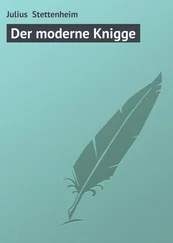Zum Haushalt der fünfköpfigen Fabrikantenfamilie gehört fast ebenso viel Personal, um den aufwendigen und repräsentativen Lebensstil zu gewährleisten. Für die neugeborene Thea wird ein Kindermädchen engagiert, das mit dem Säugling im selben Zimmer schläft und nacheinander durch das zarte Fräulein Blaßneck als Betreuerin und die klatschsüchtige Hulda Kunze als Erzieherin abgelöst wird. Die Jungfer Helene steht der Hausherrin als Kammerzofe zur Seite, der Diener Heinrich dem Hausherrn, und die Köchin Anna Winter versieht über dreißig Jahre lang die Küche. Befinden sich die Kinder in der Obhut von Kinderfrauen und Hauslehrern, so vergeht für die Eltern kein Tag ohne Gäste. Diners, Pferderennen, Jagden, Theater und Reisen sind an der Tagesordnung. Auch wenn das distanzierte Verhältnis der Eltern zu ihren Kindern keine Ausnahme im großbürgerlichen Milieu der Zeit bildet, empfindet Thea ihre Kindheit als einsam. In der frühkindlichen Erinnerung erscheint der Vater als furchteinflößende, dominante und maßregelnde Autorität, die Mutter dagegen seltsam blass.
In Theas fünftem Lebensjahr zieht die Familie 1888 von Neuss nach Köln in das eigens von ihrem Onkel Hubert, dem jüngeren Bruder ihres Vaters, errichtete Haus am Hansaring 53. Der seit den 1880er Jahren an der Stelle der alten Stadtmauer errichtete Prachtboulevard gilt als erste Adresse der expandierenden Rheinmetropole. Das vierstöckige herrschaftliche Haus wird mit viel Dekor und historisierenden Stilelementen im Geschmack der Gründerzeit erbaut, über den sich Thea rückblickend als »Plüsch« mokiert. Der repräsentative Zuschnitt der unteren Geschosse gipfelt in einer steilen Marmortreppe, über deren Unbequemlichkeit Theas Mutter ständig zu klagen pflegt. Die Unzufriedenheit der Mutter hat indes tiefere Ursachen, die Thea erst später begreifen wird. Das Haus verfügt zudem über eine ausgedehnte Gartenanlage mit Springbrunnen, einen Pavillon mit Fremdenzimmern und Billarddiele sowie einen Stall mit Remise und Kutscherwohnung. Von Theas zum Garten gelegenem Spiel- und Schlafzimmer kann man die beiden Türme des Doms, einen Teil der römischen Stadtmauer und das städtische Gefängnis, den Klingelpütz, sehen.
Wie in den meisten bürgerlichen Familien des 19. Jahrhunderts sind auch bei den Eheleuten Bauer die Wirkungskreise von Mann und Frau weitgehend getrennt.[6] Während Agnes Bauer für die privaten Bereiche der Haushaltsführung und Familie zuständig ist, steht ihr Unternehmergatte viel stärker im öffentlichen Leben.[7] Täglich außer sonntags fährt er die dreißig Kilometer zur Fabrik nach Neuss und kommt zum Mittagessen um 14 Uhr nach Hause. Die Eisenbahnfahrt vom nahe gelegenen Centralbahnhof am Dom, dessen prachtvoller Neubau mit seinem riesigen Glasgewölbe über der zweigeschossigen Wartehalle gerade Gestalt annimmt, dauert keine halbe Stunde. Nach dem Mittagsschlaf trifft er sich mit Freunden und Kollegen im Weinrestaurant und kehrt erst zum Abendessen gegen 21 Uhr zurück. Die Mutter versieht mit Hilfe des Personals den Haushalt, organisiert die gesellschaftlichen Verpflichtungen und pflegt die familiären Kontakte.
Mindestens einmal wöchentlich fährt Thea mit ihrer Mutter über die Rheinbrücke nach Deutz, um ihre Großmutter Schwaben zu besuchen, die mit ihrer ledigen Schwester und ihrer geschiedenen Tochter Carola samt Enkeltochter Olga in einem reinen Frauenhaushalt zusammenlebt. Thea liebt diese Besuche in der Neuhöfferstraße bei ihrer warmherzigen und weitgereisten Großmutter und ihrer Linchen genannten Lieblingstante, wo es zwei Hunde, einen russisch sprechenden Papagei und köstlichen Kuchen gibt. Die liebevolle Atmosphäre des großmütterlichen Haushalts wird sich Jahre später zu einer tröstlichen Erinnerung verdichten:
»Nie hat mein Elternhaus einen ähnlichen Eindruck auf mich ausgeübt als das bescheidene Haus meiner Grossmutter mit seinen Weinstöcken, seinem Taubenschlag. Da spiegelte jedes Ding, jeder Raum die Würde ihres gütigen Herzens wider. Die beiden Hunde. Der Papagei.
Welch eine Wohltat war’s dem Kind aus den Misshelligkeiten des elterlichen Hauses kommend in diese Wohnung des Friedens zu treten. Pistazientorte und Blancmanger waren nur schwache Symbole für die sentimentalen Genüsse, die das Fühlbarwerden einer grossen Sympathie in mir auslöste.«[8]
Im Gegensatz dazu verabscheut Thea die Besuche bei ihrer erblindeten Großmutter Bauer auf dem Salierring, die ebenfalls mit ihrer geschiedenen Tochter Therese zusammenlebt und offenbar ihre Ablehnung der Schwiegertochter gegenüber auf ihre Enkeltochter übertragen hat. Ob verlassen, verwitwet, geschieden oder ledig, die starke Häufung alleinstehender Frauen prägt Theas unmittelbares familiäres Umfeld.
Mit sechs Jahren wird Thea 1889 in die Kuttenkeulersche Schule am Gereonsdriesch eingeschult zusammen mit ihrer gleichaltrigen Kusine Elisabeth Bauer, der Tochter ihres Architekten-Onkels Hubert, die zu ihrer täglichen Spielgefährtin wird. Die Schulausbildung der drei Geschwister Bauer verläuft dem Alter und Geschlecht entsprechend unterschiedlich. Während ihr ältester Bruder, Richard, beim Umzug nach Köln mit nur elf Jahren zunächst noch in der Obhut seines Privatlehrers in Neuss bleibt, besucht der mittlere Bruder, Theo, ein neusprachliches Kölner Realgymnasium. Im Unterschied zu den bereits weitgehend staatlich regulierten Jungenschulen steht die »private höhere Töchterschule Kuttenkeuler« zwar auch unter behördlicher Aufsicht, wird in ihrer pädagogischen Ausrichtung und Qualität aber von der jeweiligen Schulleitung und Zusammensetzung der Schülerinnen bestimmt.[9] In der Zeit von Theas Einschulung muss sich Johanna Kuttenkeuler immer wieder mit der Schulaufsicht auseinandersetzen, um das allgemeine Durcheinander nicht regulierter Lehrpläne und unterschiedlicher Bildungsvoraussetzungen in den Griff zu bekommen. Dabei mögen die sittlichen Werte wie Demut, Bescheidenheit, Gehorsam und Akzeptanz der gottgegebenen Unterschiede, die in der konfessionellen Standesschule neben den Bildungsinhalten vermittelt werden, bei Thea etwas zu kurz gekommen sein. Ohnehin entsprechen weder die preußischen noch die kirchlichen Tugenden Theas Naturell, die sich mit einem Aufsatz gegen die Kreuzzüge und einem Spottgedicht über einige Klassenkameradinnen schon bald den Ärger der Schulleitung zuzieht, woraufhin einigen Kindern der Umgang mit ihr wegen »ihres anarchischen Einflusses« verboten wird. Im späten Rückblick auf ihre Kölner Schulzeit hat Thea Sternheim als alte Frau ihr kindliches Wesen sehr treffend als eine Mischung aus »Anarchie und Frommsein«[10] charakterisiert.
Den Gegenpol zu ihrem anarchischen Wesen bildet eine bereits frühkindlich ausgeprägte Frömmigkeit, wie sie Thea von beiden Großmüttern vertraut ist, aber deutlich über den konventionellen Rahmen ihres katholischen Elternhauses hinausreicht. Während die Eltern nur gelegentlich zur Kirche gehen, wird Thea zu regelmäßigen Gottesdienstbesuchen angehalten. Auf Anregung von Fräulein Blaßneck errichtet Thea einen kleinen mit einem Marienbild, Kerzen und Blumen geschmückten Hausaltar in ihrem Zimmer. Die Bibel, Heiligenlegenden und Märtyrergeschichten gehören zusammen mit der griechischen Mythologie zu ihrer ersten Lieblingslektüre; die in einem Bastkörbchen verwahrten Heiligenbildchen bilden den Grundstock ihrer späteren Kunstbegeisterung und Sammelleidenschaft.
Die frühkindliche Phase bedingungsloser Frömmigkeit ist längst vorbei, als Thea mit zwölf Jahren zusammen mit ihrer Kusine Elisabeth zum Kommunionsunterricht kommt. Ihre ersten Glaubenszweifel sind mit einer unbedingten Aufrichtigkeit gepaart, die sie bei der Erstkommunion Übelkeit vortäuschen lässt, weil sie nicht an die Gegenwart Jesu im Altarsakrament glauben kann. Denn ihr Glaube gilt nicht dem göttlichen, sondern dem barmherzigen und sanftmütigen Jesus.
Читать дальше