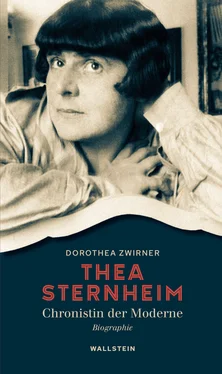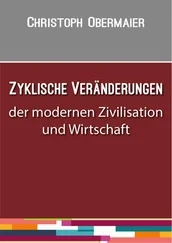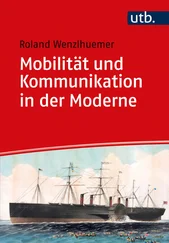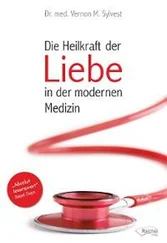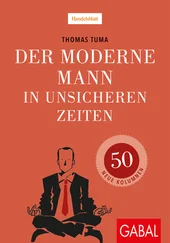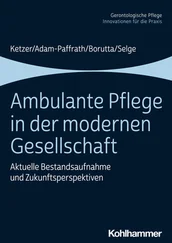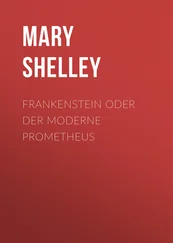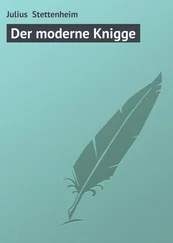Thea Sternheim veröffentlichte zeitlebens außer einigen Artikeln und Übersetzungsarbeiten nur eine Kurzgeschichte und einen Roman. Dass ihre Tagebücher mittlerweile in einer hervorragend kommentierten fünfbändigen Edition vorliegen, ihre Lebenserinnerungen bis 1930, die Briefwechsel mit Carl Sternheim, ihren jüngeren Kindern Dorothea und Klaus, sowie die Korrespondenz mit Gottfried Benn und André Gide posthum veröffentlicht worden sind, ändert nichts daran, dass Thea Sternheim zu jenen großen Frauenfiguren des 20. Jahrhunderts gehört, deren Name noch weitgehend unbekannt ist und deren Lebensgeschichte es zu erzählen gilt.
Angesichts der Fülle primärer Quellen bestand die Herausforderung dieser Biographie eher in der Auswahl als im Auserzählen – in der Kunst des Weglassens. Dabei stellten sich grundsätzliche Fragen der Bewertung von Selbstzeugnissen, des eigenen Standpunkts und der Gliederung einer solchen Stoffmenge: Wie sind die Selbstaussagen der Person zu bewerten, deren Leben erzählt werden soll? Kann man als Biographin eine ausreichend kritische Distanz zu einem Leben herstellen, von dessen Verlauf eine große Faszination ausgeht? Steht vielleicht sogar die Sympathie für die dargestellte Person einer halbwegs objektiven Darstellung im Weg, noch dazu, wenn sie durch ihre Briefe und besonders durch ihr Tagebuch so eindrucksvolle Selbstzeugnisse hinterlassen hat wie Thea Sternheim? Und schließlich: Wie lässt sich eine solche Stoffmenge sinnvoll gliedern?
Die Intimität, Unmittelbarkeit und Kontinuität von Thea Sternheims Tagebuch über mehr als 60 Jahre hinweg verleihen dieser Hauptquelle eine hohe Glaubwürdigkeit und Aussagekraft, die durch eingefügte Briefe, Fotos, Zeitungsausschnitte und Dokumente noch objektiviert und untermauert werden. Darüber hinaus haben sich viele ihrer politischen, ästhetischen und moralischen Urteile als so weitsichtig, geschmackssicher und unbestechlich erwiesen, dass Thea Sternheim weitgehend selbst die Regie und das Wort überlassen werden soll, während mir die Rolle der diskreten Biographin zufällt.
In dieser Rolle hieß es, sich der Chronologie des Tagebuchs anzuvertrauen und die Biographie gleichsam von innen heraus zu erzählen. Dabei kristallisierten sich thematische Schwerpunkte, Fragestellungen und Hauptpersonen heraus, die eine prägende Rolle für Thea Sternheim gespielt haben, sei es in bestimmten Lebensphasen oder als zentrale Lebensthemen: die Frage weiblicher Bildungschancen und die Rolle der modernen Frau in Familie und Gesellschaft, ihre Konflikte in der Ehe und zwischen den Generationen, ihre Verehrung des Schöpferischen in der bildenden Kunst und Literatur, in Theater und Film und insbesondere in Gestalt von Carl Sternheim, Gottfried Benn und André Gide, ihre daraus erwachsenen Reflexionen über das Verhältnis von Kunst und Moral, Künstler und Werk, ihr Hang zu Mystik und Religion, ihre weltanschaulichen Haltungen zum Pazifismus, Kommunismus und Antifaschismus sowie ihre weltoffene Einstellung zur Emigration und zu Europa als geistiger Heimat. Da eine vertikale Gliederung nach diesen Gesichtspunkten zwangsläufig zu Überschneidungen und Redundanzen geführt hätte, blieb die Entscheidung bei einer horizontalen Gliederung, um durch behutsame Einordnungen, Kommentare und Deutungen die inneren und äußeren Zusammenhänge ihres Lebens zu erschließen. So entfaltet sich eine Lebensgeschichte, die exzeptionell und exemplarisch zugleich erscheint – exzeptionell in der moralischen Gradlinigkeit, ästhetischen Souveränität und politischen Hellsichtigkeit, exemplarisch im weiblichen Selbstverständnis, das zwischen Anpassung und Aufbegehren, Selbstzweifeln und Sinnsuche, Disziplin und Demut bis heute fasziniert.
I. Kindheit, Jugend und erste Ehe (1883 – 1906)
Großbürgerliche Kindheit im Rheinland (1883–1896)
»Anarchie und Frommsein«
Als Thea das Licht der Welt erblickt, beginnt es gerade zu dämmern. Das Sonntagskind Olga Maria Theresia Gustava Bauer wird am 25. November 1883 im Haus ihrer Eltern in der Crefelder Straße G 176 in Neuss um halb vier Uhr nachmittags geboren.[1] Es ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr, der dem Andenken an die Verstorbenen gilt. Kirchenglocken und Totenklage bilden den Wechselklang aus Gottvertrauen und Schwermut, der ihr schon an der Wiege gesungen wird.
Im Rückblick sieht Thea Sternheim ihren Lebensbeginn im Zeichen dieser unheilvollen Konstellation, der sie sich jedoch schreibend entgegenzusetzen weiß. Es ist der Wille zur Feststellung, der unbedingte Ausdruckswille eines literarischen Naturells, der ihren Lebensweg prägen, gestalten und sublimieren wird. Im Spannungsfeld zwischen Leben und Schreiben entsteht mit ihrem Tagebuch eine minutiöse Chronik, die dem Leben dokumentierend, kommentierend und reflektierend gegenübersteht, ein buchstäbliches Lebenswerk, das sie von ihrem zweiundzwanzigsten Lebensjahr bis kurz vor ihrem Tod fast täglich führen wird. Entsprechend wissen wir über die Zeit ihrer Kindheit und Jugend nur aus den rückblickenden Aufzeichnungen und vor allem aus ihren autobiographischen Erinnerungen, mit denen sie 1936 im Alter von 53 Jahren begonnen hat.[2] Sosehr sich Thea Sternheim zeitlebens um größtmögliche Aufrichtigkeit bemüht hat und ihre Erinnerungen mit den »authentischen« Eintragungen ihres Tagebuchs zu belegen sucht, so sehr bleibt ihre wie jede Erinnerung subjektiv und selektiv und birgt bereits die Perspektive rückblickender Deutung. Im steten Zwiegespräch zwischen Leben und Schreiben gilt es, zwischen der Realität und dem Roman ihres Lebens zu unterscheiden.
Der Schatten, den Thea über ihrer Geburtsstunde liegen sieht, entspricht jedenfalls nicht den wohlhabenden Verhältnissen, in die sie hineingeboren wird. Ihr Vater, Georg Bauer, ist als Mitinhaber der Rheinischen Schrauben- und Mutternfabrik »Bauer und Schaurte« ein erfolgreicher Unternehmer. Mit 24 Jahren hat er 1874 seine Firma im linksrheinischen Neuss gegründet, das durch den Ausbau des Hafens gerade im Begriff ist, sich von einer Agrar- zu einer Industriestadt zu entwickeln.[3] Damit ist der Grundstein zu einer erfolgreichen Firmengeschichte gelegt, die mit der Erfindung von Mutter und Schraube und dem späteren Patent für den Innensechskantschlüssel »Inbus« über hundert Jahre unter demselben Namen weiter betrieben wird. Schon nach wenigen Jahren ist das Unternehmen mit über 400 Arbeitsplätzen einer der größten Arbeitgeber der Stadt.[4] Im Jahr der Firmengründung kann es sich der Jungunternehmer bereits leisten, die 22-jährige Ingenieurstochter Agnes Schwaben zu heiraten. Diese ist wie er katholisch und stammt ebenfalls aus zwar wohlhabenden, aber unglücklichen Familienverhältnissen. Ihre Eltern haben viele Jahre im englischen und russischen Ausland gelebt, bis ihr Vater, Carl Wilhelm Schwaben, seine Frau mit fünf Kindern wegen einer polnischen Sängerin verließ. Verluste in russischen Werten ließen das Vermögen von Großmutter Schwaben, wie Thea ihre Großmutter mütterlicherseits nannte, zusammenschrumpfen. Das Unglück der Großmutter setzte sich in der nächsten Generation fort. Von den fünf Kindern gelang es nur Theas Mutter Agnes sich standesgemäß, wenn auch glücklos, zu verheiraten, während ihre beiden Schwestern Carola und Hedwig sich von ihren Männern trennten.
Ein Jahr nach der Hochzeit von Georg Bauer und Agnes Schwaben wird 1875 der erste Sohn, Richard, geboren, drei Jahre später der zweite Sohn, Theodor. Nach den beiden älteren Brüdern ist Thea das dritte und letzte Kind ihrer Eltern. Als einzige Tochter und jüngstes Kind nimmt sie unter den Geschwistern zwar eine gewisse Vorzugsstellung beim Vater ein, empfindet sich aber als weibliches Wesen ihren Brüdern gegenüber als minderwertig. Insbesondere von dem als Lieblingssohn der Mutter verehrten Theo fühlt sie sich als »Göre« und »Tränendose« zurückgewiesen, so dass keine besonders enge Geschwisterbindung entsteht.[5]
Читать дальше