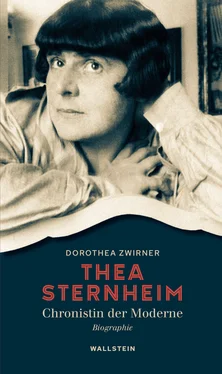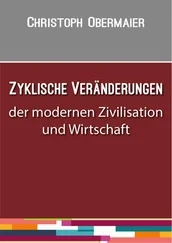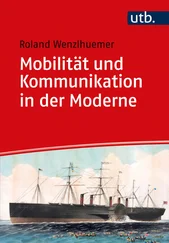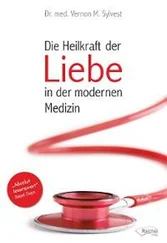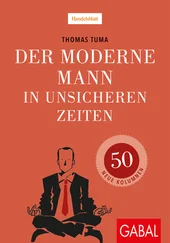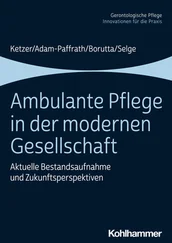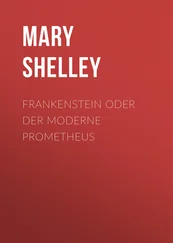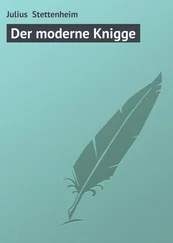1 ...6 7 8 10 11 12 ...17 Was die junge Ehefrau und Mutter mit ihren dichterischen Ambitionen nur vage in Worte zu fassen weiß, das kann sie beim Blick aus dem Fenster dem Schicksalsfluss der Deutschen anvertrauen. Denn wer als Thea Bauer in Neuss geboren, in Kölns nördlicher Altstadt aufgewachsen und als frisch verheiratete Frau Löwenstein nach Oberkassel gezogen ist, dessen Herz schlägt linksrheinisch. Linksrheinisch für die römisch-katholischen Wurzeln ihrer Herkunft, linksrheinisch für die französische Ausrichtung ihrer Erziehung und linksrheinisch für das sinnenfreudige Temperament ihres Wesens. Aber wie schon für den verehrten Heinrich Heine zieht sich der Rhein wie eine Scheidewand durch das Land und das Herz der Deutschen und lässt auch bei Thea Sternheim römische Rationalität und deutsche Mystik, preußische Disziplin und rheinische Lebensfreude aufeinanderstoßen.
Carl Sternheim ist Mitte zwanzig, als er mit seiner jungen Frau Eugenie über die Oberkasseler Brücke den Kaiser-Wilhelm-Ring mit seinen schmucken Neubauten entlangkommt. Auch wenn der junge Mann mit dem Wilhelminismus wenig gemein hat, ein nach ihm benannter Prachtboulevard wäre schon nach seinem Geschmack. Nach seinem Studium der Philosophie, Psychologie und Rechtswissenschaften in München, Göttingen und Leipzig hat er endlich zu seiner eigentlichen Berufung als freier Schriftsteller gefunden. Es kennt ihn kaum jemand, denn noch hat er bis auf ein Stück kaum etwas publiziert, aber bald soll sein Name in einer Reihe mit den ganz großen Dramatikern erscheinen: Shakespeare, Molière, Goethe, Kleist, Hauptmann – Carl Sternheim.
Mit diesem Ziel vor Augen, aber ohne Studienabschluss und eigenes Einkommen, hat er mit 22 Jahren Eugenie Hauth, die Tochter eines Weingutbesitzers aus Düsseldorf, geheiratet, die ihm schon bald einen Sohn schenkt. Dank ihrer Mitgift und der Unterstützung seines Vaters, der als jüdischer Bankier, Börsenmakler und Zeitungsverleger bereits in zweiter Generation ebenfalls vermögend ist, kann er es sich leisten, einen Brotberuf als Zumutung zu empfinden.
Liegt Vorfrühling in der Luft, sind die Rheinauen von Krokussen übersäht, und vorbeiziehende Schiffer winken den Spaziergängern zu. Würde Carl Sternheim den Gruß erwidernd seinen Hut ziehen, könnte man sehen, dass sich sein Haaransatz schon zu lichten beginnt. Die hohe Stirn und der Schnauzbart lassen den Fünfundzwanzigjährigen in seinem doppelreihigen Straßenanzug mit Vatermörder älter erscheinen, als er ist. Offensichtlich legt er größten Wert auf eine gepflegte Erscheinung, die von seiner relativ kleinen Körpergröße ablenkt. Hinter seiner Akkuratesse verbirgt sich jedoch nicht nur Eitelkeit, sondern auch ein »schönheitstrunkener« und unkonventioneller Geist.
Seit ihrer Kindheit bewundert Thea nichts so sehr wie den kreativen Menschen. Kunst und Literatur sind von Anfang an ihre große Leidenschaft, ihr eigentliches Lebensgefühl und nicht nur gehobene Unterhaltung und kultivierter Gesprächsstoff wie für Arthur. Sie lebt vielmehr in ihren Büchern und Bildern, weil sie darin etwas von der unbegrenzten, schöpferischen Freiheit spürt, die ihr im Leben so unerreichbar erscheint. Sie träumt von einer höheren Lebenskunst und nicht von diesem durchschnittlichen Kunstleben. Dabei ist sie keine Träumerin, sondern ein Willensmensch durch und durch. Jede falsche Autorität, die ihr einen fremden Willen aufzwingen will, ist ihr suspekt. Allein der Schöpfergott ist die einzige Autorität, an die sie bedingungslos, wenn auch nicht ohne Zweifel, glaubt, ist er doch der Schöpfer par excellence. Am liebsten würde sie selber schreiben, so unbefangen und glühend wie in ihrer Jugend, doch mit Goethe, Heine und Tolstoi als Maßstab sinkt der Mut und wächst der Selbstzweifel, noch dazu als Mädchen ohne höhere Bildung.
Aber Theas erster Eindruck vom Dichter fällt zwiespältig aus, zumindest im Rückblick: »Er ist mittelgroß, schlank, excentrisch und überangezogen«.[48] Inwiefern Thea schon bei diesem ersten Besuch Sternheims Aufmerksamkeit weckt, wissen wir nicht. Sie ist keine Schönheit, aber eine brünette und lebensvolle junge Frau mit welligen Haaren, warmen braunen Augen und sinnlichen Lippen. Die dunklen Augenbrauen geben ihrem Gesicht einen markanten, fast männlichen Zug, der auf einen starken Willen und ein leidenschaftliches Temperament hindeutet.
Schon bald besucht Carl Sternheim auch ohne seine Frau das Ehepaar Löwenstein. Auch wenn Theas Eindruck weiterhin höchst ambivalent bleibt, kann sie sich einer gewissen Faszination nicht entziehen:
»Inzwischen gefällt mir Sternheim bereits weniger als beim ersten Besuch. Die Art und Weise, mit der er seine Erfolge bei Frauen herausstreicht, die Verführten bei Namen nennt, berührt mich peinlich. Andererseits scheint er nicht im geringsten beleidigt, mache ich mich über seine Indiskretionen lustig. […] Er stößt mich ab und zieht mich gleichzeitig an. Beim Abschied empfiehlt er mir die Anschaffung seines Judas Ischarioth.«[49]
Die Tragödie vom Verrat, wie Sternheim sein pathetisches Frühwerk über das Leben Jesu im Untertitel nennt, kündigt sich wie ein Menetekel an und zieht Thea in ihren Bann. Hat Judas den Messias freiwillig verraten oder hat er ihn nur dem göttlichen Heilsplan übergeben? Spielt er die selbstgewählte Rolle des Verräters oder die schicksalhafte Rolle des Erfüllungsgehilfen? Die personifizierte Frage, ob menschliches Handeln von göttlicher Vorsehung oder vom freien Willen bestimmt wird, fasziniert Thea ebenso sehr wie den Autor des Judas Ischarioth . Es wird ihr Lebensthema und die Tragödie ihres Lebens, ihre »weibliche« Anpassungsbereitschaft und Schicksalsergebenheit mit ihrem »männlichen« Gestaltungswillen und Geltungsbedürfnis verbinden zu wollen.
Unheilvolle Dreisamkeit (1904–1906)
»Es soll keiner wagen, mir zu sagen: Du sollst!«
Ein Jahr ist vergangen seit der ersten Begegnung, als Carl Sternheim Anfang Februar 1904 zur Kur nach Aachen reisen muss. Was sich über Monate in temperamentvollen Briefen von ihm an Thea vorbereitet hat, bricht sich jetzt Bahn. Ein Wiedersehen im Kölner Dom-Hotel wird verabredet. Die Wiedersehensfreude soll die abwesende Ehefrau in München telefonisch miteinschließen. Ein gemeinsamer Anruf bei Eugenie von der Kabine des Hoteltelefons aus lässt die Herzen auf einmal schneller schlagen. Seine Hand auf ihrem Arm, entsteht aus der Fernverbindung schlagartig eine Nahverbindung, die Thea die Sprache verschlägt.
Umso wortreicher und drängender werden Carls Briefe, die seitdem immer häufiger aus Aachen eintreffen. Arthur hat dann längst das Haus verlassen, um seiner anwaltlichen Tätigkeit nachzugehen. Für sein berufliches Fortkommen sucht er Anschluss an die feine Gesellschaft von Düsseldorf, die Thea nicht interessiert. Sie sitzt zu Hause und liest, ordnet ihre umfangreiche Sammlung von über 5000 kunsthistorischen Reproduktionen, schreibt ein paar sehnsuchtsvolle Gedichte und weiß nicht wohin mit sich und ihren Träumen. Nur die kleine Agnes macht ihr große Freude. Das Kind mit dem Spitznamen »Putzi« beginnt langsam zu laufen und ist als erstes Enkelkind der erklärte Liebling von Theas Eltern, die sich allmählich mit der heimlichen Eheschließung ihrer rebellischen Tochter abgefunden haben. Trotz des ungeheuren Eklats überwiegen bei Georg Bauer schließlich Standesbewusstsein und Liebe seine Rechthaberei. Dem erfolgreichen Unternehmer wäre es auf Dauer unerträglich, wenn seine einzige Tochter nicht in standesgemäßen Verhältnissen lebte. Dazu gehört neben der Haushälterin eine Kinderfrau, die Thea von den anfänglichen Haushalts- und Kinderpflichten weitgehend entbinden. Aber auch ein eigenes Haus auf dem Kaiser-Wilhelm-Ring 15, nur wenige Meter von der alten Wohnung entfernt, wird in Angriff genommen. Das dreigeschossige Haus mit gotisierendem Spitzgiebel, vorspringendem Erker und Maßwerk zeugt noch in seiner heutigen Versachlichung von den großbürgerlichen Wohn- und Lebensansprüchen der Jahrhundertwende und Theas frühzeitigem Talent als Bauherrin, das sie noch viele Male unter Beweis stellen wird (Abb. 1). Vorerst füllt es sie aber nicht aus. Da kommt der Vorschlag Sternheims gerade recht, sich von einem mit ihm befreundeten, brotlosen Maler porträtieren zu lassen. Während Thea bei Friedrich von Willemoes-Suhm Porträt sitzt, kreisen ihre Gespräche um den abwesenden Initiator »wie die Motten ums Licht«. Sternheim versteht es, sich ins Spiel zu bringen, während Thea langsam ins Bild gesetzt wird. Das Bild wird alles andere als ein Kunstwerk, aber schärft Theas kritischen Blick auf sich selbst, mit dem sie sich erinnern wird:
Читать дальше