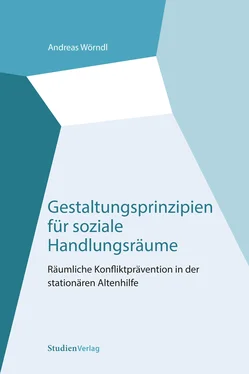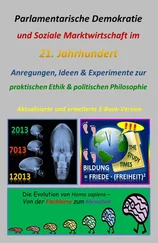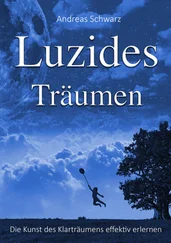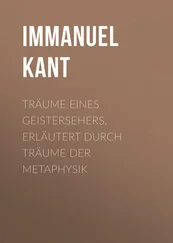Privatheit als Voraussetzung für Kontaktbereitschaft
Der Verlust sowie Verletzungen der Privatsphäre haben gravierende Auswirkungen auf gewohnte Rituale und persönliche Lebensgewohnheiten. Eine selbstbestimmte Lebensführung ist auch innerhalb institutioneller Strukturen essentiell und regelt das soziale Miteinander. Das Wesen von Privatheit ist Kontrolle, so die Privatheitstheoretiker der 1970er Jahre (Altman, 1975; Westin, 1970; Pastalan, 1970), Kontrolle darüber, wann, wie und in welchem Umfang persönliche Informationen öffentlich werden. Privatheit ist ein Prozess zwischen „für sich allein sein“ und „mit anderen gemeinsam sein“, daher braucht Privatheit ein ausgewogenes Verhältnis (Hellbrück & Fischer, 1999). Zu viel an Privatheit führt zu Vereinsamung, zu wenig zu Beengtheit (Altman, 1975). Der Verlust von Kontrolle über den eigenen Wirkungsbereich führt zu Konsequenzen im Zusammensein. Die Sicherstellung individueller Privatheitsansprüche ist in Verbindung mit territorialen Abgrenzungen die Voraussetzung für Kontaktbereitschaft und soziale Interaktion. Wohnen ist eine Möglichkeit, Privatheit zu erreichen (Flade, 2008). Daraus lässt sich erahnen, dass eine häusliche Wohnumgebung dem individuellen Privatheitsgedanken äußerst nahe kommt.
Konflikte, Aggression und Gewalt als Folge sozialer Verdichtung und räumlicher Enge
Die Missachtung der Privatsphäre, Verletzung von Territorien sowie der Verlust der Kontrolle über den persönlichen Wirkungsbereich stellen die Ursachen für soziale Konflikte (Glasl, 2013) dar. Konflikte treten in unterschiedlichen Ausprägungen auf, können entweder gegen sich selbst, gegen andere oder gegen die physische Umgebung gerichtet sein. Aggressionen und Gewalt in der Pflege (Zeh et al., 2009; Osterbrink & Andratsch, 2015) sind ursächlich auf die Tatsache zurückzuführen, dass zwischen den handelnden Personen sensible Interaktionen stattfinden. Soziale Konflikte stellen in der Regel eine ungünstige Ausgangslage für ein alltagstaugliches Miteinander dar. Institutionelle Strukturen lösen räumliche und soziale Dichteverhältnisse aus. Dieser Zustand führt zu Beengungssituationen, dem sogenannten Crowding (Schultz-Gambard, 1990; Hellbrück & Fischer, 1999; Hellbrück & Kals, 2012; Schönborn & Schumann, 2013). Beengungsgefühle rufen schädigende Wirkungen auf körperliche und seelische Prozesse hervor. Besonders betroffen sind Personengruppen mit eingeschränkten Handlungsalternativen, wie beispielsweise Kinder und alte Menschen (Schultz-Gambard, 1990). Beide Personengruppen werden im Anlass- bzw. Bedarfsfall institutionell betreut, sind also potenziell Betroffene.
Wohnen als emotionale und atmosphärische Wirkungsebene
Das Verlassen der häuslichen Lebensumgebung sowie der Verlust der emotionalen und auf Erinnerungen aufgebauten Raumbindung (Feddersen, 2014) führen zu Unruhezuständen, zu Orientierungslosigkeit (Kaiser, 2012) und im schlechtesten Fall zum Rückzug aus der Gemeinschaft (Michell-Auli & Sowinski, 2013). Ein häuslicher Maßstab ist im Kontext institutionell vorherrschender Rahmenbedingungen oft schwer umsetzbar. Das Wohnen steht im Spannungsfeld zwischen den individuellen Privatheitsansprüchen der Individuen und den Anforderungen der Institution (Radzey, 2014). Der Wohnbegriff steht in direkter Verbindung mit der Identitätsbildung des Menschen (Flade, 2008), mit der Erfüllung des Lebens (Bollnow, 2010) und mit Lebensqualität (Michell-Auli & Sowinski, 2013) im Allgemeinen. Wohnen ist verbunden mit sozialer Gerechtigkeit ein anerkanntes Grundbedürfnis und ein Symbol für Wohlstand und gesellschaftliche Anerkennung. Die Wohnraumgestaltung für ältere Menschen erfordert eine den individuellen Bedürfnissen abgestimmte und alltagsunterstützende räumliche Umgebung. Unter Berücksichtigung altersbedingter Mobilitätseinschränkungen sowie fortschreitender Veränderungen der Sinne müssen wir darauf achten, dass eine den Lebensumständen entsprechende Gestaltung ermöglicht wird und eine Form der Mitgestaltung und Miteinbeziehung (Welter, 1997) gefunden wird. Wohnen ist also die Grundlage für menschliches Handeln und ein Maßstab für häusliche Qualität.
Menschen reagieren auf ihre Umgebung mit ihrem Verhalten. Dieses Verhalten kann auf mehreren Ursachen beruhen und unterschiedliche Ausprägungen hervorbringen, manche davon sind konflikthaft geprägt. Raum ist ein Medium, das Verhalten beeinflusst und formt. Gerade im institutionellen Wohnen müssen wir auf Basis unterschiedlicher Interessenlagen auf diese Wirkung Bezug nehmen und darauf reagieren, wie wir dieses Potenzial in die Institution integrieren. Insofern besteht das Interesse, die Frage zu klären, ob Raum in konflikthaften Situationen präventiv wirksam werden kann und welche Gestaltungsentscheidungen dazu führen, diesen Zustand zu erreichen. Das Ziel besteht darin, Handlungsempfehlungen zu generieren und diese in Form von Gestaltungsprinzipien zu dokumentieren.
1.6 Methodisches Vorgehen
Der Fokus des wissenschaftlichen Interesses liegt auf der Generierung von Handlungsempfehlungen, wobei die wissenschaftstheoretischen Grundlagen und Aufgaben darauf aufbauen, dass die Ergebnisse im Sinne von neuen Erkenntnisgewinnen und weiterer Gestaltung bearbeitet werden. Ziel ist es, anschlussfähige Botschaften zu generieren sowie Forschungsergebnisse und Erfahrungen weiterzugeben (Berger-Grabner, 2013). Die zentralen Ergebnisse basieren zum einen auf einer breitgefächerten, strukturierten und theoriegeleiteten Recherche, die aus der Gesamtheit des Materials zentrale Inhalte reduziert und hypothesenartige Grundsätze verdichtet, zum anderen fließen Erkenntnisse qualitativ erhobener Daten in den zentralen Verdichtungsprozess mit ein. Insgesamt stellt sich ein, dass wir in Summe komplexe Themenlagen erörtern, die wir nicht unabhängig voneinander betrachten können, da diese in einer wechselseitigen Beziehung zueinander stehen. Die theoriegeleitete Recherche bildet die Basis der empirischen Untersuchung. Hypothesenartige Grundsätze führen zu einer prozesshaften Auseinandersetzung und zur inhaltlichen Gestaltung des weiteren Forschungsdesigns. Aufbauend auf den Erläuterungen dieser Grundsätze werden Kategorien gebildet, die als Teil eines Kategoriensystems in den Analysetechniken der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) Anwendung finden.
Der gesamte und vollständige Prozess wird an dieser Stelle nicht näher im Detail verfolgt, dieser ist in der wissenschaftlichen Arbeit: Territorien, Konflikte und Raum (Wörndl, 2018) vertieft beschrieben, dennoch werden die Grundlagen des Vorgehens wie folgt zusammengefasst.
Theoriegeleitete Grundlagen
Die inhaltliche Zusammenfassung der Literaturrecherche lässt uns wiederholt erkennen, dass der Raum als konkrete physische Ausdehnung eine verhaltensverändernde Größe darstellt und auf das Aggressions- und Gewaltverhalten institutioneller Lebensgemeinschaften Wirkung zeigt. Ein Teil dieser Untersuchung bringt Aufschlüsse darüber, wie das Verhalten der Menschen im Raum auf die unterschiedlichen Privatheitsvorstellungen der Individuen reagiert. Soziale und strukturelle Konfliktbegriffe und deren Auswirkungen auf den Pflegealltag sind ebenso Teil der Diskussion wie der Raumbegriff selbst, den wir auf Basis eines emotional atmosphärischen Zugangs erörtern wollen. Rückschlüsse zeigen, wie häusliche Kleinteiligkeit, der Mensch als Maßstab des Raumes und das mitgebrachte Raumempfinden in ein institutionelles Umfeld integriert werden können. Neben diesen Gesichtspunkten sind die individuelle Gestaltungsfreiheit und die Miteinbeziehung Betroffener in gestalterische Prozesse weitere Kriterien der räumlichen Konfliktprävention.
Читать дальше