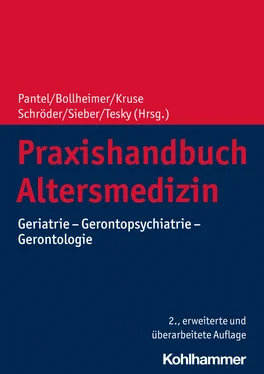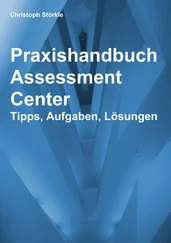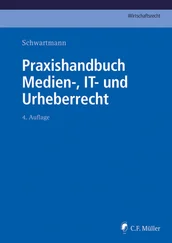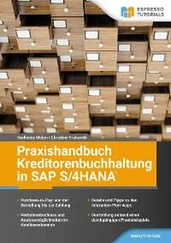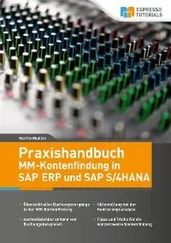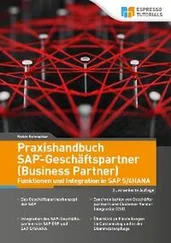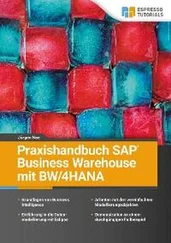Praxishandbuch Altersmedizin
Здесь есть возможность читать онлайн «Praxishandbuch Altersmedizin» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Praxishandbuch Altersmedizin
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Praxishandbuch Altersmedizin: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Praxishandbuch Altersmedizin»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Praxishandbuch Altersmedizin — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Praxishandbuch Altersmedizin», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Zugunsten einer lesefreundlichen Darstellung wird in diesem Buch bei personenbezogenen Bezeichnungen in der Regel die männliche Form verwendet. Diese schließt, wo nicht anders angegeben, alle Geschlechtsformen ein (weiblich, männlich, divers).
2 Epidemiologie und demografischer Wandel
Siegfried Weyerer
2.1 Einleitung
2.1.1 Epidemiologie
Ursprünglich befasste sich die Epidemiologie, und davon leitet sich ihr Wortsinn ab, mit Epidemien, die durch Infektionskrankheiten wie Cholera und Typhus verursacht wurden. So untersuchten beispielsweise im 19. Jahrhundert in England John Snow und in Deutschland Max von Pettenkofer Risikofaktoren für das massenhafte Auftreten von Cholera. Im Laufe der letzten 100 Jahre weitete sich der Gegenstandsbereich der Epidemiologie auf das gesamte Spektrum nicht nur akuter, sondern auch chronischer Erkrankungen aus. Die Epidemiologie stellt neben der biologisch-naturwissenschaftlichen und der klinischen Forschung eine der drei Grundlagen der wissenschaftlichen Medizin dar.
Die Bezeichnung »Epidemiologie« leitet sich aus dem Griechischen her (»epi« = »über« »demos« = das »Volk« und »logos« = die »Lehre«) und bedeutet so viel wie »die Lehre von dem, was über das Volk kommt« oder »was im Volk verbreitet ist«. Der Wortsinn bringt das zentrale Merkmal dieses Forschungsansatzes – den Bevölkerungsbezug – zum Ausdruck. Deskriptive Epidemiologie beschäftigt sich mit der räumlichen und zeitlichen Verteilung von Erkrankungen in der Bevölkerung und der unterschiedlichen Häufigkeit ihres Auftretens im Zusammenhang mit demografischen, genetischen, Verhaltens- und Umweltfaktoren. Analytische Epidemiologie untersucht die Bedingungen des Auftretens und des Verlaufs von Erkrankungen mit dem Ziel, das Wissen über Ursachen, Risiko- und Auslösefaktoren von Krankheitsepisoden und Krankheitsfolgen zu vertiefen. Zur Erreichung ihrer Forschungsziele ist die Epidemiologie auf inhaltliche und methodische Partnerdisziplinen angewiesen: Klinische Fächer, Statistik, Sozialwissenschaften und demografische Forschung spielen dabei eine zentrale Rolle.
2.1.2 Demografie
Die Demografie oder Bevölkerungswissenschaft ist eine wissenschaftliche Disziplin, die sich mit Leben, Werden und Vergehen menschlicher Bevölkerungen befasst. Die quantitative Demografie konzentriert sich hauptsächlich auf die Bevölkerungsstatistik, der qualitative Zweig beschäftigt sich mit den Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb der Bevölkerungsentwicklung. Zentrale Aufgaben der Demografie sind die Beschreibung, Analyse und Erklärung von:
• Bevölkerungsstrukturen (Zusammensetzung der Bevölkerung z. B. nach Alter, Geschlecht, Nationalität)
• Räumlichen Bevölkerungsbewegungen (z. B. Migration) und natürlichen Bevölkerungsbewegungen (Geburten und Sterbefälle) sowie die mit diesen Bewegungen im Zusammenhang stehenden Verhaltenskomplexen (z. B. Heirats- und Scheidungsverhalten)
• Bevölkerungsentwicklungen (z. B. Veränderung der Bevölkerung nach Zahl und Altersstruktur)
• Bevölkerungsverteilung und deren Veränderungen im zeitlichen Verlauf
Die wichtigste Datenquelle der Demografie ist die amtliche Statistik, in der regelmäßig für definierte Regionen Geburten und Sterbefälle, Ein- und Auswanderungen sowie Krankheits- und Todesursachen registriert und aggregiert werden. Im Folgenden wird sich dieser Beitrag hauptsächlich auf den demografischen Wandel in Deutschland konzentrieren und dabei auf zentrale Komponenten wie Migration, Fertilität und Mortalität eingehen, ihre Einflüsse auf die Veränderungen im Altersaufbau darstellen und die Bedeutung verschiedener Unterstützungsindikatoren erläutern. Schließlich werden – als Beispiel für eine besonders fruchtbare Vernetzung von demografischen und epidemiologischen Forschungsansätzen – Ergebnisse zu aktiver Lebenserwartung, Kompression und Expansion der Morbidität dargestellt.
2.2 Demografischer Wandel
Unter »Demografischem Wandel« versteht man eine Entwicklung, in der das Zusammenspiel altersspezifischer Fertilitäts- Mortalitäts- und Nettoimmigrationsraten zu einer Alterung und einer Abnahme der Bevölkerung führt (Tivig und Waldenberger 2011). Im 20. Jahrhundert haben sich enorme Veränderungen im Altersaufbau der Bevölkerung vollzogen. Der Übergang von hoher Fertilität und hoher Mortalität im 19. Jahrhundert zu niedriger Fertilität und niedriger Mortalität in der Gegenwart hat zu einer starken Zunahme der Zahl von alten Menschen und zu einer starken Zunahme ihres Anteils an der Gesamtbevölkerung geführt. Zurückzuführen ist diese Entwicklung hauptsächlich auf Fortschritte im Gesundheitswesen, auf verbesserte Hygiene, Ernährung, Wohn- und Arbeitsbedingungen sowie auf gestiegenen materiellen Wohlstand. Verbunden war damit der sogenannte epidemiologische Übergang, der durch einen Rückgang von tödlich verlaufenden Akuterkrankungen und durch eine Zunahme von langdauernden, chronisch-degenerativen Erkrankungen charakterisiert ist. Ein Blick auf die demografischen Veränderungen, die im Laufe eines Lebensalters eingetreten sind, verdeutlicht Tempo und Dynamik des Bevölkerungsumbaus und macht verständlich, weshalb Alter und Alterserkrankungen zu den größten Herausforderungen der Versorgungssysteme geworden sind (Weyerer und Bickel 2007).
2.3 Migration
Der Altersaufbau einer Gesellschaft kann stark beeinflusst werden durch Migration. Der Begriff Migration umfasst unterschiedliche Formen räumlicher Mobilität von Menschen, wobei verschiedene Wanderungstypen unterschieden werden:
• Zeitlich begrenzte oder dauerhafte Migration
• Freiwillige oder erzwungene Migration
• Grenzüberschreitende Migration (z. B. Einwanderung nach Deutschland) oder Binnenmigration (z. B. Ost-West-Wanderung in Deutschland)
Seit 1950 gab es in Deutschland sowohl Phasen, in denen Abwanderungen überwogen, als auch Phasen hoher Zuwanderung. Insgesamt lag die Nettozuwanderung zwischen 1950 und 2000 bei rund 8 Mio. Personen. Diese resultiert aus über 32 Mio. Zuzügen und knapp 24 Mio. Fortzügen (Deutscher Bundestag 2002).
Die Bevölkerung mit Migrationshintergrund setzt sich zusammen aus den seit 1950 nach Deutschland Zugewanderten und deren Nachkommen. Nach dieser Definition hatten im Jahr 2016 18,6 Mio. Menschen, das ist – bezogen auf die Gesamtbevölkerung – mehr als jeder fünfte Einwohner, einen Migrationshintergrund (Statistisches Bundesamt 2017a). Von ihnen hatten 9,6 Millionen einen deutschen Pass und 9,0 Mio. waren Ausländer. Etwa zwei Drittel aller Menschen mit Migrationshintergrund sind zugewandert und ein Drittel ist in Deutschland geboren. 66,8 % der insgesamt 12,7 Mio. Zuwanderer stammten im Jahr 2016 aus Europa. Die wichtigsten Herkunftsländer waren die Türkei (15,1 %), Polen (10,1 %) und die Russische Föderation (6,6 %).
Personen mit bzw. ohne Migrationshintergrund unterscheiden sich hinsichtlich einer Reihe soziodemografischer Merkmale. Personen mit Migrationshintergrund sind im Durchschnitt mehr als elf Jahre jünger (35,4 versus 46,9 Jahre), und dementsprechend ist der Anteil der alten Menschen niedriger, haben häufiger keinen Schulabschluss, sind häufiger erwerbslos und haben ein höheres Armutsrisiko.
Basierend auf Daten von 2005 haben Kibele et al. (2008) eine differenzierte Untersuchung über alte Migranten in Deutschland durchgeführt. Bezogen auf die 65-Jährigen und Älteren hatten 7,6 % einen Migrationshintergrund und 3,4 % unter ihnen waren Ausländer, hatten also keinen deutschen Pass. Schätzungen zur Lebenserwartung von Ausländern auf der Grundlage von Bevölkerungsstatistiken können sehr stark verzerrt sein. So lag für den Zeitraum von 1995–2004 die durchschnittliche Lebenserwartung der 65-jährigen und älteren Ausländer mit 30,2 Jahren nahezu doppelt so hoch wie bei der deutschen Vergleichsbevölkerung (15,3 Jahre). Wenn in der Bevölkerungsstatistik Wegzüge und Todesfälle von Ausländern, die in ihr Heimatland zurückgekehrt sind, nicht erfasst werden, so führt das zu einer krassen Unterschätzung der Sterbeziffern. Basierend auf wesentlich genaueren Daten der Deutschen Rentenversicherung ergibt sich ein realistischeres Bild: Die durchschnittliche Lebenserwartung Über-65-Jähriger liegt bei Deutschen (15,6 Jahre) und Ausländern (15,0 Jahre) in einer ähnlichen Größenordnung. Bei diesem Vergleich sind jedoch verschiedene Komponenten zu berücksichtigen, die sich auf den Gesundheitszustand und damit verbunden die Lebenserwartung auswirken: Die heute alten Ausländer, überwiegend Arbeitsmigranten aus den 1950er–1970er Jahren, hatten bei der Einwanderung im Durchschnitt eine bessere Gesundheit als die einheimische Bevölkerung (Healthy-Migrant-Effect). Andererseits haben Ausländer eine Reihe von Risiken, die sich ungünstig auf die Gesundheit und die Lebenserwartung auswirken: eingeschränkte Bildungschancen, erhöhtes Armutsrisiko und schwere körperliche Arbeit. Alte Menschen mit Migrationshintergrund rekrutieren sich hauptsächlich aus der Gruppe der Arbeitsmigranten aus den 1960er und 1970er Jahren. Aus den sozialen und kulturellen Besonderheiten ihrer Lebenssituation ergeben sich besondere Anforderungen an die gesundheitliche und pflegerische Versorgung im Alter (Hoffmann et al. 2009a).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Praxishandbuch Altersmedizin»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Praxishandbuch Altersmedizin» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Praxishandbuch Altersmedizin» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.