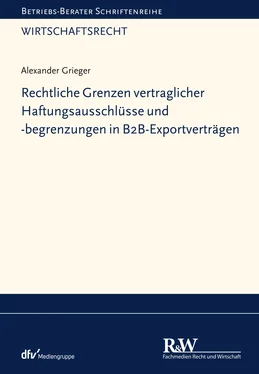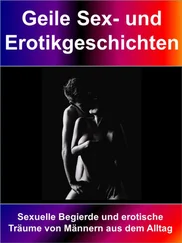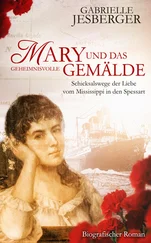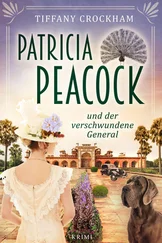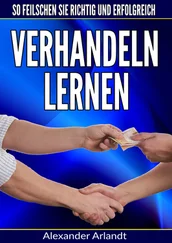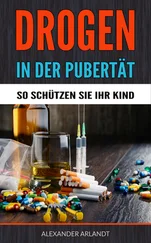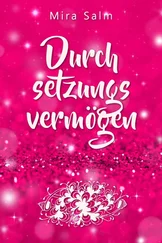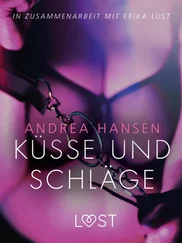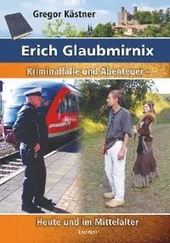167Miethaner, AGB-Kontrolle versus Individualvereinbarung, S. 1; zur Üblichkeit von Regelungen zu Haftungsfragen in AGBs in den meisten AGBs siehe statt vieler: Niebling, Allgemeine Geschäftsbedingungen – Allgemeiner Teil/Grundlagen, S. 127. 168Koch, BB 2010, S. 1810ff. (1810); Lischek/Mahnken, ZIP 2007, S. 158ff. (158/159); für Bestellformulare im Allgemeinen, insbes. bei tlw. Befüllung: BGH, Urt. v. 18.05.1983 – VIII ZR 20/82, Ziffer II.2.a. 169Koch, BB 2010, S. 1810ff. (1810). 170ULMER/BRANDNER/HENSEN-Ulmer/Habersack, Einl. Rn. 50. 171Stellvertretend der als Justiziar tätige Rechtsanwalt Kollmann in Kollmann, NJOZ 2011, S. 625ff. (625). 172ULMER/BRANDNER/HENSEN-Ulmer/Habersack, Einl. Rn. 5 u. 47–54; Koch, BB 2010, S. 1810ff. (1811). 173Schuhmann, BB 1996, S. 2473ff. (2475); Koch, BB 2010, S. 1810ff. (1810); Del Popolo, Grenzen des AGB-Rechs im unternehmerischen Alltag und das damit zusammenhängende Risikomanagement an Hand von praxisrelevanten Beispielen, S. 122; vgl. auch MÜNCHNER VERTRAGSHANDBUCH Bd. 2/I-Kratzsch, S. 329ff.. 174Leuschner, AcP Bd. 207 (2007), S. 491ff. (517); Huth, Kontrolle Allgemeiner Geschäftsbedingungen im unternehmerischen Geschäftsverkehr unter Berücksichtigung geltender Gewohnheiten und Gebräuche, S. 96. Das Erfordernis der Nutzung von Musterverträgen nicht nur aus Sicht des Qualitätsmanagements zur Fehlerreduzierung sehend (STAUB/HEHLI HIDBER-Staub Kapitel 3 D Rn. 11) sondern auch als strategischen Wettbewerbsvorteil und Teil des Wissensmanagements zur erfolgreichen Kanzleiführung (STAUB/HEHLI HIDBER-Schulz Kapitel 3 D Rn. 11). Aus Sicht des Unternehmensjuristen bestätigend: Del Popolo, Grenzen des AGB-Rechs im unternehmerischen Alltag und das damit zusammenhängende Risikomanagement an Hand von praxisrelevanten Beispielen, S. 2, 36. Dabei auch eine Verpflichtung aus Sicht der Compliance sehend, um andere Risiken adäquat zu vermeiden: ders., S. 102. 175Keller, AnwBl 4/2012, S. 293ff. (297f.); Koch, BB 2010, S. 1810ff. (1810); Huth, Kontrolle Allgemeiner Geschäftsbedingungen im unternehmerischen Geschäftsverkehr unter Berücksichtigung geltender Gewohnheiten und Gebräuche, S. 95. Die äußere Erscheinungsform hinsichtlich Aussehens und Schriftbild im Rahmen der Ermittlung gestellter Vertragsbedingungen als tatsächliche Vermutung ansehend: OLG Nürnberg, BKR 2017, S. 251ff. (253). 176ULMER/BRANDNER/HENSEN-Ulmer/Habersack, Einl. Rn. 4; Koch, BB 2012, S. 1810ff. (1810); Kessel/Jüttner, BB 2008, S. 1350ff. (1350); Lischek/Mahnken, ZIP 2007, S. 158ff. (158/159). 177Richter, Allgemeine Geschäftsbedingungen im B2B-Verkehr in Deutschland, der Schweiz und England – unter besonderer Berücksichtigung von Haftungsklauseln in Kaufverträgen und der ökonomischen Analyse des Rechts, S. 95. 178Koch, BB 2010, S. 1810ff. (1810/1811). 179Koch, BB 2010, S. 1810ff. (1811). 180Koch, BB 2010, S. 1810ff. (1811). 181Bruns, Haftungsbeschränkung und Mindesthaftung, S. 339/340; so i.E. auch Graf v. Westphalen, ZIP 2002, S. 545ff. (545). 182So i.E. auch Graf v. Westphalen, ZIP 2002, S. 545ff. (545).
B. Grundbegriffe und -konzepte der vertraglichen Beschränkbarkeit von Haftung
Vertragliche Haftungsbeschränkungen oder -ausschlüsse können, wie zuvor beschrieben, entweder auf der Tatbestandsseite ansetzen (z.B. keine Haftung für bestimmte Handlungen oder Unterlassungen oder nur für ausgewählte Verschuldensstufen) oder auf der Rechtsfolgenseite bestimmte Schadensarten (wie Folgeschäden) aus dem Haftungsumfang ausklammern oder limitieren183. Zudem sind auch zeitliche Befristungen durch vertraglich vereinbarte Verfristungen und vom gesetzlichen Leitbild abweichende Verjährungsregeln denkbar184.
Es gilt als anerkanntes Rechtsprinzip, dass vertraglich vereinbarte Haftungsklauseln – sofern diese zulässig sind – den gegebenenfalls parallellaufenden deliktischen Ansprüchen auf Schadensersatz vorgehen und auch zu einer Beschränkung der eigentlich unbeschränkten Deliktshaftung führen185.
Nicht problematisiert oder näher konkretisiert wird im Rahmen dieser Arbeit die in § 276 Abs. 1 S. 1 BGB angesprochene Möglichkeit, dass durch den Schuldner eine strengere als die gesetzliche Haftung (insbes. aus der Abgabe einer Garantie 186) eingegangen wird. Nachdem es sich – selbst bei betragsmäßigen oder inhaltlich eingeschränkten – Garantien nicht um Beschränkungen der gesetzlichen Haftung handelt, sondern um ein frei gestaltetes Haftungsregime mit dem Ziel der Haftungserweiterung, wäre eine Ausweitung des Betrachtungsgegenstandes im Rahmen der Zielsetzung dieser Arbeit nicht zielführend187.
Zudem ist höchstrichterlich festgestellt, dass bei der Abgabe von Garantien (sofern der Garantietext selbst nicht bereits die Inanspruchnahmevoraussetzungen und Rechtsfolgen beinhaltet) keine Haftungsausschlüsse oder Haftungsbeschränkungen vereinbart werden können188.
183ULMER/BRANDNER/HENSEN-Fuchs, § 307 Rn. 299; Bruns, Haftungsbeschränkung und Mindesthaftung, S. 3, 6/7, 301; PALANDT-BGB-Grüneberg, § 307 Rn. 41/42. 184ULMER/BRANDNER/HENSEN-Fuchs, § 307 Rn. 299. 185H.M, vgl. PALANDT-BGB-Grüneberg, § 307 Rn. 49; Bruns, Haftungsbeschränkung und Mindesthaftung, S. 239/240. 186Hierunter werden i.d.R. selbständige Garantien (d.h. eigenständiges Haftungsregime neben gesetzlicher Gewährleistung mit zusätzlichem, verschuldensunabhängig zugesagtem Leistungserfolg) und unselbständige Garantien (d.h. aufbauend auf gesetzlicher Gewährleistung, ohne zusätzlich zugesagtem Leistungserfolg) verstanden, wobei die Abgrenzung mangels gesetzlicher Definition im Einzelfall schwierig ist (vgl. aber zur Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie § 443 BGB). Vgl. PALANDT-Putze, § 443 Rn. 4. 187So auch Bruns, Haftungsbeschränkung und Mindesthaftung, S. 341. 188Die Unzulässigkeit des Haftungsausschlusses für Mangelfolgeschaden in den VDMA-Musterbedingungen für den Fall der Abgabe einer Garantie feststellend: BGH, Urt. v. 05.12.1995 – X ZR 14/93, Ziffer IV.3.
C. Entstehungsgeschichte und Begründung der AGB-Kontrolle
I. Einführung
Um zu verstehen, welche Zielsetzung die AGB-Kontrolle im B2B-Bereich verfolgt, ist es zuallererst von Nöten, das „Woher“ und „Warum“ näher zu ergründen. Nur so lässt sich überprüfen, ob es zu den proklamierten Fehlentwicklungen gekommen ist, und welche inhärenten Problemstellungen und Lösungswege existieren.
II. Gesetzgeberische Entstehungsgeschichte
Bereits vor Einführung des AGBG zum 01.04.1977 nahm zuerst das RG, später auch der BGH, eine Inhaltskontrolle bei Verträgen vor189. Während das RG ursprünglich unerwünschten Risikoverlagerungen nur mit einer restriktiven Deutung solcher Klauseln begegnete, zog es sich später auf § 138 BGB als Bewertungsmaßstab zurück190. Ansatzpunkt war hier, dass die Machtstellung des Verwenders (ursprünglich durch nur eine Person, später auch durch Unternehmensgruppen) – im Sinne einer Monopolstellung – hervorgehoben war191. Ab 1956 setzte der BGH diese Entwicklung unter Verweis auf Treu und Glauben (§ 242 BGB) fort, ohne weitere Anforderungen an die Machtstellung des Verwenders zu stellen192. Formelle Kriterien waren bis zur Einführung des AGBG jedoch kein Thema193.
Das AGBG und somit die offene Inhaltskontrolle wurde ursprünglich von den beteiligten politischen Parteien mit der Hauptintention des Verbraucherschutzes ins Leben gerufen194. Erst kurz vor Gesetzeseinführung setzte sich – auch basierend auf Empfehlungen des Deutschen Juristentages 1974195 – die Ansicht durch, dass auch Geschäfte im kaufmännischen Geschäftsverkehr berücksichtigt werden sollen, weil nicht die beteiligten Personenkreise, sondern die einseitige Ausnutzung der Privatautonomie zu Lasten des anderen Vertragspartners im Fokus standen196.
Читать дальше