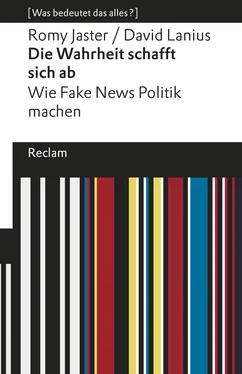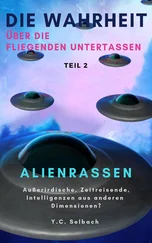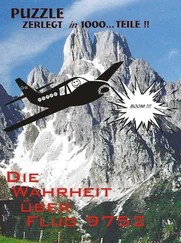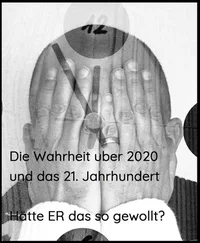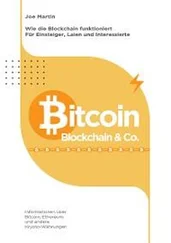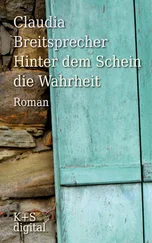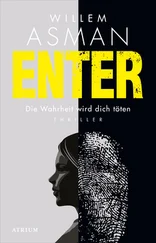In Deutschland lassen sich bei der AfD etliche Nachahmungen des Trump’schen Vorgehens entdecken. Zum Beispiel verteidigte sich der Berliner AfD-Politiker Georg Pazderski in einer Fernsehsendung des RBB auf die Frage, warum er von steigenden Kriminalitätsraten unter Ausländern rede, obwohl es dafür keinerlei Anhaltspunkte gebe, mit den Worten: »Das, was man fühlt, ist auch Realität.«1 Wie Trump, Gingrich und Conway bedient sich die AfD unhaltbarer Provokationen und irreführender Stereotype, um im Zentrum der Aufmerksamkeit zu bleiben – ungeachtet der Wahrheit der Aussagen.
Immer wieder ist dabei eine Art Schulterschluss zwischen der AfD und Russland zu beobachten. Ein Beispiel ist der Fall der 13-jährigen russischstämmigen Lisa, die im Januar 2016 auf ihrem Schulweg in Berlin-Marzahn verschwand. Zwar tauchte sie am nächsten Tag wieder auf; allerdings hatten ihre Eltern sie zu diesem Zeitpunkt bereits als vermisst gemeldet. Der Polizei gegenüber gab Lisa fälschlicherweise an, von »Südländern« vergewaltigt worden zu sein. Diese Falschinformation kursierte in den sozialen Medien auch dann noch weiter, als längst zweifelsfrei geklärt worden war, dass Lisa weder von Südländern noch von sonst irgendwem entführt oder vergewaltigt worden war. Mithilfe einiger russischer Staatsmedien verbreitete sie sich schließlich so weit, dass sich sogar der damalige russische Außenminister Sergei Lawrow einschaltete.2
Der Fall ist deshalb interessant, weil er zeigt, dass die Verbreiter von Fake News gut vernetzt sind und in manchen Fällen staatenübergreifend zusammenwirken. So verbreiten die russischen Staatsmedien RT (früher Russia Today ) und Sputnik auch international strategische, politisch motivierte Desinformation: Vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich im Frühjahr 2017 streuten sie beispielsweise Unwahrheiten über Emmanuel Macrons Privatleben, unter anderem, dass er homosexuell sei.3 Dass Russland die Wahlen in Frankreich beeinflussen wollte, ist heute genauso gut belegt wie im Falle des US-Wahlkampfs wenige Monate zuvor.4
Natürlich sind Falschmeldungen, Verschwörungstheorien und Desinformation kein Alleinstellungsmerkmal russischer Propaganda-Medien und rechtspopulistischer Polit-Karrieristen. Auch im linksprogressiven Spektrum haben Fake News die Runde gemacht.
Zu Beginn der US-Wahlkampagne wurde beispielsweise ein Meme massenhaft geteilt, demzufolge Trump dem People Magazine 1998 gesagt habe, er würde im Fall einer Präsidentschaftskandidatur für die Republikaner antreten, weil sie die dümmsten und leichtgläubigsten Wähler hätten.5 Im Gegensatz zu der Unmenge an Unglaublichkeiten, die Trump im Laufe der Jahre tatsächlich von sich gegeben hat, war dieses Zitat jedoch nur eine Erfindung.
Reaktionen und erste Maßnahmen
Die Fülle an Fake News hat etliche Reaktionen provoziert. Nahezu überall erörtern Diskussionsrunden und Think Tanks die Frage, wie man das Problem in den Griff bekommen kann. Forschungsprojekte versuchen, die Effekte von Fake News auf Politik und Gesellschaft zu bestimmen. Faktencheck-Organisationen tun ihr Möglichstes, Fake News durch Richtigstellungen beizukommen. Und dennoch: Obwohl Fachleute überall auf der Welt darum bemüht sind, Fake News zu bekämpfen, zirkulieren sie fröhlich weiter. Auf Facebook und Twitter sind Fake News sogar erfolgreicher als wahre Nachrichten; sie verbuchen mehr Interaktionen in Form von Likes, Shares und Klicks.1
Zwar sehen sich mittlerweile einige Internetkonzerne mit der Forderung konfrontiert, gegen Fake News vorzugehen. Ihr Erfolg jedoch ist mäßig. Das mag einerseits an einer gewissen Zögerlichkeit der Firmen liegen, in dieser Sache Geld in die Hand zu nehmen. Andererseits ist es nicht so einfach, unter Millionen von Nachrichten und Kommentaren Fake News zu identifizieren. Facebook etwa setzt spezielle Algorithmen ein und beschäftigt Hunderte Menschen, die von Hand das Netzwerk nach Falschmeldungen durchkämmen.2 Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen mit einer Reihe von Faktencheck-Organisationen zusammen. Bislang ist es jedoch weder Facebook noch den anderen Internetkonzernen gelungen, das Problem zu lösen.
Die Folgen konnte man vor der Bundestagswahl 2017 auch in Deutschland beobachten. Laut einer Untersuchung des Internetportals Buzzfeed waren im Wahlkampf vor allem erfundene Schlagzeilen über Angela Merkel erfolgreich.3 Diese lauteten zum Beispiel: »Angela Merkel: Deutsche müssen Gewalt der Ausländer akzeptieren« oder »Manipulation: Merkel zensiert ARD-Tagesschau«.
Im Jahr der Bundestagswahl 2017 erhöhte die deutsche Politik daher den Druck auf die Internetkonzerne und erließ ein Gesetz, das Hetze und Fake News im Internet eindämmen soll. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) verpflichtet die Anbieter sozialer Netzwerke darauf, transparent mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte umzugehen, diese innerhalb von sieben Tagen zu löschen und halbjährlich über die ergriffenen Maßnahmen zu berichten.4
Das Gesetz ist jedoch umstritten. Einige Journalistenorganisationen – darunter Reporter ohne Grenzen und der Deutsche Journalistenverband – sehen durch das Gesetz die Meinungsfreiheit gefährdet. Zugleich ist der Einflussbereich des Gesetzes begrenzt, da es nur jene Fake News adressiert, die einen Straftatbestand erfüllen, etwa Verleumdung oder Volksverhetzung. Die riesige Menge »einfacher« Lügen und Täuschungsversuche ist davon unbetroffen. Doch auch solche Fake News haben einen erheblichen Einfluss und werden zunehmend genutzt, um die Öffentlichkeit in die Irre zu führen.
Die fatalen Folgen von Fake News
Im Jahr 2016 saß der pakistanische Verteidigungsminister der Falschmeldung auf, Israel bedrohe Pakistan mit einem nuklearen Angriff. In Reaktion auf die vermeintliche Drohung kündete er seinerseits einen Atomschlag auf Israel an.1 Zum Glück blieb es bei einem diplomatischen Zwischenfall. Was Fake News bewirken können, macht der Fall jedoch unmissverständlich klar.
In Indien forderten Fake News bereits Todesopfer. Dort verbreiteten sich 2018 über den Nachrichtendienst Whatsapp falsche Berichte über angebliche Kindesentführungen und den Handel mit deren Organen. Auch gefälschte Videos der Entführungen und Bilder von zerstückelten Kindern waren im Umlauf. Die Hysterie über diese Berichte führte schließlich dazu, dass mindestens 20 Menschen zu Tode geprügelt wurden, weil man sie für mögliche Entführer hielt. Dutzende weitere Menschen wurden verletzt.2
Auch in Deutschland hatten Fake News Gewaltausschreitungen zur Folge. Im Spätsommer 2018 wurde bei einem Stadtfest in Chemnitz ein Deutscher erstochen. Die mutmaßlichen Täter waren ein Syrer und ein Iraker. Anschließend kam es in der Stadt zu gewalttätigen Demonstrationen rechter Gruppierungen. Fake News kamen ins Spiel, als die Meldung die Runde machte, zu der Tat sei es gekommen, weil das Opfer eine Frau gegen einen sexuellen Übergriff verteidigt habe. Wie die Polizei kurz darauf erklärte, gab es keinerlei Anhaltspunkte für diese Behauptung. Doch nachdem das Internetportal Tag24 die Meldung wenige Stunden nach der Tat veröffentlicht hatte, gab es kein Halten mehr: Der Bericht war in der Welt und heizte die ohnehin schon brodelnde Stimmung an. Es kam zu gewaltsamen Ausschreitungen und Übergriffen auf ausländisch aussehende Menschen.3
Seit Menschen sprechen können, lügen sie sich gegenseitig an. Wir täuschen einander, gehen anderen auf den Leim und geben vor zu sein, was wir nicht sind. Menschen haben seit eh und je Gerüchte gestreut, Intrigen gesponnen und einander in die Irre geleitet. Schon berittene Boten überbrachten Falschmeldungen. Die antiken Athener versuchten die ionischen Städte Kleinasiens zu dominieren, indem sie die Lüge verbreiteten, jene seien athenische Gründungen. Viele Fürstenhöfe unterhielten während der italienischen Renaissance spezielle Kanzleien, die Falschnachrichten erfanden und sie im Volk verbreiteten.1 Für den Philosophen Niccolò Machiavelli (1469–1527) beruhte erfolgreiche Politik sogar auf der Kunst des Betrugs und der Fälschung.2
Читать дальше