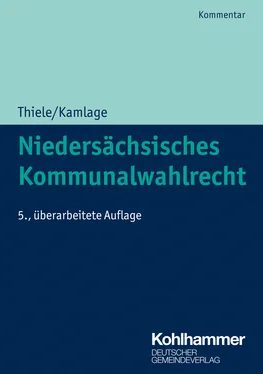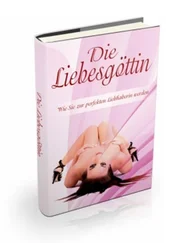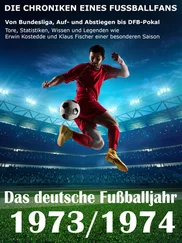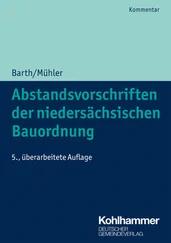Bei der Verhältniswahl ist zur Übertragung des Stimmenverhältnisses auf das Sitzverhältnis ein bestimmtes Berechnungsverfahren erforderlich. Eine der möglichen Berechnungsmethoden ist das von dem belgischen Mathematiker Victor d'Hondt 1882 entwickelte Höchstzahlverfahren, das bei den niedersächsischen Kommunalwahlen bis 1977, von 1984 bis 1991 und von 1996 bis 2006 galt. Beim Höchstzahlverfahren nach d'Hondt werden die auf die einzelnen Wahlvorschläge der Parteien, Wählergruppen und Einzelvertreter entfallenen Stimmen so oft durch 1, 2, 3 usw. geteilt, bis aus den gewonnenen Teilungszahlen so viele Höchstzahlen ausgesondert werden können, wie Sitze zu vergeben sind. In der Reihenfolge der so ermittelten Höchstzahlen werden dann den Wahlvorschlagsträgern die Sitze zugewiesen.
Bei dem nach dem englischen Verfassungsjuristen des 19. Jahrhunderts Thomas Hare und dem in Marburg lehrenden deutschen Mathematikprofessor Horst Niemeyer benannten Berechnungsverfahren wird die Gesamtzahl der zu vergebenden Sitze mit der Stimmenzahl der jeweiligen Partei multipliziert und durch die Gesamtzahl aller Stimmen dividiert. Diese Berechnung ergibt „Proportionalzahlen“. Jede Partei erhält zunächst so viele Sitze, wie sich nach ihrer „Proportionalzahl“ für sie ganze Zahler ergeben. Die danach noch zu vergebenden Sitze erhalten die Parteien mit den höchsten Zahlenbruchteilen. Beide Verfahren kommen überwiegend zu demselben Ergebnis. In Grenzfällen kann die errechnete Sitzverteilung jedoch um einige Mandate differieren, wobei sich beim d'Hondtschen Verfahren eher ein für größere Parteien, beim Hare-Niemeyer-Verfahren eher ein für kleinere Parteien günstiges Ergebnis ergibt.
Nachdem das Verfahren nach Hare-Niemeyer erstmals 1970 bei der Besetzung der Bundestagsausschüsse praktiziert worden war, 27wurde es 1977 in Niedersachsen für die Sitzverteilung bei den Kommunalwahlen eingeführt (G 18). 28In der Begründung des von den Koalitionsfraktionen CDU und FDP eingebrachten Gesetzentwurfs hieß es, das Hare-Niemeyer-Verfahren lasse Stimmenreste effektiver und gerechter in die Sitzverteilung einfließen als die Berechnung nach d'Hondt. 29Bei der intensiven Beratung des Gesetzes in den Landtagsausschüssen – teilweise unter Beteiligung von Prof. Niemeyer – stellte sich heraus, dass in bestimmten Fällen eine absolute Stimmenmehrheit für eine Partei nicht auch eine absolute Sitzmehrheit zur Folge hat. Für diesen Fall wurde die Vergabe eines „Vorabsitzes“ an die Partei mit der absoluten Stimmenmehrheit bestimmt (modifiziertes Proportionalverfahren).
Die SPD, die das Gesetz im Landtag abgelehnt hatte, 30strengte ein Normenkontrollverfahren beim Niedersächsischen Staatsgerichtshof an. Nachdem ihr Antrag, die anstehenden Kommunalwahlen durch einstweilige Anordnung bis zur Entscheidung in der Hauptsache zu verschieben, vom Staatsgerichtshof abgelehnt worden war, 31stellte dieser zwei Monate später in seinem Urteil fest, dass die angefochtenen Wahlrechtsbestimmungen mit der Vorläufigen Niedersächsischen Verfassung vereinbar seien. 32
1984 wurde das Berechnungsverfahren nach d’Hondt – mit den Stimmen der CDU und der SPD, gegen die Stimmen der FDP und der GRÜNEN – wieder eingeführt (G 22). 33In den Beratungen wurde auf die praktischen Erfahrungen bei der vorangehenden Wahl hingewiesen, die die Nachteile des Hare-Niemeyer-Verfahrens offenbart hätten. Da eine Sperrklausel nicht bestehe und auch nicht eingeführt werden solle, könne das d'Hondtsche Verfahren dazu beitragen, einer Parteienzersplitterung entgegenzuwirken und die Mehrheitsbildung zu erleichtern. 34Mit den Stimmen von CDU, FDP und GRÜNEN und gegen die Stimmen der SPD wurde 1987 (G 24) erneut das Hare-Niemeyer-Verfahren eingeführt (Anwendung erstmals bei den allgemeinen Neuwahlen 1991). Entsprechend der mit der Vermeidung der dem Proportionalverfahren innewohnenden Tendenz zur Begünstigung kleinerer Gruppierung begründeten Empfehlung der Enquete-Kommission zur Überprüfung des Niedersächsischen Kommunalverfassungsrechts 35ist der Landtag 1995 (G 27) wieder zum Verfahren nach d’Hondt zurückgekehrt (erstmals für die Wahlen 1996). Nach dem Regierungswechsel 2003 ist dann aufgrund der Koalitionsvereinbarung zwischen CDU und FDP mit Beginn der Wahlperiode 2006 wieder das Proportionalverfahren eingeführt worden (G 32).
a) Träger von Wahlvorschlägen.Träger von Wahlvorschlägen konnten von Anfang an Parteien und Einzelpersonen sein. Als Parteien wurden auch örtliche Wählervereinigungen (Rathausparteien) angesehen, wenn sie bestimmten Mindestanforderungen entsprachen, die das OVG Lüneburg in ständiger Rechtsprechung entwickelt hatte. 36Im Gegensatz hierzu entschieden das Bundesverfassungsgericht 37und das Bundesverwaltungsgericht 38, dass Organisationen mit lediglich kommunaler Zielsetzung keine Parteien im Sinne des Grundgesetzes seien. Das Bundesverwaltungsgericht kam allerdings in einer weiteren Entscheidung zu der Auslegung, dass – nach geltendem niedersächsischem Kommunalwahlrecht – auch Rathausparteien als politische Parteien verstanden werden könnten. 39
Zur Klarstellung wurde schließlich im Einvernehmen aller Parteien gesetzlich festgelegt, dass Wahlvorschläge künftig nur noch von Parteien im Sinne des Grundgesetzes, nicht aber von Wählervereinigungen eingereicht werden konnten (G 1). Die Wahlausschüsse hatten fortan aufgrund der Wahlanzeige festzustellen, welche Vereinigungen für die Wahl als Parteien anzuerkennen waren. Bereits fünf Monate später wurden erneut auch Wahlvorschläge von Wählergruppen zugelassen (G 3), nachdem das Bundesverfassungsgericht überraschend in einer Entscheidung zum Kommunalwahlgesetz des Saarlandes festgestellt hatte, dass ortsgebundene Wählervereinigungen bei Kommunalwahlen nicht vom Wahlvorschlagsrecht ausgeschlossen sein dürften. 40Mit dieser Gesetzesänderung entfiel zugleich das Erfordernis der Anerkennung der Parteieigenschaft durch die Wahlausschüsse, wenig später (G 5) auch die Wahlanzeigepflicht. Letztere wurde 1971 wieder eingeführt. Die Beteiligung an der Wahl war nun beim Landeswahlleiter anzuzeigen, die Feststellung der Parteieigenschaft lag beim Landeswahlausschuss (G 12). Dies diente einer landeseinheitlichen Abgrenzung zwischen Parteien und örtlichen Wählergruppen, was vor allem die Arbeit der örtlichen Wahlorgane erleichtern sollte. 41
b) Wahlvorschlagsverbindungen.Die seit 1956 bestehende Möglichkeit einer Verbindung von Wahlvorschlägenentfiel – gegen den Widerstand der oppositionellen CDU – im Jahre 1960 mit der Begründung, dass der Wählerwille klar und unverfälscht zum Tragen kommen und das Wahlsystem vereinfacht werden solle (G 1). 42Bei Einführung des Wahlvorschlagsrechts der Wählergruppen (G 3) wurde im selben Jahr die Möglichkeit der Wahlvorschlagsverbindung wieder eingeführt. 43Eine ergänzende Regelung bestimmte wenig später, dass nicht nur Parteien und Wählergruppen, sondern auch Einzelbewerber an einer Wahlvorschlagsverbindung beteiligt sein konnten (G 5).
Die Möglichkeit von Wahlvorschlagsverbindungen wurde 1971 – erneut gegen die Stimmen der CDU – wieder gestrichen (G 12). Dies sollte dem Grundsatz der Klarheit der Wahl dienen und die Entscheidung des Wählers vor jeglicher Einengung bewahren. 441984 setzte die CDU die Wiedereinführung der Wahlvorschlagsverbindung durch (G 22). Begründet wurde dies damit, dass so ein Minderheitenschutz für kleinere Gruppierungen geschaffen werde, die in kleinen Wahlgebieten oft nur im Rahmen einer Wahlvorschlagsverbindung einen Sitz erlangen könnten. Außerdem seien frühere Bedenken wegen einer möglichen Einschränkung der Wählerentscheidung entfallen, nachdem inzwischen ein Personenwahlrecht mit drei Stimmen und mit der Möglichkeit des Panaschierens eingeführt worden sei. 45
Читать дальше