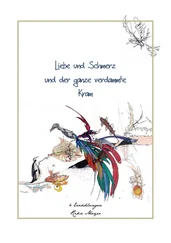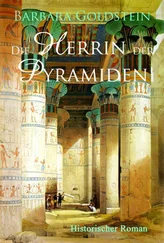Alle, die überlebt hatten, hatten mit sich selbst zu tun. Es war nicht so: »Ach, da ist ja der kleine Winfried, den werden wa mal zu uns nehmen!« Ich wäre auch bloß eine Belastung gewesen. Wenn die Schwestern nicht gewesen wären, die das vielleicht von Beruf aus so machen, dann wäre es mir wahrscheinlich ganz schön mies ergangen damals. Die Schwestern hatten viel zu tun. Sie pflegten die vielen Verletzten und mussten die Organisation der Pfarrei übernehmen. Der Pfarrer, ein Kaplan und sechs Schwestern waren bei dem Einsturz gestorben, die ganze Leitung war nicht mehr da.
Irgendwann im Sommer kam mein Vater zurück. Er war in der Flugzeugindustrie dienstverpflichtet gewesen. Nun waren wir eben beide alleine … bis er eine neue Frau kennenlernte und eine neue Familie gründete. Ich habe keine leiblichen Geschwister mehr, aber Halbgeschwister und Stiefgeschwister, da machen wir überhaupt keinen Unterschied.
Als ich vor zwei Jahren das erste Mal wieder den Kirchhof betrat und die Grabinschriften las, erinnerte ich mich an einige Namen wie den von Herrn Seeliger. Er hatte damals seine 18-jährige Tochter und seine Frau bei dem Einsturz verloren. Er war als Einziger übrig geblieben. Er hat sie selber ausgegraben. In der Nacht hatte er noch immer geglaubt, er fände sie lebend.
Da ist noch vieles zu erzählen. Ich denke zum Beispiel an den Bruder von meinem Spielkameraden. Der Conrad muss bei Kriegsende ungefähr fünfzehn gewesen sein. Seine Mutter hatte ihn in den letzten Kriegsmonaten vor den Nazis versteckt. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben? Zum Schluss liefen die Nazis mit einer Armbinde durch alle Luftschutzkeller und suchten nach wehrfähigen Männern. Egal ob alt oder jung, sie mussten alle zum Volkssturm, und meist hat man nie wieder etwas von ihnen gehört. Wir Kinder wussten nicht, wo der Conrad versteckt war, denn wenn wir das rausgeplappert hätten, wäre er wahrscheinlich wer weiß wohin gekommen. In den letzten Kriegstagen hatte ihn seine Mutter mit zu uns in die Krypta genommen und dort in einer Ecke versteckt. Vorm Volkssturm hat sie ihn bewahrt, und in der Krypta ist er umgekommen – mit seiner Mutter zusammen. So wie meine Mutter und meine Geschwister …
»Die Bomben, die euch treffen, die hört ihr nicht.«
Waldemar Klemm
(Geboren 1936 in Berlin, Sozialarbeiter)
Dann kam der Krieg. Unser Haus wurde zerstört. Wir überlebten im Keller, unsere Nachbarn nicht, von denen kam keiner aus dem Keller wieder raus. Wir wurden mit einem Programm für obdachlos gewordene Familien außerhalb der Stadt in eine Villa umgesiedelt. Dann fiel da die Bombe. Dann war da die Hälfte tot und wir überlebten wieder.
Meine früheste Kindheitserinnerung: Nachdem unser Haus in Berlin zerstört worden ist, kommen wir aus dem Keller raus. Wir laufen mitten auf der Straße, weil links und rechts die Häuser brennen. Sie brechen in sich zusammen. Auf dem Bürgersteig ist es unmöglich zu laufen. Es ist nachts und hell erleuchtet, weil alles brennt. Das sind Eindrücke, die bleiben einem. Da war ich sechs. Wir waren im Keller verschüttet, die Männer mussten uns erst freigraben. Auf der Straße lag noch eine Puppe aus unserer Wohnung. Die Wohnung war nicht mehr da. Die Puppe nahmen wir mit.
Für unsere Mutter muss es fürchterlich gewesen sein. Sie musste uns immer aus dem Tiefschlaf reißen und uns in den Keller schleppen. Dort hörten wir das Pfeifen der Bomben und das fürchterliche Beben vom ganzen Haus. Die Erwachsenen erklärten uns, das sei gar nicht so schlimm: »Wenn ihr den Schall hört, dann ist es schon erledigt, dann wurden wir nicht getroffen. Die Bomben, die euch treffen, die hört ihr nicht.« Das verstand ich nicht, aber es war ein Trost. Zuerst hörten wir ein fürchterliches Pfeifen, und gleich danach rumste es dann. Im Keller waren die Leute ängstlich, aber ruhig. Zwischendurch Rufe: »Oh Gott, jetzt schon wieder!«
»Nein, die hat uns nicht getroffen!«
»Wo mag die Bombe runtergekommen sein?«
Sie glaubten, auch das Pfeifen unterscheiden zu können.
»Das war eine Sprengbombe und das war eine Mine.« Die Minen waren schlimmer als die Sprengbomben. Die Phosphorbomben brannten tagelang in unserer Straße. Die Feuerwehr hatte gespritzt, fuhr weg und es brannte weiter. Phosphor lässt sich nicht mit Wasser löschen.
Bei der zweiten Ausbombung lag der Bombentrichter fünfzig Meter von unserem Haus entfernt. Die Bombe hatte unser Haus nicht getroffen, sonst wären wir nicht mehr da. Es war schlimm. Es ist ein dumpfes Geräusch, das auf die Ohren geht, wenn ein Haus in sich zusammenfällt. Wir mussten uns freibuddeln. Das sind schon ganz üble Erinnerungen … Ein Mann, der mit uns im Haus gewohnt hatte, sagte die ganze Zeit: »Wo geht es denn lang, ich kann ja nichts sehen.« Ich sagte: »Guck mal, da geht es lang.«

Flüchtende Frauen und Kinder in einer umkämpften Straße in Danzig (März 1945)
Bei Tageslicht konnte er immer noch nichts sehen. Er war erblindet, hatte Splitter ins Auge gekriegt. Mein Bruder hatte Glassplitter ins Gesicht bekommen. Noch zehn Jahre später kamen sie an der Stirn oder neben dem Auge raus.
»Alles ist aus, das Licht ist aus, alles aus …«
Dieter Hadel
(Geboren 1934 in Berlin, Ingenieur)
Es war Winter, als wir aus der Evakuierung zurück in Berlin ankamen. Wir hatten die Flucht überstanden und waren zufrieden: Die Wohnung stand noch. Aber die Luftangriffe nahmen gegen Ende des Krieges immer mehr zu. Es kamen Wellen von 600–900 Bombenfliegern! Im Radio hörten wir ständig: »Hier ist der deutsche Rundfunk. Feindliche Fliegerverbände im Raum Hannover–Braunschweig.« Dann wussten wir, dass es auf Berlin gehen würde. Schon bald gingen dann die Sirenen auf den Häuserdächern los und alles flüchtete in die Keller. Dort hatten Baufirmen Holzpfeiler eingebaut und Querbalken eingesetzt, damit die Kellerdecke bei einem Angriff nicht einstürzen würde. Wir kamen gar nicht mehr aus den Sachen raus, trauten uns nicht, uns abends auszuziehen. Ich zog bloß den Mantel aus und legte mich so aufs Bett. Wenn die Mutter nachts um zwei zu mir sagte: »Junge, komm, aufstehen, wir müssen wieder runter gehen!«, zog ich nur den Mantel an und rannte runter. Wir wohnten vier Treppen, mussten noch über den Hof laufen und eine halbe Treppe tiefer in den Keller rein. Dort waren bestimmte Räume als Luftschutzräume gekennzeichnet.
In der Nacht kamen dann manchmal zwei oder drei Angriffe, abends um acht der erste. Die meisten Fliegerangriffe waren nachts, damit die Flak die Flieger nicht sehen konnte. Ich konnte die Scheinwerfer der Flak am Himmel sehen, die versuchte, die Flieger abzuschießen. Aber es wurden ganz wenige getroffen, die meisten Flieger konnten ihre Luftminen und Brandbomben abwerfen. Die Brandbomben waren achtkantig und im Durchmesser vielleicht fünfzehn Zentimeter. Sie schlugen nur durch die Dachziegel und blieben auf den Dachböden liegen, wo sie die Holzböden in Brand setzten und die Häuser alle von oben runterbrannten. Die Sprengbomben gingen durch. Und dann gab es noch die Luftminen. Die explodierten oberhalb des Hauses, in einer Höhe von vielleicht zwanzig, dreißig Metern. So eine Luftmine traf auch unser Haus.
Wir sitzen unten im Keller. Jeder hat seinen Platz, daneben eine Decke und ein Eimer mit Wasser. Wenn eine Bombe runterkommen würde, sollten wir uns nasse Tücher vor das Gesicht halten, um nicht den Rauch, den Staub und den Dreck einzuatmen. In jedem Haus gibt es Verantwortliche für Luftschutz, den Luftschutzwart. An diesem Tag stehen der Luftschutzwart und noch ein anderer Mann oben an der Kellertreppe, als es einen furchtbaren Knall gibt. Meine Mutter wirft sich über mich. Ich habe keine Geschwister, ich bin das einzige Kind. Alles ist aus, das Licht ist aus, alles aus … Meine Mutter presst mir ein nasses Taschentuch gegen den Mund. Ich kann nichts sehen. Unser Haus ist über uns eingestürzt, aber die eingebauten Balken und Pfosten haben die ganze Last von dem vierstöckigen Haus getragen. Im Keller ist nichts kaputtgegangen. Nach einer halben Stunde wird es ruhiger draußen, wir hören keine Einschläge mehr. Jemand sagt: »Raus aus dem Keller!«
Читать дальше