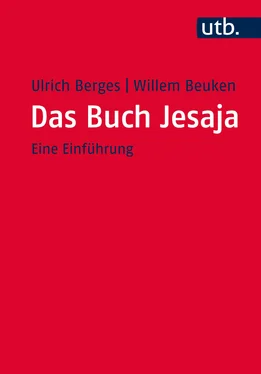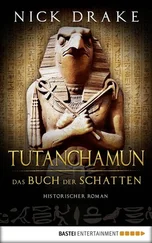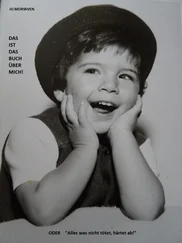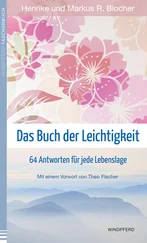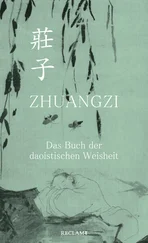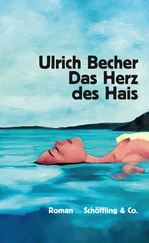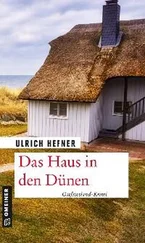Ulrich Berges - Das Buch Jesaja
Здесь есть возможность читать онлайн «Ulrich Berges - Das Buch Jesaja» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Das Buch Jesaja
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Das Buch Jesaja: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Das Buch Jesaja»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Das Buch Jesaja — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Das Buch Jesaja», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Als göttliche Attribute kommen im Jesajabuch auch  »Licht« und
»Licht« und  »Glanz«, teils mit
»Glanz«, teils mit  »Feuer« verbunden, vor (im Gerichtskontext in 4,5; 10,16–17; 26,11; 29,6; 31,9; 33,14). 103In Kap. 60 ist diese Motivik besonders präsent und dominiert die ganze literarische Einheit. Den Anstoß dazu legte schon die Ouvertüre des Buches mit dem Aufruf an das Haus Jakob, wie die Völker zum Berg Zion zu gehen und darüber hinaus »im Licht JHWHs« zu wandeln (2,1–5). In 60,1–3 ist dies weiter ausgestaltet, denn Jerusalem selbst wird zur Lichtträgerin ob der vorherigen Ankunft der »Herrlichkeit JHWHs«. Die Völker machen sich dann auf den Weg und bringen der Mutter Zion ihre verstreuten Kinder zurück (V. 4–9). Das Thema erreicht seinen Höhepunkt in der Verheißung, JHWH werde mit all seiner Herrlichkeit das Licht der Sonne und des Mondes ersetzen (60,19–20).
»Feuer« verbunden, vor (im Gerichtskontext in 4,5; 10,16–17; 26,11; 29,6; 31,9; 33,14). 103In Kap. 60 ist diese Motivik besonders präsent und dominiert die ganze literarische Einheit. Den Anstoß dazu legte schon die Ouvertüre des Buches mit dem Aufruf an das Haus Jakob, wie die Völker zum Berg Zion zu gehen und darüber hinaus »im Licht JHWHs« zu wandeln (2,1–5). In 60,1–3 ist dies weiter ausgestaltet, denn Jerusalem selbst wird zur Lichtträgerin ob der vorherigen Ankunft der »Herrlichkeit JHWHs«. Die Völker machen sich dann auf den Weg und bringen der Mutter Zion ihre verstreuten Kinder zurück (V. 4–9). Das Thema erreicht seinen Höhepunkt in der Verheißung, JHWH werde mit all seiner Herrlichkeit das Licht der Sonne und des Mondes ersetzen (60,19–20).
Mit dem Gottestitel  »Vater« wird JHWH im Bekenntnis von 63,16; 64,7 direkt angesprochen. So ausdrücklich kommt dies im Jesajabuch nur hier vor, auch wenn die Vorstellung von Gott als Vater dem Buch insgesamt nicht fremd ist: »Kinder habe ich aufgezogen […] sie aber haben mit mir gebrochen« (1,2); »Es ist ein widerspenstiges Volk, verlogene Kinder« (30,9). Trotz allem hält JHWH an seiner elterlichen Fürsorgepflicht und seinem Erziehungsrecht fest: »Bring meine Söhne/meine Töchter zurück […] Ich habe sie zu meiner Ehre geschaffen, gebildet, gemacht« (43,6–7). Das prophetische Wehe von 45,9 weist in dieselbe Richtung: »Wehe dem, der zum Vater sagt: ›Was zeugst du?‹«. Das Bekenntnis zu JHWH als Vater in 63,16; 64,7 bildet auch keine Ausnahme im alttestamentlichen Zeugnis, sondern ist im gesamten AT breit belegt (Ex 4,22–23; Dtn 1,31; 8,5; 32,6.18; Jer 3,4.19; 31,9; Hos 11,1–3; Mal 1,6; Ps 103,13). Die Vorstellung hat Anteil an der allgemeinen altorientalischen Konzeption der Götterwelt. Die Metapher des »[Ur-]Vaters« dient dabei zur Erklärung unterschiedlicher Dimensionen dieser vorgestellten Wirklichkeit: das Beziehungsgefüge innerhalb eines Pantheons, die Entstehung des Kosmos, die Herrschaft des Königs als Platzhalter der Götter, die soziale hierarchische Ordnung und sogar die Möglichkeit einer Existenz nach dem Tod. 104Das Bekenntnis zu JHWH als Vater in 63,16; 64,7 nimmt insofern einen besonderen Platz ein, als es dort in Konkurrenz zum Verhältnis des Gottesvolkes zu seinen Erzvätern steht: »Abraham hat nichts von uns gewusst, und Israel kennt uns nicht« (63,16). Doch bedeutet dies keine Abkehr von den eigenen Traditionen (vgl. 45,10; 51,2; 58,14), denn JHWHs Vaterschaft wird mit zwei weiteren Elementen ausgestaltet: »Du bist unser Erlöser seit uralten Zeiten« (63,16) und »Du bist unser Bildner, wir alle sind das Werk deiner Hände« (64,7; vgl. 45,10). Die Metapher der Vaterschaft betont – besonders aus Sicht der Kinder – den Aspekt der Einzigkeit, denn ein Kind kann nur immer einen leiblichen Vater haben (wie auch nur eine leibliche Mutter). Der Vatertitel fügt genau diesen Aspekt der Einzigkeit den Epitheta wie »Erlöser« und »Bildner« hinzu.
»Vater« wird JHWH im Bekenntnis von 63,16; 64,7 direkt angesprochen. So ausdrücklich kommt dies im Jesajabuch nur hier vor, auch wenn die Vorstellung von Gott als Vater dem Buch insgesamt nicht fremd ist: »Kinder habe ich aufgezogen […] sie aber haben mit mir gebrochen« (1,2); »Es ist ein widerspenstiges Volk, verlogene Kinder« (30,9). Trotz allem hält JHWH an seiner elterlichen Fürsorgepflicht und seinem Erziehungsrecht fest: »Bring meine Söhne/meine Töchter zurück […] Ich habe sie zu meiner Ehre geschaffen, gebildet, gemacht« (43,6–7). Das prophetische Wehe von 45,9 weist in dieselbe Richtung: »Wehe dem, der zum Vater sagt: ›Was zeugst du?‹«. Das Bekenntnis zu JHWH als Vater in 63,16; 64,7 bildet auch keine Ausnahme im alttestamentlichen Zeugnis, sondern ist im gesamten AT breit belegt (Ex 4,22–23; Dtn 1,31; 8,5; 32,6.18; Jer 3,4.19; 31,9; Hos 11,1–3; Mal 1,6; Ps 103,13). Die Vorstellung hat Anteil an der allgemeinen altorientalischen Konzeption der Götterwelt. Die Metapher des »[Ur-]Vaters« dient dabei zur Erklärung unterschiedlicher Dimensionen dieser vorgestellten Wirklichkeit: das Beziehungsgefüge innerhalb eines Pantheons, die Entstehung des Kosmos, die Herrschaft des Königs als Platzhalter der Götter, die soziale hierarchische Ordnung und sogar die Möglichkeit einer Existenz nach dem Tod. 104Das Bekenntnis zu JHWH als Vater in 63,16; 64,7 nimmt insofern einen besonderen Platz ein, als es dort in Konkurrenz zum Verhältnis des Gottesvolkes zu seinen Erzvätern steht: »Abraham hat nichts von uns gewusst, und Israel kennt uns nicht« (63,16). Doch bedeutet dies keine Abkehr von den eigenen Traditionen (vgl. 45,10; 51,2; 58,14), denn JHWHs Vaterschaft wird mit zwei weiteren Elementen ausgestaltet: »Du bist unser Erlöser seit uralten Zeiten« (63,16) und »Du bist unser Bildner, wir alle sind das Werk deiner Hände« (64,7; vgl. 45,10). Die Metapher der Vaterschaft betont – besonders aus Sicht der Kinder – den Aspekt der Einzigkeit, denn ein Kind kann nur immer einen leiblichen Vater haben (wie auch nur eine leibliche Mutter). Der Vatertitel fügt genau diesen Aspekt der Einzigkeit den Epitheta wie »Erlöser« und »Bildner« hinzu.
7.3Rückblick und Fazit
Eine beschreibende Inventarisierung der Epitheta und Gottes-Metaphern im Buch Jesaja hat nur dann und insofern ihren Auftrag erfüllt, wenn sie der individuellen Lektüre und dem eigenen Verständnis dieser prophetischen Schrift dient. Das exegetisch-bibeltheologische Wissen um die Tätigkeit von Schülerkreisen, Tradenten und Schreibergilden im Laufe der Jahrhunderte soll die persönliche Wahrnehmung dabei bereichern. Das subjektive Erleben im Lesevorgang stellt keinen Mangel dar, sondern ist die notwendige Voraussetzung für eine persönliche Auseinandersetzung mit der Vision, die das Jesajabuch entfaltet.
Eine Theologie des Buches Jesaja, die den Gottestiteln und göttlichen Attributen nachgeht, kann nicht statisch sein, weil Israel seine Erfahrungen mit JHWH im Laufe der turbulenten Geschichte, die das Buch abbildet, immer wieder neu ausrichtete und anpasste. JHWH ist nicht nur im Buch Jesaja, sondern in der Bibel überhaupt sowohl ein Gott im Wandel als auch ein Gott des Wandels. 105Aus historischer Sicht könnte man sich möglicherweise wünschen, das Jesajabuch böte eine geradlinige Entwicklung seiner Gottesbilder, vom ersten Auftreten des Propheten in assyrischer Zeit bis zu den Problemen der nachexilischen Tempelgemeinde in der persischen Periode. Das ist aber nicht der Fall. Der Prophet spricht von zwei Brennpunkten aus: Das Heute ist für ihn die Frucht der Vergangenheit und zugleich die Saat für die Zukunft. Weil dem so ist, präsentiert das Buch Jesaja JHWH trotz aller geschichtlichen Umbrüche als mit sich selbst eins bleibend. So ist es auch möglich, dass die Gotteserfahrung aus einer Periode (assyrisch, babylonisch, persisch) auch für die anderen Zeiten gilt. Mit anderen Worten: einige Namen und Epitheta JHWHs überspannen das ganze Buch, teils mit Bedeutungsverschiebungen, andere Begriffe bleiben auf einige Buchteile beschränkt. Insgesamt ergeben sie ein dynamisches Gottesbild desjenigen, der von sich sagt: »Ich, JHWH, bin der Erste, und noch bei den Letzten bin ich derselbe« (41,4b).
____________
1Einen guten Überblick bietet HöFFKEN 2004.
2BERGES 2006, S. 190.
3MUILENBURG 1956, S. 381–773; J. BECKER 1968; MELUGIN 1976; 1997 und 2008.
4RENDTORFF 1984; WATTS 1985; 1987.
5BRUEGGEMANN 1998a; 1998b; CHILDS 2001; BLENKINSOPP 2000; 2002 und 2003.
6RENDTORFF 1984, S. 295.
7STECK 1996, S. 7.
8BERGES 1998, S. 535ff.
9So OSWALT 1998, S. 25; vgl. auch MOTYER 1993; sowie ALLIS 1950; YOUNG 1954; LESSING 2011. Diese Kommentare bieten trotz der Einheitsthese durchaus wichtige Detailbeobachtungen zur Sprache, Motivik und Theologie des Jesajabuches.
10OSWALT 1998, S. 6.
11Dazu sehr informativ MOSER 2012.
12DöDERLEIN 1781, S. 832; zitiert nach VINCENT 1977, S. 17.
13MOSER 2012, S. 89–96.
14Siehe DUHM 1916, S. 291f.
15CASPARI 1934, S. 244.
16HERMISSON 2003 und die weiteren bisher erschienen Faszikel.
17Vgl. ALBERTZ 2001, S. 283–286; DIETRICH u.a. (Hg.) 2014, S. 305f.319f.
18KRATZ 2003, S. 98; LEVIN 2003, S. 85; GERSTENBERGER 2005, S. 248.
19Vgl. KRATZ 1991; VAN OORSCHOT 1993; WERLITZ 1999.
20ELLIGER 1933. Derzeit geht man bei »Tritojesaja« fast einstimmig von schriftgelehrter Prophetie aus; vgl. LAU 1994; GäRTNER 2006.
21MICHEL 1981, S. 250; siehe DERS. 1977; neu abgedruckt in DERS. 1997; auch COGGINS 1998, S. 91.
22Aus Sorge vor Missverständnissen veröffentlichte D. Michel seine Gedanken erst Jahre später: »Ich habe weitere zehn Jahre mit der Veröffentlichung gewartet, weil mir aus zahlreichen Gesprächen deutlich geworden war, wie leicht meine Argumente unter der vorherrschenden Annahme einer prophetischen Persönlichkeit ›Deuterojesaja‹ missverstanden werden können.« (MICHEL 1997, S. 199, Anm. 1).
23J. BECKER 1968, S. 38.
24So verurteilte die Päpstliche Bibelkommission im Jahre 1908 die Ansicht, das Buch Jesaja sei wegen des exilischen Ursprungs der Kapitel 40–66 nicht gänzlich auf den Propheten zurückzuführen (ASS 41 [1908], S. 613).
25GOLDSCHMIDT 1996, S. 56. Die Schreibweise einiger biblischer Eigennamen wird hier vereinfacht wiedergegeben.
26EATON 1982.
27SCHMITT 1979 und 2005, S. 322.
28ALBERTZ 2001.
29Vgl. SCHMID 2006, S. 328, der hinter den kleinen Einheiten in Jes 40–55 ursprünglich mündliche Verkündigung vermutet: »Man darf deshalb nach wie vor mit einem Propheten ›Deuterojesaja‹ hinter Kap. 40ff. rechnen, auch wenn wir seinen Namen nicht kennen.«
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Das Buch Jesaja»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Das Buch Jesaja» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Das Buch Jesaja» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.