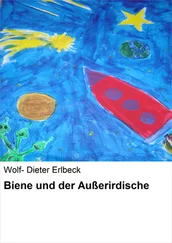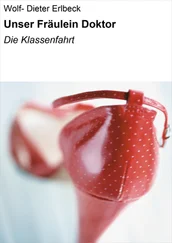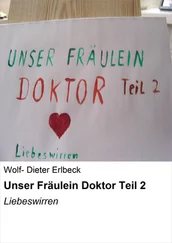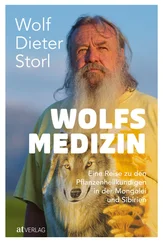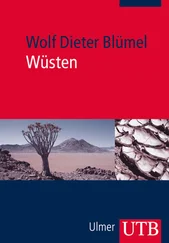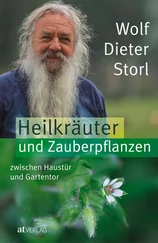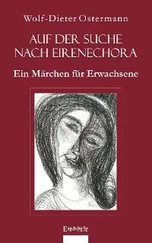Rational Choice-Ansätze gehen also von rationalen Erwartungen der Akteure aus und führen Entwicklungen wie beispielsweise den vielfach beklagten Bürokratisierungsprozess auf Entscheidungen dieser Akteure zurück. Will man entsprechende Prozesse erklären, müsste man – folgt man der »Forschungsanleitung« des Rational Choice-Ansatzes – die Vorlieben und Ziele sowie die daraus resultierenden Entscheidungen der beteiligten Akteure analysieren.
Akteurzentrierter Institutionalismus
Einen anderen »Bauplan« für Forschungsanstrengungen gibt der akteurzentrierte Institutionalismus an die Hand. Er sagt, dass nicht nur die Akteure betrachtet werden sollen, sondern auch die Institutionen, die diese umgeben. Auch wird nicht davon ausgegangen, dass Akteure stets rational handeln; es wird auch nicht so getan, als ob sie dies täten. Vielmehr werden beispielsweise die Handlungsorientierungen (z. B. Wohlstand, Reputation oder Nächstenliebe) der Akteure betrachtet und es wird berücksichtigt, dass diese nur über begrenzte Kapazitäten der Informationsverarbeitung verfügen. Dabei interessieren insbesondere die aus Einzelakteuren zusammengesetzten Akteure (z. B. Verbände und Unternehmen), denn sie verfügen über verhältnismäßig großen Einfluss auf Politikprozesse und damit auch auf das Ergebnis politischer Auseinandersetzungen.
Wie schon erwähnt, werden neben diesen Akteuren auch Institutionen in die Analyse einbezogen. Dabei wird ein weiter Institutionenbegriff zugrunde gelegt. Es werden nicht nur die Institutionen wie der Bundestag, der Bundesrat und das Bundesverfassungsgericht mit den jeweils geltenden Verfahrensregeln (etwa: was schreibt das Grundgesetz über den Gesetzgebungsprozess vor?) betrachtet. Vielmehr interessieren auch die vielen formellen und informellen Regeln, die helfen, Verhalten zu erklären oder vorherzusagen. Dazu gehört das Demonstrationsrecht genauso wie beispielsweise der Umstand, dass im Bundestag im Rahmen der Aussprache über den Haushalt des Bundeskanzleramts immer auch eine Generaldebatte über die Politik der jeweiligen Bundesregierung stattfindet.
In welchem Verhältnis stehen Akteure und Institutionen im akteurzentrierten Institutionalismus zueinander? In einer eher kurzfristigen Betrachtung muss man davon ausgehen, dass Akteure innerhalb eines gegebenen institutionellen Kontextes handeln. Die Institutionen können das Handeln der Akteure fördern, aber auch hemmen und kanalisieren. Ist beispielsweise für die Verabschiedung eines Gesetzes die Zustimmung des Bundesrats erforderlich und besitzen die Parteien, die die Bundesregierung tragen, nicht die erforderliche Mehrheit im Bundesrat, ist die Bundesregierung in ihrer politischen Gestaltungsfähigkeit beschränkt. Auch wenn Institutionen als kurzfristig nicht veränderbar betrachtet werden müssen, können sie doch in einer mittel- und längerfristigen Perspektive auch selbst Gegenstand der politischen Auseinandersetzung mit dem Ziel einer Veränderung werden. Ein gutes Beispiel hierfür sind die Bemühungen um die Reform des deutschen Föderalismus (→ vgl. Kapitel 3.5.3).
Leistungen von Forschungsheuristiken
Welche Leistungen erbringen Forschungsheuristiken wie der Rational Choice-Ansatz und der akteurzentrierte Institutionalismus für den Forschungsprozess? Sie leiten diesen an. Sie sagen, auf welche Faktoren insbesondere zu achten ist. Allerdings erschließt sich aus dem Hinweis, dass im Wesentlichen Akteure (Rational Choice-Ansatz) bzw. Akteure und Institutionen (akteurzentrierter Institutionalismus) wichtig sind, noch kein genauer Bauplan für die eigene Forschung. Konkrete systematisierende Anleitungen müssen erst aus der jeweiligen Fragestellung entwickelt werden. Möchte man beispielsweise wissen, wie verschiedene Formen des Föderalismus (→ vgl. Kapitel 3.5) auf die Reformfähigkeit eines Nationalstaats wirken, leitet sich daraus ab, welche institutionellen Vorgaben genauer zu betrachten sind. Dies können beispielsweise die Regeln sein, aus denen sich das Ausmaß der Beteiligung der Länder an der Gesetzgebung des Bundes ergibt. Wichtig ist auch die Eigenständigkeit der Länder, die sich z. B. anhand der Gesetzgebungskompetenzen und dem Ausmaß ihrer Finanzhoheit ablesen lässt.
Neben den institutionellen Gegebenheiten wirken jedoch auch andere Faktoren auf die Reformfähigkeit eines Nationalstaats. Folgt man dem akteurzentrierten Institutionalismus, sind auch die wichtigen Akteure zu betrachten. Damit gelangen die Verbände ins Blickfeld und ihre Fähigkeit, den politischen Prozess zu beeinflussen (→ vgl. Kapitel 3.1). Wichtig für die Reformfähigkeit dürfte auch das Parteiensystem sein und die Chance, stabile Mehrheiten im Parlament zu organisieren (→ vgl. Kapitel 3.2). Von Interesse könnte zudem die Weltmarktoffenheit sein. Im jeweiligen Forschungsdesign (= Plan für eine systematische empirische Forschung) müssten diese verschiedenen, als relevant herausgearbeiteten Variablen berücksichtigt werden. Wie dieses Forschungsdesign im Einzelnen zu gestalten ist, wird in entsprechenden Methoden-Lehrveranstaltungen und Lehrbüchern vermittelt.
Zusammenfassung
Was leisten Forschungsheuristiken?
Eine Forschungsheuristik hilft, die jeweils relevanten Variablen zu ermitteln. Sie weist den Forschungsprozess in die »richtige« Richtung. Die tatsächlich erklärungskräftigen Variablen ergeben sich aus der Forschungsfrage. Sie können nicht ohne Vorkenntnisse, die aus der einschlägigen Literatur gewonnen werden müssen, benannt werden. Das konkrete Forschungsdesign schließlich legt fest, wie die Untersuchungsfälle auszuwählen sind.
Lernkontrollfragen
| 1 |
Was unterscheidet die Politikwissenschaft von einem Alltagsverständnis von Politik? |
| 2 |
Welche zentralen Aspekte geben die klassischen Politikbegriffe vor und was folgt aus diesen für die konkrete Forschung? |
| 3 |
Welche Ausdifferenzierung hat der empirisch-analytische Politikbegriff gefunden? |
| 4 |
Nennen Sie bitte Beispiele für eine Beschreibung, eine Erklärung und eine Prognose. |
| 5 |
Erfüllt Ihrer Meinung nach die Unterscheidung von Polity, Policy und Politics die Kriterien für eine sinnvolle Kategorisierung? (Diskussionsfrage; gut geeignet für Arbeitsgruppen.) |
| 6 |
Welche Funktion erfüllen Forschungsheuristiken? Verdeutlichen Sie dies anhand von Beispielen. |
Literatur
Alemann, Ulrich von/Forndran, Erhard (2005), Methodik der Politikwissenschaft, 7. Auflage, Stuttgart.
Eingeführtes Lehrbuch zur Methodik der Politikwissenschaft, in dem neben vielen praktischen Fragen (Arbeitstechniken, Aufstellung eines Forschungsplans, Arten der Erhebung von Daten usw.) auch die klassischen Politikbegriffe behandelt werden.
Behnke, Joachim/Baur, Nina/Behnke, Natalie (2010), Empirische Methoden der Politikwissenschaft, 2. Auflage, Paderborn u.a. Systematisch aufgebautes Methodenlehrbuch, das ausgeprägt mit politikwissenschaftlichen Beispielen arbeitet.
Böhret, Carl/Jann, Werner/Kronenwett, Eva (1988), Innenpolitik und politische Theorie, 3. Auflage, Opladen, insbesondere S. 1–12. Immer noch äußerst lohnendes Lehrbuch, in dem auf den hier interessierenden ersten Seiten die unterschiedlichen Politikbegriffe sehr schön verdeutlicht werden.
Braun, Dietmar (1999), Theorien rationalen Handelns in der Politikwissenschaft. Eine kritische Einführung, Opladen.
Lehrbuch, das in einen wichtigen Theoriebereich der Politikwissenschaft einführt. Es werden sowohl die Grundlagen der ökonomischen Theorie der Politik als auch Anwendungen in einzelnen Teilbereichen dargestellt.
Frantz, Christiane/Schubert, Klaus (Hrsg.) (2010), Einführung in die Politikwissenschaft, 2. Auflage, Münster.
Amerikanischen »Textbooks« nachempfundenes, großformatiges Lehrbuch, das in seinem Aufbau den drei Dimensionen des wissenschaftlichen Politikbegriffs folgt. Der Band ist mit seinen zahlreichen Karikaturen, Grafiken und Fotos sehr anschaulich.
Читать дальше