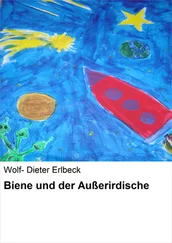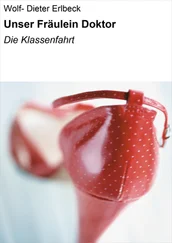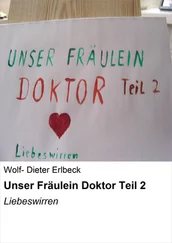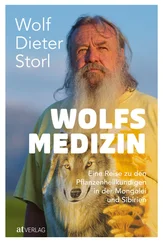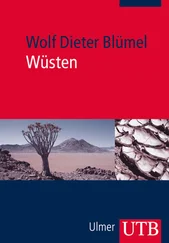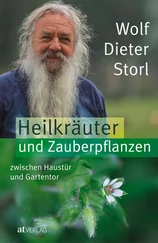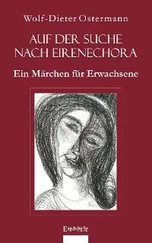|
|
3.1.5.1 |
Pluralismus und Neo-Pluralismus |
|
|
3.1.5.2 |
Neokorporatismus |
|
3.1.6 |
Neuere Entwicklungen: Vom Korporatismus zum Lobbyismus? |
| 3.2 |
Parteien und Parteiensystem |
|
3.2.1 |
Funktionen und Aufgaben von Parteien |
|
3.2.2 |
Parteienfinanzierung |
|
3.2.3 |
Parteienstaatsthese |
|
|
3.2.3.1 |
Die These: Inhalt und Kritik |
|
|
3.2.3.2 |
Indikatoren zur Überprüfung der Parteienstaatsthese |
|
|
3.2.3.3 |
Empirische Überprüfung der Parteienstaatsthese am Beispiel der zweiten Regierung Schröder |
|
|
3.2.3.4 |
Schlussfolgerungen |
|
3.2.4 |
Das Parteiensystem in Deutschland |
| 3.3 |
Parlament |
|
3.3.1 |
Der Bundesrat in der Gesetzgebung |
|
3.3.2 |
Der Deutsche Bundestag |
|
3.3.3 |
Die Wahl zum Deutschen Bundestag |
|
3.3.4 |
Der innere Aufbau des Deutschen Bundestags |
|
3.3.5 |
Die Funktionen des Deutschen Bundestags |
|
|
3.3.5.1 |
Wahfunktion |
|
|
3.3.5.2 |
Gesetzgebungsfunktion |
|
|
3.3.5.3 |
Kontrolfunktion |
| 3.4 |
Regierung |
|
3.4.1 |
Die Organisations- und Kompetenzprinzipien |
|
|
3.4.1.1 |
Das Kanzlerprinzip |
|
|
3.4.1.2 |
Das Kabinettsprinzip |
|
|
3.4.1.3 |
Das Ressortprinzip |
|
3.4.2 |
Die Ministerien |
|
|
3.4.2.1 |
Innere Organisation und Führung |
|
|
3.4.2.2 |
Aufgaben |
| 3.5 |
Föderalismus |
|
3.5.1 |
Analyse des deutschen Föderalismus |
|
|
3.5.1.1 |
Gesetzgebung und Entscheidung |
|
|
3.5.1.2 |
Verwaltung |
|
|
3.5.1.3 |
Rechtsprechung |
|
|
3.5.1.4 |
Finanzbeziehungen |
|
3.5.2 |
Der deutsche Föderalismus – verflochten oder getrennt? |
|
3.5.3 |
Föderalismusreform I – Was hat sie gebracht? |
|
3.5.4 |
Föderalismusreform II – Inhalte und Bewertung |
| 4 |
Internationale Beziehungen |
| 4.1 |
Krieg und Frieden |
|
4.1.1 |
Normative Ansätze: Visionen der Friedensschaffung und Friedenserhaltung |
|
|
4.1.1.1 |
Idealismus |
|
|
4.1.1.2 |
Realismus |
|
|
4.1.1.3 |
Marxismus |
|
|
4.1.1.4 |
Neokonservatismus |
|
4.1.2 |
Empirisch-analytische Erklärungsansätze für Krieg und Frieden |
|
|
4.1.2.1 |
Auf das internationale System der Staatenwelt bezogene Ansätze |
|
|
4.1.2.2 |
Staatszentrierte Ansätze |
|
|
4.1.2.3 |
Gesellschaftszentrierte Ansätze |
|
4.1.3 |
Neue Kriege |
| 4.2 |
Institutionalisierung internationaler Zusammenarbeit: Warum entstehen internationale Institutionen? |
|
4.2.1 |
Historische Entwicklung |
|
4.2.2 |
Parameter für die Erklärung der Institutionalisierung |
|
4.2.3 |
Machtorientierte Ansätze |
|
|
4.2.3.1 |
Strukturell-funktionalistische Machtperspektive |
|
|
4.2.3.2 |
Intentionale Machtperspektive |
|
|
4.2.3.3 |
Diskursiv-konstruktivistische Machtperspektive |
|
4.2.4 |
Liberal-gesellschaftlich orientierte Ansätze |
|
|
4.2.4.1 |
Strukturell-funktionalistische Variante der liberal-gesellschaftlichen Perspektive |
|
|
4.2.4.2 |
Intentionale Variante der liberalgesellschaftlichen Perspektive |
|
|
4.2.4.3 |
Diskursiv-konstruktivistische Variante der liberal-gesellschaftlichen Perspektive |
|
4.2.5 |
Institutionalistische Ansätze |
|
|
4.2.5.1 |
Strukturell-funktionalistische Variante der institutionalistischen Perspektive |
|
|
4.2.5.2 |
Intentionale Variante der institutionalistischen Perspektive |
|
|
4.2.5.3 |
Diskursiv-konstruktivistische Variante der institutionalistischen Perspektive |
|
4.2.6 |
Norm- und ideenorientierte Ansätze |
|
|
4.2.6.1 |
Strukturell-funktionalistische Variante der norm- und ideenorientierten Perspektive |
|
|
4.2.6.2 |
Intentionale Variante der norm- und ideenorientierten Perspektive |
|
|
4.2.6.3 |
Diskursiv-konstruktivistische Variante der norm- und ideenorientierten Perspektive |
| 4.3 |
Institutionalisierung internationaler Zusammenarbeit: Normative Konzeptionen sowie Wirkungen internationaler Institutionen |
|
4.3.1 |
Normative Konzeptionen der Institutionalisierung internationaler Politik |
|
|
4.3.1.1 |
Föderalismus |
|
|
4.3.1.2 |
Funktionalismus |
|
4.3.2 |
Wirkungen internationaler Institutionen |
|
|
4.3.2.1 |
Internationalisierung und die Handlungsfähigkeit von Nationalstaaten |
|
4.3.2.2 |
Regelbefolgung |
| 4.4 |
Governance und Mehrebenenregieren |
|
4.4.1 |
Normative Visionen des Mehrebenenregierens |
|
|
4.4.1.1 |
Weltstaat und kosmopolitisches Empire |
|
|
4.4.1.2 |
Komplexes Weltregieren |
|
|
4.4.1.3 |
Autonomieschonende Zusammenarbeit zwischen Staaten |
|
|
4.4.1.4 |
Erhalt und Schutz nationalstaatlicher Souveränität |
|
4.4.2 |
Wie lässt sich die Regierungsleistung politischer Mehrebenensysteme erklären? |
|
|
4.4.2.1 |
Macht und Herrschaft in Mehrebenensystemen |
|
|
4.4.2.2 |
Demokratische Legitimation des Regierens jenseits des Nationalstaats |
Register |
| Grundlagen der Politikwissenschaft |
1 |
Inhalt
| 1.1 |
Was heißt hier Wissenschaft? |
| 1.2 |
Was heißt hier Politik? |
| 1.3 |
Analytische Bausteine der Systemforschung |
| 1.1 |
Was heißt hier Wissenschaft? |
| 1.1.1 |
Alltagsnähe der Politik |
Politik – Politikwissenschaft
Über Politik soll und kann gerade in einer demokratischen Ordnung jeder mit gutem Recht mitreden. Sie ist eine Angelegenheit für alle und es gibt kein Wissensmonopol der Politikwissenschaft bezogen auf die Politik. Allerdings sind von den eigenen Interessen ausgehende Verzerrungen und die Unkenntnis der politischen Institutionen an der Tagesordnung. Fast alltäglich ist auch die Neigung zur häufigen und heftigen Diffamierung »der Politik« und »der Politiker« als habgierig oder inkompetent. Diese Beobachtungen verweisen auf ein eigentümliches Verhältnis der Politikwissenschaft zum politischen Reden und Handeln.
Читать дальше