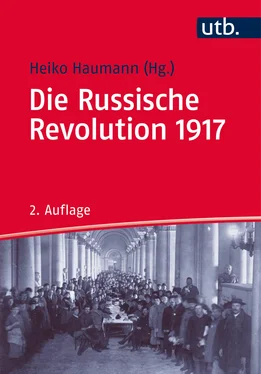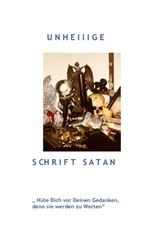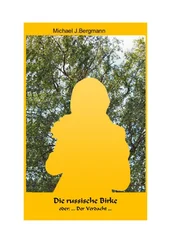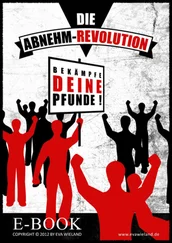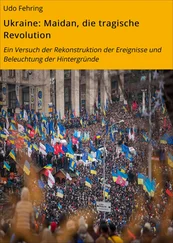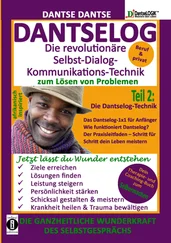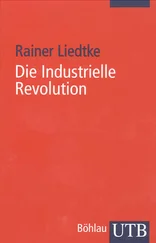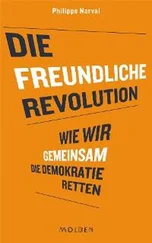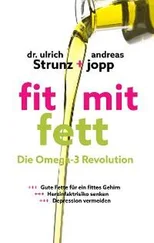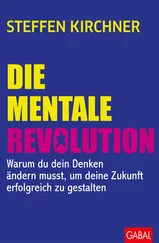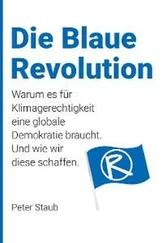Eine Reaktion darauf ist auch in Russlands Beitrag zum Völkerrecht zu sehen: Die Landkriegsordnung und die Einrichtung einer Schiedsgerichtsbarkeit, die 1899 in der Friedenskonferenz von Den Haag verabschiedet wurden, gingen nicht zuletzt auf russische Initiative zurück. Die Konzeptionen hatte der liberale Jurist Fedor F. Martens entworfen. Sie stellten einen bedeutenden Versuch dar, ein neues globales System zur Verhinderung von Kriegen und zumindest zur „Humanisierung“ der Kriegsführung zu schaffen. Eine entschiedene Abrüstung oder eine grundlegende Abwendung von einem durch militärische Stärke geprägten Denken blieben allerdings nach wie vor in weiter Ferne. Von der Einbindung in das kulturelle Weltsystem zeugten vielfältige Kontakte der Schriftsteller und Künstler, ein wachsender Austausch von Theaterkonzeptionen und Kunstausstellungen oder auch eine Internationalisierung des Sports, etwa mit der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Stockholm 1912.
Die internationale Verflechtung beeinflusste wesentlich die Wirtschaftspolitik. So gewann eine Industrialisierungskonzeption die Oberhand, die der Förderung der Produktionsmittelindustrie durch den Staat mittels Aufträgen und Heranziehung von Auslandskapital uneingeschränkten Vorrang gab, nicht zuletzt, um den Eisenbahnbau und die militärische Rüstung voranzutreiben. Dass schließlich am Vorabend des Ersten Weltkrieges rund die Hälfte der Neuinvestitionen aus dem Ausland kam, zeigt beispielhaft das Ausmaß der internationalen Verbindungen. Doch eine entschlossene und geradlinige Umsetzung der Konzeption gelang nicht. Die Richtungskämpfe zwischen „Petersburger“ und „Moskauer“ Unternehmern sowie zwischen Industriellen und Agrariern, die sich auch in Auseinandersetzungen innerhalb des Staatsapparates niederschlugen, verwässerten die entsprechenden politischen Maßnahmen. Die strukturelle Vielschichtigkeit Russlands führte zu einem „verkrüppelten Kapitalismus“.12 [<<32]
Nach der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert verschärften sich die Widersprüche und Gegensätze wegen einer für den Getreideexport ungünstigen weltwirtschaftlichen Konjunktur sowie sich zuspitzender sozialer Konflikte in Industrie und Landwirtschaft. Hinzu kamen Unruhen unter Nationalitäten und Studierenden sowie Versuche oppositioneller Bewegungen, sich insbesondere über die zemstva auch legal zu organisieren. Zusätzlichen Druck brachten außenpolitische Probleme, die mit der Expansion des Russischen Reiches in die Mandschurei zusammenhingen. Sie gipfelten 1904/05 im Krieg mit Japan. Die zarische Regierung erhoffte sich einen schnellen Sieg, um damit von den inneren Schwierigkeiten abzulenken, musste jedoch eine demütigende Niederlage hinnehmen. Dieser Prestigeverlust verstärkte die Unzufriedenheit im Land. Zudem führte der Krieg zu Versorgungsengpässen bei der Zivilbevölkerung.
Die Vereinigung der russischen Fabrikarbeiter St. Petersburg, die unter Leitung des ursprünglich regierungsfreundlichen Priesters Georgij A. Gapon stand, verlangte eine Verbesserung der materiellen Lage und mehr Mitsprachemöglichkeiten. Im Dezember 1904 streikten die Arbeiter der Putilov-Werke in St. Petersburg. Als die Betriebsleitung auf ihre Forderungen nicht einging, kam es zu einer Radikalisierung. Die Arbeiter – unterstützt von Sozialrevolutionären, Sozialdemokraten und Liberalen – beschlossen, Bittschriften zu verfassen und sie dem Zaren zu überreichen. Die zentrale Petition, die rund 150.000 Menschen unterschrieben, war in respektvollem, aber doch deutlichem Ton gehalten: „Wir, Arbeiter und Bewohner der verschiedenen Stände St. Petersburgs, unsere Frauen und Kinder und hilflosen Greise und Eltern kommen zu Dir, Herrscher, und suchen Gerechtigkeit und Schutz. Wir sind zum Bettler geworden, man unterdrückt uns, belastet uns mit unerträglicher Arbeit, man schmäht uns, man erkennt uns nicht als Menschen an, man behandelt uns als Sklaven, welche ihr bitteres Los ertragen und schweigen müssen. Wir haben geduldig ausgehalten, aber man treibt uns immer weiter in den Abgrund der Armut, der Rechtlosigkeit und der Unwissenheit, uns erstickt Despotismus und Willkür und wir ersticken. Herrscher, wir haben keine Kraft mehr. Die Grenze der Geduld ist erreicht. Für uns ist der Zeitpunkt gekommen, wo das Sterben besser ist als die Fortsetzung der unerträglichen Qualen.“ Für unbedingt notwendig hielten die Bittsteller die Erklärung der Menschenrechte, die Einberufung einer Verfassunggebenden Versammlung, die Verantwortlichkeit der Minister vor dem Volk – statt wie bisher nur vor dem Zaren –, eine Amnestie für die Verbannten, Maßnahmen zur Verbesserung des Bildungs- und Rechtswesens, des [<<33] Steuer- und Finanzsystems sowie grundlegende Änderungen in der Arbeitsverfassung, darunter die Einführung des Acht-Stunden-Tages, einen angemessenen Arbeitslohn und Mitspracherechte der Arbeiter in den Betrieben.13
Am 9. Januar 1905 zogen die Demonstranten friedlich mit ihren Bittschriften zum Winterpalais. Sie trugen Zarenbilder und Ikonen mit sich. Die Offiziere der Wachmannschaften waren jedoch angesichts der Menschenmenge überfordert und gaben den Schießbefehl. Panik entstand, weit über einhundert Tote waren zu beklagen. Dieser „Blutsonntag“, dem am 16. Januar in Warschau ein zweiter folgte, löste eine Streikwelle aus, die in eine revolutionäre Massenbewegung überging.
Bis zum Herbst 1905 weitete sich die Revolution über Russland aus. Fast alle oppositionellen Kräfte, von gemäßigten Liberalen bis zu radikalen Sozialisten, verbanden sich, um Demokratie, soziale Verbesserungen und Rechte für die nationalen Minderheiten zu erreichen. Die Bewegung gipfelte im Oktober in einem Generalstreik, den ein Rat, ein Sowjet, leitete. Drucker und Eisenbahner legten die Kommunikationsnetze des Reiches lahm und nutzten sie für ihre eigenen Zwecke. Der Zar und seine Regierung mussten mehr und mehr zurückweichen. Als der Zar jedoch mit seinem Oktobermanifest eine gesetzgebende Duma, ein Parlament, ankündigte, begann die Geschlossenheit seiner Gegner zu bröckeln. Die Arbeiterschaft, die sich vermehrt in Sowjets organisierte, kämpfte weiter und ging im Dezember in Moskau sogar zum bewaffneten Aufstand über. Dieser wurde blutig niedergeschlagen. Eine Vereinigung mit rebellierenden nationalen Gruppierungen und mit der erst jetzt erstarkenden Bauernbewegung gelang nicht. Unter Einsatz aller Gewaltmittel konnte die Regierung Schritt für Schritt wieder Herrin der Lage werden. Die verschiedenen Strömungen im „Volk“ waren nicht zusammengeflossen, und die Verbindung zur „Gesellschaft“ – zu den Gebildeten und Besitzenden – hatte sich als brüchig erwiesen. Dadurch, dass ein Teil der Liberalen auf die Seite des Zaren übergegangen war, entstanden nun sogar eine tiefe Kluft und Misstrauen gegenüber dem Verhalten der „Gesellschaft“.
Auffallend war das Verhalten vieler Soldaten. Einzelne Truppenteile stellten sich auf die Seite der Aufständischen oder meuterten und gingen später doch wieder gegen die Streikenden vor. Manchmal kam es zu mehrfachem Seitenwechsel. Offenbar waren dafür weniger politische Anschauungen ausschlaggebend, sondern die Orientierung an der jeweiligen Autorität. Dieses Schwanken deutete an, wie brüchig die an den Zaren gebundene Ordnung geworden war. [<<34]
Trotz des Scheiterns der Revolution war das Machtgefüge nicht mehr das gleiche wie vorher. Am 23. April 1906 verordnete der Zar die „Grundgesetze“, eine Verfassung, durch die ein Zweikammersystem mit dem Reichsrat als Oberhaus und der Duma als Unterhaus geschaffen wurde. Die Duma erhielt Rechte bei der Aufstellung des Staatshaushaltes und in der Gesetzgebung. Die Wahlen zur ersten Duma bescherten den Parteien, die das zarische System unterstützten, eine vernichtende Niederlage. Der Zar löste deshalb das Parlament sofort wieder auf. Als die Wahl zur zweiten Duma ein ähnliches Ergebnis brachte, entschloss sich der Zar 1907 zu einem Staatsstreich, indem er nicht nur die erneute Auflösung verfügte, sondern zugleich ein neues Wahlgesetz erließ. Dieses begünstigte die Konservativen in einer Weise, dass sie zwangsläufig die Mehrheit in den folgenden Dumas erringen mussten. Die „eingeschränkte Autokratie“ hielt sich offenbar für stark genug, sich bei Bedarf über die Verfassung hinwegzusetzen. So war die Zeit zwischen 1905 und 1917 von widersprüchlichen Tendenzen gekennzeichnet: Leichten Fortschritten bei den Mitspracherechten des Parlaments, bei der Stärkung liberaler Elemente und bei der Politisierung der Bevölkerung standen Versuche entgegen, diese Entwicklung zu blockieren und den früheren Zustand wiederherzustellen.
Читать дальше