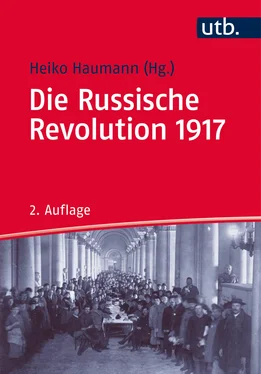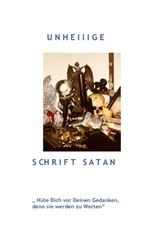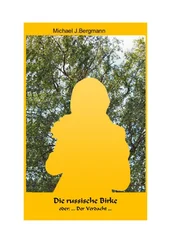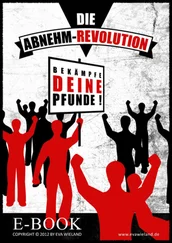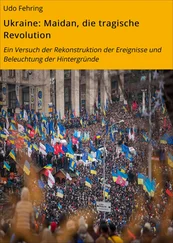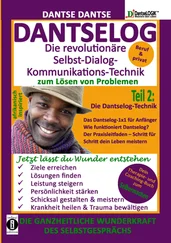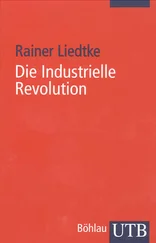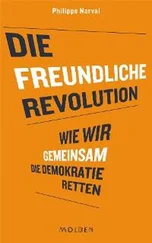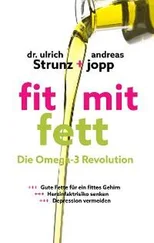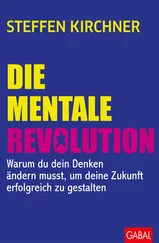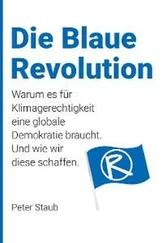Nachdem der Schock über den Verlauf der Revolution von 1905 überwunden war, verbreitete sich in weiten Kreisen der Bevölkerung durchaus eine Aufbruchstimmung. Immer mehr Menschen waren bereit, sich zu engagieren, für Reformschritte zu kämpfen, der Autokratie weitere Zugeständnisse abzuringen, ohne sich durch Unterdrückungsmaßnahmen einschüchtern zu lassen. Was sich schon im 19. Jahrhundert in vielen Städten und Regionen gezeigt hatte, setzte sich nun in zunehmendem Maße fort. Vereine, Gesellschaften und Klubs schossen überall aus dem Boden und vernetzten sich vielfach. Menschen aus unterschiedlichen Schichten ergriffen die Initiative, um benachteiligten sozialen Gruppen zu helfen, Missstände in der Gesellschaft zu beseitigen, Analphabetentum, Alkoholismus und Kriminalität zu bekämpfen. Universitätsprofessoren stellten sich mutig und selbstbewusst staatlichen Aktionen gegen aufbegehrende Studierende entgegen. Juristen und Ingenieure bildeten Fachorganisationen, die Pläne für die Zukunft erörterten, und verstanden sich als Teil der internationalen Gemeinschaft. Die russische Kultur erreichte in vielen Bereichen eine neue Blüte. Innerhalb der intelligencija kam es zu einer intensiven Diskussion über die Perspektiven des Landes und über das eigene Verhalten, entweder die Revolution zu unterstützen oder den Wandel über eine Erneuerung von innen her zu suchen. Strömungen einer religiösen Sinnsuche wurden spürbar, in denen sich manchmal messianistische mit sozialistischen Ideen verbanden und die selbst innerhalb der orthodoxen Kirche Resonanz fanden. Ein breitgefächertes Parteiensystem bildete sich aus. Es enthielt alle [<<35] Schattierungen von reaktionären, nationalistischen und antisemitischen Gruppierungen bis hin zu aufstandsbereiten Sozialisten. Durch die Diskussionen in der Duma wie in der Öffentlichkeit – es herrschte eine beschränkte Pressefreiheit – differenzierten sich die Parteien in verschiedene Fraktionen oder gar Abspaltungen.
In der Regierung und im Staatsapparat blieben die öffentlichen Aktivitäten durchaus nicht ohne Resonanz. Reformanregungen wurden hin und wieder aufgegriffen. Auch des drängendsten Problems, der Agrarfrage, nahm sich die Regierung an. Mit mehreren Gesetzen versuchte sie seit Ende 1906, eine wirtschaftlich kräftige bäuerliche Oberschicht zu schaffen, den Einfluss der obščina zu mindern sowie die überschüssige Dorfbevölkerung nach Sibirien und Zentralasien umzusiedeln, soweit sie nicht Arbeit in der Industrie fand. Erfolge waren nicht zu übersehen, erfüllten aber bis zum Ersten Weltkrieg noch nicht die Erwartungen. Zudem zeigten sich neue Probleme: Die nach Osten wandernden Kolonisten gerieten in Konflikte mit den Einheimischen, und der industrielle Aufschwung vollzog sich, trotz einer gewaltigen Dynamik seit 1908, nicht schnell genug, um eine Beschäftigung größerer Massen von Arbeitskräften aus den Dörfern zu ermöglichen. Weitergehende Maßnahmen scheiterten ohnehin am Widerstand beharrender Kräfte.
In vielen Bereichen kam es nach der Niederschlagung der Revolution sogar zu einer Gegenbewegung der Konservativen, die Reformen – etwa in der Arbeitergesetzgebung – wieder rückgängig machten. In der Wirtschaftspolitik verstärkte sich der Zickzackkurs zwischen den verschiedenen Interessen der Industriellen und Agrarier. Beide standen zwar in einem Bündnis mit dem Staat, um das System gegen eine neue Revolution zu sichern. Doch zugleich blockierten sie sich gegenseitig, wie es sich auch in anderen Politikfeldern offenbarte. Außenpolitische Konzeptionen schwankten zwischen einer aggressiven Vertretung der Großmachtrolle und einer friedensbewahrenden Politik, um alle Kraft den innenpolitischen Problemen zuwenden zu können. Intrigen am Hof und Einflüsse solcher Persönlichkeiten wie des „Wundertäters“ Grigorij E. Rasputin, der die Bluterkrankheit des Thronfolgers zu heilen versprach, prägten das Bild der Staatsspitze. Die Handlungsfähigkeit der Regierung nahm zusehends ab. Zugleich radikalisierten sich die Gegner des Systems. Die neu in die Städte zuwandernden „Bauern-Arbeiter“ gingen mehr und mehr auf die Seite der Revolutionäre über. 1912 setzten umfangreiche Streiks ein. Die Wellen von Unruhen, Arbeitsniederlegungen und Protestdemonstrationen erreichten 1913 einen bisher nicht gekannten Höhepunkt und rissen bis 1914 nicht mehr ab.
Der Erste Weltkrieg unterbrach ab August 1914 diesen neuen Aufschwung der Arbeiterbewegung. Die russische Führung war in ihrer Haltung zunächst nicht einheitlich gewesen. Doch schließlich hatte sich die Kriegspartei durchgesetzt. Sie wollte [<<36] Serbien in seinem Konflikt mit Österreich-Ungarn nicht im Stich lassen, aber auch die Position Russlands im internationalen Kräftefeld verbessern. Mit seinen Alliierten Frankreich und Großbritannien stand Russland nun gegen die „Mittelmächte“ Österreich-Ungarn und Deutschland. Weite Kreise der Bevölkerung hofften in patriotischer Begeisterung, dass Russland rasch siegen und als wichtigstes Kriegsziel die freie Durchfahrt durch die Dardanellen erreichen werde. Vernichtende Niederlagen in der Anfangsphase, namentlich gegen die deutschen Truppen in Ostpreußen, und dann die hohen Opferzahlen sowie die lange Kriegsdauer verschlechterten jedoch die Stimmung bei den Soldaten wie in der Zivilbevölkerung. 1916 stabilisierte sich zwar die militärische Lage. Dennoch kam es nicht zu einem Umschwung in der öffentlichen Meinung. Stattdessen wuchs die Entfremdung vom Zaren, der 1915 den Oberbefehl über die russischen Truppen übernommen hatte, und von der politischen Ordnung, die er repräsentierte.
Abb 13 Auf dieser in Frankreich gedruckten Ansichtskarte präsentiert sich Zar Nikolaj II. als Feldherr von Gottes Gnaden. Die Aufnahme entstand vermutlich in seinem Hauptquartier bei Mogilev im September 1915: Als Oberbefehlshaber schwört er mit einer kleinen Ikone in seiner rechten Hand kniende Soldaten auf den Krieg ein. Fotograf unbekannt. [Bildnachweis]

Die schon zuvor erkennbaren Tendenzen verschärften sich. Nach wie vor verstand die Wirtschaftspolitik die wirtschaftlichen Möglichkeiten des Landes nicht zu nutzen. Die Rüstungsproduktion blieb zumindest bis 1916 weit hinter den Anforderungen zurück, die der „industrielle Krieg“ mit seinem Schwergewicht auf Technik und Material stellte.14 Dass sie sich dann stabilisierte, ging auf Kosten derjenigen Branchen, die Güter für die Zivilbevölkerung herstellten. Aufgrund der Überlastung brach die Wirtschaft, von wenigen Bereichen abgesehen, 1917 zusammen. Auch die Lebensmittelversorgung wurde immer schlechter. Der Mangel an Arbeitskräften auf dem Land wirkte sich nachteilig aus, mehr jedoch das planlose Regierungshandeln. Weder eine schwankende Preispolitik, die die Interessen der Gutsbesitzer begünstigte und zu Spekulation und Engpässen führte, noch eine kaum zu verwirklichende Zwangsablieferung von Getreide, wie sie im Dezember 1916 verkündet wurde, konnten Abhilfe schaffen.
Abb 14 Auch Frauen sollen „alles für den Krieg“ geben, wie die Losung dieser Postkarte lautet. Zugleich enthält sie die Aufforderung, die Kriegsanleihe zu 5 ½ Prozent Zinsen zu zeichnen. Illustrator unbekannt. [Bildnachweis]

Eine wirksame Lenkung der Kriegswirtschaft gelang nicht: Regierung, Unternehmer und Agrarier schafften es weder allein noch zusammen, eine planmäßige Organisation aufzubauen. Stattdessen verstärkten sich die gegenseitigen Blockaden. Privatinteressen von Unternehmern und Agrariern hatten hohen Einfluss. Ökonomische Möglichkeiten und politische Organisationskraft kamen immer weniger zur Deckung. Schwerwiegende Folgen sollte es haben, dass sich eine beträchtliche Zahl „Moskauer“ Unternehmer, die in politischer Opposition zum Zarismus gestanden hatten, wirtschaftlich integrieren ließ, um höhere Profite zu erzielen. Dieser Übergang eines weiteren Teils [<<37] der „Gesellschaft“ auf die Seite des Zaren erschütterte nicht nur das Vertrauen in die Glaubwürdigkeit und Standfestigkeit dieser Unternehmer, sondern vertiefte die Kluft zum „Volk“. Das System war in eine Sackgasse geraten.
Читать дальше