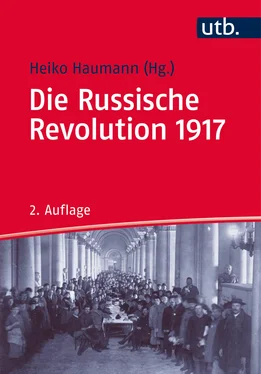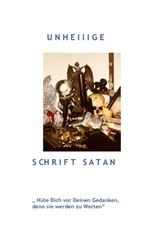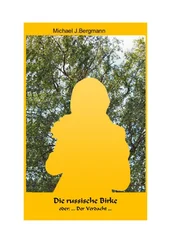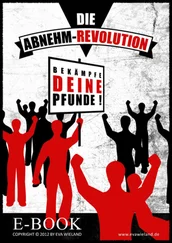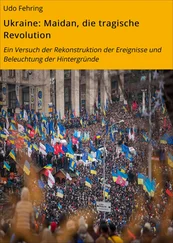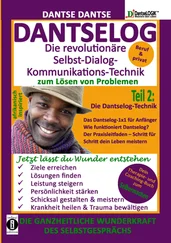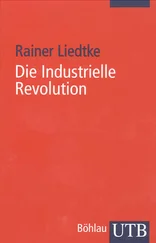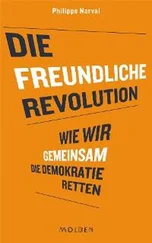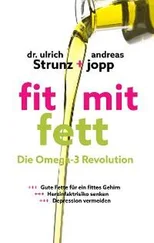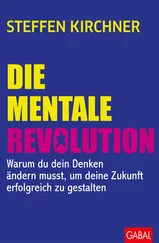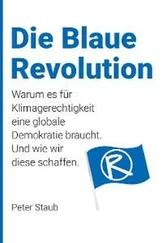Für viele Menschen in Russland bildete die Revolution zunächst einmal keinen besonderen Einschnitt – das Ernteergebnis oder die Hochzeit waren viel wichtiger. Zahlreiche Beamte und Fachleute arbeiteten in ihren Ämtern, Unternehmen und sonstigen Einrichtungen auch unter den neuen Vorgesetzten weiter, früher entworfene Projekte und Pläne wurden nach wie vor erörtert und teilweise verwirklicht. Die beschleunigte Industrialisierung, die durchgängige Kollektivierung und die Diktatur Iosif V. Stalins seit Ende der 1920er-Jahre verwandelten das Land tiefgreifender als die Revolution von 1917. Trotzdem bedeutete diese einen Bruch, für Russland wie für die Welt.
Die Autorinnen und Autoren dieses Buches haben sich zum Ziel gesetzt, die Kapitel gut lesbar und spannend zu schreiben. Obwohl der Umfang zum Verzicht auf zahlreiche Einzelheiten zwingt, sollen die Vorgänge so nachgezeichnet werden, dass sich die Leserinnen und Leser ein eigenes Urteil bilden können. Die Autorinnen und Autoren wollen deutlich machen, dass eine Vielfalt von Sichtweisen möglich ist, ja sich notwendigerweise aus der Vielfalt der damaligen Anschauungen und der Vielschichtigkeit der Strukturen ergibt. Wir kennen immer nur Fragmente des geschichtlichen Geschehens. Und wir wissen, dass sich nichts zwangsläufig vollzog, dass die Entwicklung offen war und auch ein anderes Ergebnis hätte haben können. Deshalb müssen wir Alternativen in die Untersuchung einbeziehen und danach fragen, warum sie keinen Erfolg hatten.
Um unsere Vorüberlegungen umzusetzen, halten wir den Ansatz für geeignet, aus dem Blickwinkel der Menschen, der historischen Akteurinnen und Akteure, die geschichtlichen Vorgänge zu betrachten, ihre Lebenswelten in den Mittelpunkt zu [<<14] stellen. In diesen bündeln sich individuell-persönliche und übergreifend-strukturelle Faktoren. Die Bedingungen des jeweiligen Handelns werden ebenso fassbar wie Sehnsüchte, Hoffnungen, Erinnerungen. Wahrnehmungen, Erfahrungen, Fühlen, Denken und Handeln werden nachvollziehbar und erhalten einen Bezug zu uns selbst, zu unserem Leben, ermöglichen uns deshalb eine Auseinandersetzung mit der Frage, wie wir es mit der Erinnerung an die Geschichte – in diesem Fall an die Russische Revolution – halten und welche Schlüsse wir daraus ziehen.
Das russische Reich bzw. die Sowjetunion in den Grenzen von 1914 und 1923. Der Übersichtlichkeit halber fehlen Teile Sibiriens und die Gebiete des Fernen Ostens. [Bildnachweis]

Immer wieder versuchen die Autorinnen und Autoren, im Sinne dieses Ansatzes die Begebenheiten durch das Handeln einzelner Menschen zu verdeutlichen. Selbstverständlich hätten wir auch andere Akteure und Akteurinnen zu Wort kommen lassen können. Die Auswahl ist im Zusammenhang unserer Forschungen entstanden, in jedem Fall aber vor dem Hintergrund unserer Analysen der Verhältnisse zu verstehen. [<<15]
Unsere Darstellung setzt ein mit den Verhältnissen im Zarenreich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, und sie endet mit dem Übergang der Sowjetunion in den Stalinismus. Mit dem Beginn der Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts und mit den damit verbundenen neuen Sozialbeziehungen, mit den Veränderungen auf dem Land, mit der Formierung revolutionärer Bewegungen und den Prägungen, die diese durch das Leben zahlreicher Persönlichkeiten im Exil erhielten, wurden besondere Voraussetzungen geschaffen, die zur Revolution von 1917 führten – auch wenn selbstverständlich noch weiter zurückliegende Faktoren nachwirkten. Das neue Machtsystem des Stalinismus bedeutete das Ende der Versuche, in der Sowjetunion die Ziele der Revolution von 1917 zu verwirklichen. Etwas völlig anderes war Realität geworden, als es sich die Menschen 1917 erhofft und die sozialistischen Revolutionäre erträumt hatten. Von nun an musste man von neuen Bedingungen ausgehen, um eine bessere, eine gerechte Gesellschaft anzustreben – auch wenn viele Menschen noch lange weiter hofften und die Ideen von 1917 bis heute lebendig sind.
Ein hoher Stellenwert kommt im Buch den Hoffnungen, Erwartungen und Utopien zu, die mit der Russischen Revolution verbunden waren. Sie gaben zahlreichen Menschen eine Zukunftsperspektive, brachten diese dazu, die Umwälzungen und die sich anschließende Politik zu unterstützen. Je tiefer dann die Kluft zwischen den Ansprüchen und den tatsächlichen Verhältnissen wurde, desto größer fiel die Enttäuschung aus, aber auch die Versuchung, die Macht mit Gewalt zu sichern, um unter besseren Umständen später einmal zu den ursprünglichen Zielen zurückzukehren. Sie wurden allmählich zu Versprechungen für eine ferne Zukunft, die die Menschen dazu anhalten sollten, sich doch noch mit allen Kräften für die neue Gesellschaft einzusetzen – bis dann sogar behauptet wurde, das Ziel, der Kommunismus, sei greifbar nahe, es brauche nur noch wenige Anstrengungen, um ihn zu erreichen.
Die Revolution und ihre Folgen haben unzählige Menschenleben gekostet, und sie haben Bewusstsein und Erinnerung der Menschen in der Sowjetunion und ihren Nachfolgestaaten, ja weit darüber hinaus nachhaltig geprägt. Das kann im Einzelnen nicht Gegenstand dieses Buches sein. Umso wichtiger ist es, sich mit den Ursachen dieses Prozesses zu beschäftigen, die ursprünglichen Zielsetzungen, Hoffnungen, Zukunftsentwürfe und Utopien in ihren konkreten geschichtlichen Rahmenbedingungen wieder ins Gedächtnis zu rufen und zu fragen, wie wir heute damit umgehen. Dazu leistet dieses Buch einen Beitrag. [<<16]
1W. I. Lenin: Über unsere Revolution. In: ders.: Werke. Bd. 33. Berlin 1962, 462–467, Zitate 464–465, 466.
2Rosa Luxemburg: Die russische Revolution. In: dies.: Politische Schriften. 3 Bde. Hg. von Ossip K. Flechtheim. Bd. 3. Frankfurt a. M., Wien 1968, 106–141, Zitate 134, 141.
Lebenswelten im Zarenreich
Ursachen der Revolution von 1917
Heiko Haumann
„Mein Vater, das stimmt, war wirklich ein Bauer, und ich hier in weißer Weste, gelben Schuhen. […] Nur dass ich reich bin, viel Geld habe, aber wenn man sich’s genau überlegt, dann bleibt der Bauer eben Bauer“, sagt der Kaufmann Ermolaj A. Lopachin in Anton P. Čechovs 1903 geschriebener Komödie „Der Kirschgarten“.1 Er ist so reich geworden, dass er das Gut samt Garten kaufen kann, auf dem sein Großvater und sein Vater noch Leibeigene waren, „wo man sie nicht mal in die Küche gelassen hat“ und er selbst als halber Analphabet im Winter barfuß herumlaufen musste. Die Herrschaftsverhältnisse haben sich umgekehrt. Zweihundert Jahre lang hatten die adligen Gutsbesitzer über „lebende Seelen“ geherrscht und auf deren Kosten gelebt – eine Anspielung auf Nikolaj V. Gogol’s berühmten Roman „Tote Seelen“ von 1842, der als Kritik am Leibeigenschaftssystem gelesen werden konnte. Manche Leibeigene, wie der Diener Firs, haben die frühere Ordnung derart verinnerlicht, dass sie die 1861 erfolgte Befreiung als „Unglück“ empfinden. Jetzt aber kann der „Garten Russland“ neu bewirtschaftet werden, „neues Leben“ geschaffen werden.
Lopachin, der aus der Leibeigenschaft aufgestiegene Unternehmer, steht nicht zufällig im Mittelpunkt dieses Theaterstückes. Bedeutende Industrielle zu Beginn des 20. Jahrhunderts konnten sich in ihm wiedererkennen. Traditionell übten Bauern auf dem Land Nebengewerbe aus. Die dörfliche kustar’-Industrieumfasste kleine Handwerksbetriebe ebenso wie große Gerbereien, Leinenwebereien oder Schnapsbrennereien.
Einigen Bauern, häufig Altgläubigen, gelang es namentlich in der Moskauer Region, riesige Textil- und Nahrungsmittelfabriken zu errichten. Zusammen mit einer Anzahl Adliger und Kaufleute bildeten sie den Typus des „Moskauer Unternehmers“: Dieser betonte das „echt Russische“, lehnte ausländische Elemente und auch Auslandskapital [<<17] Seitenzahl der gedruckten Ausgabe ab und strebte eine Eigenfinanzierung seiner Firma an. Er fühlte sich durchaus als „Herr“. Maksim Gor’kij lässt in seinem Čechov gewidmeten Roman von 1899, „Foma Gordeev“, den Kaufmann Majakin auf den „Adel, die Beamten und allerhand andre, die nicht zu uns gehören“, herabsehen, obwohl sie noch „kommandieren“. „Wer ist aber heutzutage der eigentlich Mächtige unter den Menschen? Der Kaufmann ist im Staate der Mächtigste, denn er hat die Millionen!“2 Kulturell orientierten sich diese Unternehmer häufig am adligen Lebensstil.
Читать дальше