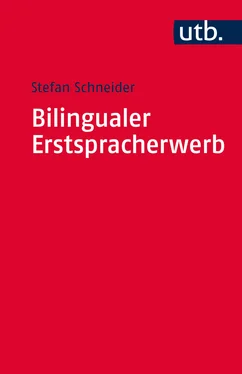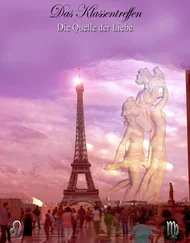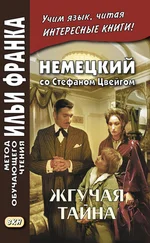Stefan Schneider - Bilingualer Erstspracherwerb
Здесь есть возможность читать онлайн «Stefan Schneider - Bilingualer Erstspracherwerb» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Bilingualer Erstspracherwerb
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Bilingualer Erstspracherwerb: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Bilingualer Erstspracherwerb»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Bilingualer Erstspracherwerb — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Bilingualer Erstspracherwerb», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Bei Kindern, die sprachlichen Minderheiten angehören, passiert es jedoch häufig, dass die Weiterentwicklung der Erstsprache bei Schuleintritt abrupt unterbrochen wird und die Alphabetisierung in der gerade erst im Aufbau befindlichen Zweitsprache stattfindet. Das Ergebnis sind meistens geringere sprachliche, aber auch geringere allgemeine kognitive Fähigkeiten sowohl in der Erstsprache als auch in der Zweitsprache. Dieses zweifache sprachliche Defizit wurde in der Vergangenheit mit den in der skandinavischen Linguistik entwickelten Begriffen Semilingualismus oder doppelter Semilingualismus (Hansegård 1968; Skutnabb-Kangas und Toukomaa 1976; Toukomaa und Skutnabb-Kangas 1977) charakterisiert. In diesem Buch ziehe ich, im Sinne der gehandhabten terminologischen Praxis, die Bezeichnung Semilingualität vor. Zwei der in Abschnitt 3.2besprochenen Hypothesen, die Schwellenhypothese und die Interdependenzhypothese (Toukomaa und Skutnabb-Kangas 1977; Cummins 1979), stehen mit diesem Begriff in Zusammenhang.
Wie Romaine (1995, 261–265) erklärt, ist der Begriff allerdings umstritten und wird von Forschern wie Tove Skutnabb-Kangas und Jim Cummins abgelehnt, da er primär in Zusammenhang mit ethnischen Minderheiten verwendet wurde und eine politische Bedeutung mit pejorativer Konnotation annahm. Die Semilingualität ist in der Tat in erster Linie auf politische und soziale, weniger auf individuelle oder kognitive Gründe zurückzuführen. Denken wir hier zum Beispiel an die Kinder lateinamerikanischer Einwanderer in den USA. Besonders in den 1960er und 1970er Jahren waren diese Kinder von Anfang an mit einem mehrheitssprachlichen Schulunterricht konfrontiert, obwohl ihre erstsprachlichen Kompetenzen noch nicht zur Genüge entwickelt waren. Diese Art des Spracherwerbs und -unterrichts wird manchmal Submersion genannt.
In einer Situation wie der gerade beschriebenen, in der die Erstsprache eine Minderheitensprache ist, können Faktoren wie der Druck der mehrheitlich anderssprachigen Umwelt, der assimilatorische Unterricht in der im wahrsten Sinne des Wortes dominanten Sprache und das geringe soziale Prestige der Minderheit und ihrer Sprache und Kultur die Fähigkeiten in der Erstsprache ernsthaft gefährden (Chumak-Horbatsch 2008; Bolonyai 2009). Lambert (1974) schlug diesbezüglich die Unterscheidung zwischen subtraktiver und additiver Bilingualität vor und wies auf die entscheidende Rolle der sozialen Gegebenheiten hin. Die Bilingualität dieser Kinder ist gefährdet, am Ende des Prozesses steht in vielen Fällen die Monolingualität, weshalb manche Autoren in diesem Zusammenhang auch von Sprachsubstitution (z. B. Francis 2011) sprechen.
Statt von Semilingualität wird in der heutigen Literatur zumeist von unvollständigem Spracherwerb und Sprachabbau gesprochen (Bolonyai 2009; Köpke und Schmid 2013). Chilla, Rothweiler und Babur (2013, 66 f.) verwenden auch den Terminus Sprachverlust. Die Begriffe unterscheiden sich insofern von demjenigen der Semilingualität, als sie sich lediglich auf den Zustand der Erstsprache beziehen. Aufgrund eines stark reduzierten Inputs können die Kompetenzen in der Erstsprache ernsthaft in Frage gestellt werden. Wenn diese Reduktion des Inputs vor der Pubertät eintritt, nimmt man an, dass der Erwerb der Erstsprache nicht abgeschlossen und daher unvollständig ist. Tritt eine starke und lang anhaltende Reduktion des Inputs im Erwachsenenalter ein, wird davon ausgegangen, dass eine schon vollständig erworbene Erstsprache allmählich wieder abgebaut wird. Der Abbau einer Sprache kann auch ein kollektives Phänomen sein und eine Sprache in einer mehrsprachigen Gesellschaft betreffen. Ich beziehe mich hier jedoch auf das individuelle Phänomen, bei dem durch reduzierten Input die Kompetenzen in der Erstsprache vermindert werden und im Extremfall sogar verloren gehen. In der englischsprachigen Literatur hat sich dafür der Terminus first language attrition (Kaufman und Aronoff 1991; Francis 2005; Schmid und Köpke 2013) durchgesetzt, den man mit dem deutschen Erstsprachabbau wiedergeben kann. Beide Phänomene, unvollständiger Erwerb und Sprachabbau, können gelegentlich auch im bilingualen Erstspracherwerb vorkommen. Allerdings ist hier die in der Theorie klare Trennlinie zwischen unvollständigem Erwerb und Sprachabbau nicht einfach zu ziehen (Bolonyai 2009, 256; Köpke und Schmid 2013, 17 f.). Die Entwicklung der Kompetenzen in einer der beiden Sprachen kann durch stark verminderten Input unterbrochen werden. Genauso gut ist vorstellbar, dass bestimmte schon voll entwickelte Kompetenzen wieder abgebaut werden.
Der unvollständige Erwerb und der Sprachabbau manifestieren sich durch generelle Unsicherheit beim Sprachgebrauch, Wortfindungsprobleme, Häsitationsphenomene und durch verstärkten Einfluss der anderen Sprache. Zudem sind sie von Sprachmischung begleitet. Es muss jedoch unterstrichen werden, dass das Gegenteil nicht zutrifft (Bolonyai 2009, 253; Anstatt und Rubcov 2012, 75): Die Sprachmischung weist weder automatisch auf unvollständigen Erwerb und Sprachabbau hin noch führt sie automatisch zu unvollständigem Erwerb und Sprachabbau. Die Sprachmischung hat keine inhärent negative Wirkung auf eine der beiden Sprachen.
2.7 Verschiedene ‚Sprachen‘
Im allgemeinen Sprachgebrauch wird mit Muttersprache die Sprache bezeichnet, die man als Kind von den Eltern erwirbt und während eines Großteils der Kindheit verwendet, in der man sich spontan ausdrücken kann, in der man denkt und sich zu Hause fühlt. Bilinguale Kinder haben in diesem Sinn also zwei Muttersprachen, aber natürlich nicht zwei Mütter. Muttersprache kann jedoch noch etwas anderes bedeuten und zwar einfach die Sprache der Mutter. Im Kontext des bilingualen Erstspracherwerbs kommt nur diese zweite Bedeutung zum Tragen. Muttersprache steht hier im Gegensatz zu Vatersprache und bezeichnet vor allem in einer Familie, in der die Konstellation eine Person → eine Sprache herrscht, einfach die Sprache, die die Mutter mit dem Kind spricht. Im Laufe dieses Buches werde ich für die anfangs erwähnte Bedeutung den Terminus Erstsprache verwenden und daher vom bilingualen, doppelten oder zweifachen Erstspracherwerb sprechen.
Bei der Besprechung der bilingualen Kommunikation in der Familie und in ihrem Umfeld habe ich bereits den Begriff der Umgebungssprache eingeführt und ihn der Familiensprache gegenüber gestellt. Die Umgebungssprache ist in der Regel die Sprache der nationalen, regionalen oder auch lokalen Gemeinschaft, in dem das zweisprachige Kind aufwächst. Selbstverständlich kann die Situation komplexer sein als hier beschrieben. Die Umgebungssprache kann auf die lokale Gemeinschaft beschränkt und die nationale Sprache eine andere sein. Die Umgebungssprache gewinnt mit zunehmendem Alter, sobald die Kinder Spielkameraden kennen lernen, den Kindergarten oder die Schule besuchen, an Bedeutung, so dass sie oft zur starken Sprache wird.
Meist ist die Schulsprache die Sprache der jeweiligen lokalen Bevölkerung, das heißt Schulsprache und Umgebungssprache sind gleich. Es gibt allerdings zahlreiche Fälle, in denen das nicht so ist. In Algerien findet der Unterricht, auch in den berbersprachigen Gebieten, während der ersten neun Jahre der Grundschule auf Arabisch statt. In den Gymnasien und auf der Universität wird jedoch auf Französisch unterrichtet. Eine vergleichbare Situation finden wir in den anderen Staaten des Maghreb sowie in Westafrika. Welche Sprache als Schulsprache anerkannt wird, ist oft Thema politischer Auseinandersetzungen und kann im Extremfall als politisches Druckmittel dienen. Im Kosovo wurde in der Zeit der Regierung von Slobodan Milošević an den Universitäten das Albanische zugunsten des Serbischen abgeschafft, obwohl die weit überwiegende Bevölkerungsmehrheit albanischsprachig war.
Die Zählsprache ist bei mehrsprachigen Individuen nicht unbedingt die starke Sprache, sondern die Sprache, in der sie Zählen und Rechnen gelernt haben, d. h. im Regelfall die Schulsprache. Zählen und Rechen sind stark fixierte und automatisierte, über die Sprache im Gedächtnis gespeicherte Operationen, die sprachlichen Verschiebungen widerstehen und sich auch in einer schwach gewordenen Sprache halten können. Jeder Leser und jede Leserin, der oder die längere Zeit im Ausland verbracht und sich Telefonnummern in einer Fremdsprache gemerkt hat, kann diese Fixierung und Automatisierung einer einmal gelernten Zahlenkombination an sich selbst beobachten: Auch nach mehreren Jahren erfolgt das Ins-Gedächtnis-rufen der Telefonnummer leichter und spontaner in der Form, in der sie damals zuerst memorisiert wurde. Überhaupt stehen Sprache und autobiografisches Gedächtnis in engem Zusammenhang (Pavlenko 2011, 243 f., 2014, 191–194; De Groot 2013, 186–89). Marian und Neisser (2000) zeigen mit einem Experiment, dass sich Personen an vergangene Ereignisse besser sprachlich zurückerinnern können, wenn das in derjenigen Sprache passiert, in der sich das Ereignis tatsächlich abspielte.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Bilingualer Erstspracherwerb»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Bilingualer Erstspracherwerb» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Bilingualer Erstspracherwerb» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.