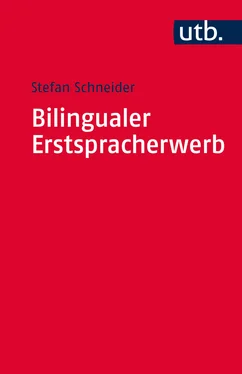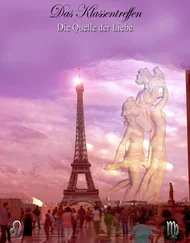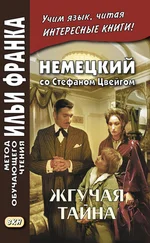Im vorhergehenden Abschnitt habe ich von Bi- und Multilingualität und von Bi- und Multilingualismus gesprochen. In Laufe des Buches wird allerdings klar werden, dass mein Augenmerk aufgrund der größeren Verbreitung des Phänomens vornehmlich der frühkindlichen Bilingualität gilt. Die aktuelle Forschungslage trägt ebenfalls dazu bei: Obwohl es eine Reihe von Untersuchungen zum gleichzeitigen Erwerb von drei oder sogar mehr Sprachen gibt, beschäftigen sich die meisten Studien mit dem Erwerb zweier Sprachen. Ich verfahre deshalb dem heutigen Stand der Dinge entsprechend und berichte primär über die frühkindliche Bilingualität.
Zur Trilingualität oder Dreisprachigkeit kann es schnell kommen; im Grunde sobald zu den zwei Sprachen als dritte der lokale Dialekt einer der beiden Sprachen tritt – eine Situation, die in den schon angesprochenen zweisprachigen Gebieten des Bundeslandes Kärnten keine Seltenheit ist. Auch der Erwerb von drei ganz vollkommen unterschiedlichen Sprachen im Kindesalter ist selbstverständlich möglich, wie die Studien von Murrell (1966), Francescato (1971), Oksaar (1977), De Matteis (1978), Kadar-Hoffmann (1983), Hoffmann (1985, 2001), Navracsics (1985), Mikeš (1990), Stavans (1990, 1992), Faingold (1999), Quay (2001), Cruz-Ferreira (2006), Wang (2008) und Arnaus Gil (2013) dokumentieren. Barnes (2006) enthält einen Überblick über die Forschung zur frühkindlichen Dreisprachigkeit.
Hagège (1996, 259) erwähnt eine Reihe von bekannten zwei- oder mehrsprachigen Schriftstellern. Der in der Donaustadt Ruse in Bulgarien geborene Schriftsteller Elias Canetti (1905–1994) berichtet ebenso in der Autobiografie Die gerettete Zunge (1977) von seiner Kindheit in einer mehrsprachigen Umgebung. Seine Eltern waren sephardisch-jüdischer Herkunft und über die Türkei in Bulgarien eingewandert. Im Elternhaus wurde in vier Sprachen kommuniziert: Judenspanisch, Bulgarisch, Deutsch, später noch Englisch. Diese Seiten sind nicht nur von sprachwissenschaftlichem und psychologischem Interesse, sondern gewähren auch einen geistreich verfassten Einblick in das Leben der multilingualen und multiethnischen altösterreichischen Gesellschaft Südosteuropas.
2.3 Bilingualer Erstspracherwerb und früher Zweitspracherwerb
Das Kriterium der Zeit erlaubt es uns, zwischen dem gleichzeitigen (simultanen) (Sprache X/Sprache Y) und dem sukzessiven (konsekutiven oder sequenziellen) Erwerb mehrerer Sprachen zu unterscheiden (Sprache X → Sprache Y) (McLaughlin 1978). Im ersten Fall ist das Kind von Geburt an regelmäßig mit zwei oder mehreren Sprachen konfrontiert und nur hier kann man streng genommen von bilingualem Erstspracherwerb sprechen. Im zweiten Fall sollte man von frühem Zweitspracherwerb sprechen.
In den Lebenssituationen von vielen sprachlichen Minderheiten ist es in der Regel so, dass die Kinder anfangs mit einer Sprache aufwachsen und erst später im Zuge der ersten außerfamiliären Kontakte, auf dem Spielplatz, im Kindergarten oder in der Schule, die zweite Sprache erwerben. Grundsätzlich gilt hier das Gleiche wie für den bilingualen Erstspracherwerb: Stimmen die sozialen und kognitiven Voraussetzungen und erhält das Kind ausreichende Zuwendung seitens der erwachsenen Ansprechpartner, kann man davon ausgehen, dass der etwas später einsetzende Erwerb einer zweiten Sprache zu einer gelungenen Zweisprachigkeit führt.
Die in der Theorie klare Unterscheidung zwischen gleichzeitigem und sukzessivem Erwerb ist in der konkreten Anwendung nicht ohne Kompromisse haltbar. Sie läuft auf die Frage hinaus, wie strikt Gleichzeitigkeit zu verstehen ist. Von ihr hängt die Definition des bilingualen Erstspracherwerbs ab. Obgleich er sich der Arbitrarität dieses Kriteriums bewusst ist, schlägt McLaughlin (1978, 9, 73, 99) drei Jahre als Altersgrenze vor. Wenn das Kind bis dahin regelmäßig mit zwei Sprachen Kontakt hatte, könne man das als bilingualen Erstspracherwerb betrachten. Deuchar und Quay (2000, 2) setzen diese Grenze auf ein Jahr herunter. De Houwer (1995, 223) legt sie bei einem Monat fest, wobei allerdings später in De Houwer (2009, 2) ein solches Limit nicht mehr erwähnt wird. Romaine (1999, 252) spricht sich hingegen für eine strikte Interpretation von Gleichzeitigkeit aus: Nur wenn ab der Geburt mit dem Kind zwei Sprachen gesprochen werden, könne man von bilingualem Erstspracherwerb sprechen. Die gleiche Auffassung finden wir bei Müller et al. (2011, 15). Ich definiere in diesem Buch den bilingualen Erstspracherwerb ebenfalls als sofort mit der Geburt beginnenden Kontakt mit zwei Sprachen.
Aber auch diese Definition ist selbstverständlich nicht unproblematisch. Im Grunde genommen müsste man nämlich die Zeit vor der Geburt in die Betrachtung mit einschließen. Bis zum sechsten Schwangerschaftsmonat ist die Reifung des auditiven Systems des Fötus soweit fortgeschritten, dass Laute über den Körper der Mutter aufgenommen werden. Wie Studien der letzten Jahre gezeigt haben, reagiert das Baby im Mutterleib auf die prosodischen Muster, d. h. auf Tonhöhe, Rhythmus, Pausen und Intensität, der Sprache der Mutter und anderer Personen im Umfeld (Mehler et al. 1988; Szagun 2006, 47 f.; Mampe et al. 2009; Moon, Lagercrantz und Kuhl 2013), d. h. es gibt so etwas wie einen pränatalen Spracherwerb. Wenn ein Kind zur Welt kommt, kann es bereits zwischen der Sprache der Personen in der unmittelbaren Umgebung und anderen Sprachen unterscheiden. Zudem schließt die in diesem Buch verwendete Definition die zugegebenermaßen seltenen Fälle der passiven Bilingualität ein (Yip 2013, 120), bei denen ein Kind zwar zwei Sprachen von Geburt an hört, aber nur eine Sprache aktiv verwendet.
Yip und Matthews (2007, 26) weisen auf eine Gemeinsamkeit des bilingualen Erstspracherwerbs und des frühen Zweitspracherwerbs hin. In beiden Fällen ist der Erwerb der betroffenen Sprachen erst im Gange und noch längst nicht abgeschlossen. Deshalb ist auch in beiden Fällen gegenseitiger Spracheinfluss möglich. Beim Zweitspracherwerb in der Jugend oder im Erwachsenenalter kann man hingegen davon ausgehen, dass die Kompetenzen in der Erstsprache fast voll entwickelt sind. Der Spracheinfluss erfolgt hauptsächlich monodirektional von der Erstsprache zur Zweitsprache.
Zusätzlich wirft die Debatte über den gleichzeitigen und sukzessiven Spracherwerb die Frage auf, inwiefern der Unterschied zwischen der stärkeren und schwächeren Sprache eines bilingualen Kindes demjenigen zwischen der Erstsprache und der frühzeitig erworbenen Zweitsprache gleicht. Zwei Sichtweisen sind in diesem Zusammenhang zu erkennen (Bernardini 2003, 43). Auf der einen Seite wird angenommen, dass die Erwerbsmuster der beiden Sprachen, egal ob stärkere oder schwächere Sprache, denjenigen des jeweiligen monolingualen Erwerbs gleichen. Auf der anderen Seite ist der Standpunkt zu erkennen, dass die Erwerbsmuster der schwächeren Sprache eines bilingualen Kindes tendenziell denjenigen einer früh erworbenen Zweitsprache ähnlich sind. Die Ergebnisse der Studie von Bernardini (2003) scheinen eher für die zweite Annahme zu sprechen.
Bei der Unterscheidung zwischen bilingualem Erstspracherwerb und frühem Zweitspracherwerb berücksichtige ich in diesem Abschnitt bewusst nicht die Sprachkompetenzen, zu denen die beiden Erwerbssituationen führen. Auf der einen Seite kann früher Zweitspracherwerb selbstverständlich zu einer gelungenen Zweisprachigkeit führen. Auf der anderen Seite führt der Kontakt zu zwei Sprachen von Geburt an nicht automatisch zu Zweisprachigkeit. Abgesehen davon können sich aufgrund von veränderten Inputbedingungen die Sprachkompetenzen nicht vollständig entwickeln oder wieder abgebaut werden. Wie ich in Abschnitt 2.6darstellen werde, kann die später erworbene Zweitsprache die Fähigkeiten in der Erstsprache gefährden (Chumak-Horbatsch 2008). Der unvollständige Erwerb der Erstsprache gepaart mit dem Sprachabbau kann so weit führen, dass die Erstsprache fast vollkommen aufgegeben wird, weshalb man von Sprachsubstitution (z. B. Francis 2011) sprechen kann. Yip (2013, 120) erwähnt als ein anderes Beispiel für Sprachsubstitution den Fall von adoptierten Kindern, die in ihrer neuen Familie mit einer neuen Sprache konfrontiert sind und ihre ursprüngliche Erstsprache aufgeben müssen (Ventureya und Pallier 2004; Footnick 2007; Pallier 2007, 161–165; Gauthier und Genesee 2011).
Читать дальше