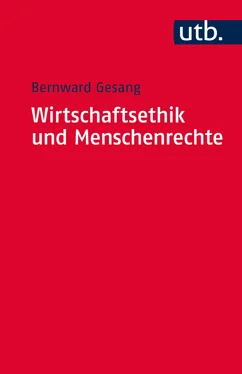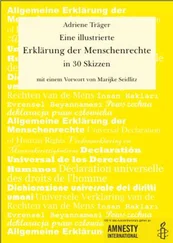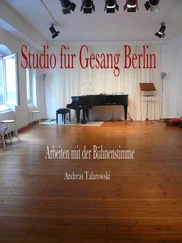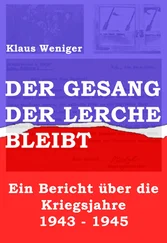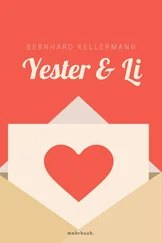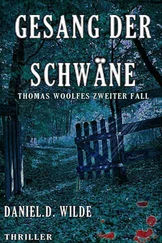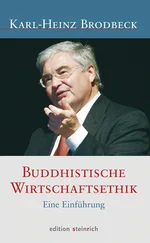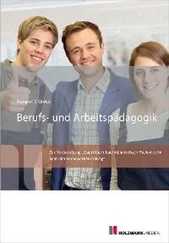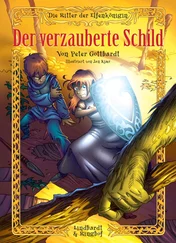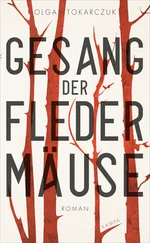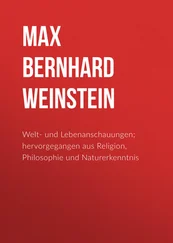Bernward Gesang - Wirtschaftsethik und Menschenrechte
Здесь есть возможность читать онлайн «Bernward Gesang - Wirtschaftsethik und Menschenrechte» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Wirtschaftsethik und Menschenrechte
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Wirtschaftsethik und Menschenrechte: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Wirtschaftsethik und Menschenrechte»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Wirtschaftsethik und Menschenrechte — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Wirtschaftsethik und Menschenrechte», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Weiterhin wird anerkannt, dass Rahmenordnungen nie perfekt sind (Homann und Blome-Drees 1992, 114f.). Allgemeine Regeln können individuellen Fällen nie ganz gerecht werden, Gesetze laufen den zu regulierenden Fehlentwicklungen zeitlich immer hinterher. Viele Rahmenordnungen sind zudem, selbst gemessen an den Maßstäben der Vertragstheorie, nicht immer moralisch. In manchen Teilen der Welt existiert z.B. nur ein auf „Vetternwirtschaft“ basierender gesetzlicher Ordnungsrahmen zum alleinigen Vorteil von Eliten. In solchen globalisierten Kontexten bleibt nur das positive Image des Unternehmens[12] als Instanz bestehen, die das Unternehmen zügeln kann. Während die Unternehmen unter einem hypothetisch unterstellten, perfekten Rahmen nur die Pflicht haben, Gewinne zu maximieren, ist dies in der Realität nicht mehr ihre alleinige Aufgabe. Es wird eine eigene Unternehmensethik notwendig, die im Idealzustand gar nicht gebraucht würde.
Die ethischen Aufgaben von Unternehmen sind unterschiedlich. Zuerst müssen ethische Ansprüche aus der Gesellschaft auf ihre ethische Berechtigung geprüft werden, wozu sehr wenig gesagt wird (Homann und Blome-Drees 1992, 128). Unternehmen können auf der Ebene der Spielzüge, d.h. auf einer Wettbewerbsebene , durch individuelle Selbstbindung oder innovative Produkte, Verbesserungen bewirken (d.i. die Wettbewerbsstrategie ) (Homann und Blome-Drees 1992, 136f.). Eine Forderung aber, welche zu dauerhaften Nachteilen führt, brächte das Vertragskalkül zum Einsturz und ist daher innerhalb der ökonomischen Ethik unmöglich: „Es kann keine ethische Begründung für Normen geben, die ständige wirtschaftliche Benachteiligungen nach sich ziehen.“ (Homann und Blome-Drees 1992, 146)
Moral ist einem Unternehmen nur zumutbar, wenn sie langfristig seine Gewinne vergrößert, sie ist eine langfristige Investition (Homann und Blome-Drees 1992, 145).
|16|Lässt sich eine Win-win-Situation durch Veränderung der Spielzüge auf der Wettbewerbsebene langfristig nicht herstellen, bleibt dem Unternehmen nur die ordnungspolitische Strategie (Homann und Blome-Drees 1992, 138; Suchanek 2007, 144ff.). Das heißt, es sollte dann versuchen, Einfluss auf die Politik zu nehmen (Verbände, öffentlicher Druck, Lobbyarbeit etc.), um die moralischen Lücken des Rahmens wettbewerbsneutral für alle Akteure zu schließen. Der Antrieb, für eine solche Moralisierung des Rahmens einzutreten, stammt aus zwei Überlegungen: Einerseits kann ein unmoralischer Rahmen zum Zerbrechen des sozialen Friedens und damit dazu führen, dass der Eigennutzen für jeden Akteur schwerer realisierbar wird. Andererseits kann ein Engagement für eine moralische Gesetzgebung die langfristige Gewinnsteigerung vereinfachen, beispielsweise indem man die Gesetze mit den Moralurteilen der Mehrheit[13] in Übereinstimmung bringt und so Akzeptanz für Gesetzestreue gewinnt (Beispiel: Tierschutz).
IV. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf – Die Vertragstheorie
In diesem Abschnitt beginne ich mit der Kritik der vertragstheoretischen Ausrichtung der ökonomischen Ethik. Es ist wahr, dass sich die Menschen heute nicht mehr ohne weiteres einig werden, worin das Gute und Richtige besteht. Aufgrund dieses Pluralismus das Eigeninteresse als „kleinsten gemeinsamen Nenner“ zu identifizieren und zu suggerieren, damit wäre der Pluralismus überwindbar, ist aber ein Trugschluss. Viele Menschen sind sich darüber einig, dass die Vertragstheorie mit ihrer Minimalmoral (s.u.) kein befriedigendes Moralmodell ist (Zu einer aktuellen Version der Theorie: Hoerster 2003. Zur Kritik: Ott 2001). Das Faktum, dass gerade die Vertragstheorie nicht von jedermann befürwortet wird[14], obwohl sie sich am vermeintlich kleinsten gemeinsamen Nenner orientiert, übergehen die Vertreter der ökonomischen Ethik allenfalls mit Verweis auf Aufklärungsdefizite. Aufgeklärte Gründe für die breite Ablehnung und den obigen Vor|17|wurf, dass die Vertragstheorie nur eine Minimalmoral sei, sind etwa folgende:
a)Wäre die Vertragstheorie richtig, wären erzwungene Konsense moralisch, die einfach von den faktischen Machtpositionen der Vertragspartner abhängen. Es ist für Sklaven und Herren – gegeben ihre Machtpositionen – eventuell von Vorteil, sich auf eine Beschränkung der Arbeitszeit auf 16 Stunden am Tag zu einigen. Aber moralisch ist dieser Konsens noch lange nicht, da er von den Sklaven nur anerkannt wird, weil diese Beschränkung das Beste ist, was sie mit ihrer geringen Verhandlungsmacht herausholen können. Das lässt die Vertragstheorie aber nicht gelten, denn alle haben zugestimmt und Pareto folgend ihren Vorteil vergrößert. So kann man Sklaverei mit unakzeptablen Gründen als moralisch rechtfertigen (vgl. die Diskussion bei Hoerster 2003, 181–184).
b)In einer solchen Minimalmoral hätten wir keinerlei Verpflichtung zukünftigen Generationen oder Tieren gegenüber. Diese wären schlicht aufgrund ihrer Machtlosigkeit rechtlos, denn sie zu beachten, vergrößert nicht den Eigennutzen der heutigen Menschen. Machtlose Wesen können diesen nicht schaden. Homann gesteht das offen ein: „Noch nicht geborene Generationen sind für vertragstheoretische Begründungsfiguren nicht erreichbar.“ (Homann 2003, 271) Ein solcher Kurzschluss der „natürlichen Gegner“ Macht und Moral ist ein Skandal.
Es kommt der Einwand auf, dass die allgemeinen Schwächen der Vertragstheorie nicht auf ihre Anwendung im Sektor Wirtschaft durchschlagen. Es führt jedoch ein direkter Verbindungspfad von der minimalmoralischen Ausrichtung der Vertragstheorie zur Vernachlässigung von Ökologieproblemen durch die ökonomische Ethik. Auch die im nächsten Abschnitt aufgeworfenen Fragen nach moralischem Sein und moralischem Schein in diesem Theoriegebäude, lassen sich als direkte Auswirkungen der vertragstheoretischen Orientierung verstehen. Die ökonomische Ethik ist aufs engste mit der Vertragstheorie verbunden, auch wenn sie sich selten zu dieser Bindung bekennt. Daher findet sich der ganze „Sündenkatalog“ der Vertragstheorie „im Kleingedruckten“ der ökonomischen Ethik wieder.
c)Die Vertragstheorie ist einem gut begründeten Moralverständnis zufolge gar keine Moraltheorie, da Moral inhaltlich so definiert ist, dass der Standpunkt eines jeden Betroffenen unparteilich beachtet werden muss (v. Kutschera 1982, 302). Sklaven, zukünftige Lebewesen, Tiere u.a. gehören unstrittiger Weise zu den von den Handlungen im |18|Wirtschaftssystem Betroffenen, werden aber von der Vertragstheorie ignoriert, weil sie machtlos sind.
Suchanek versucht Punkt b) zu entkräften und zukünftige Generationen in das Modell der Vertragstheorie einzubauen. Dabei soll Nachhaltigkeit als vertragstheoretisch geboten erwiesen werden, wenn sie dem wechselseitigen Vorteil dient, während sie in jedem anderen Fall nicht geboten ist. Die Leitfrage lautet: „Inwiefern lassen sich heutige Maßnahmen zur Erhaltung der Lebensgrundlagen künftiger Generationen als Investition begründen, deren Erträge (auch) der gegenwärtigen Generation zugutekommen?“ (Suchanek 2004, 8) Suchanek nimmt an, dass eine Generation G2 Versorgungsbezüge von der Generation G3 erhalten will, dass G3 diese Bezüge von G4 wünscht usw. In diesem Falle ist es rational für G2, diesen Generationenvertrag aufrecht zu erhalten (also G1 auszuzahlen), insbesondere wenn man ihn als wiederholtes Spiel analysiert.
Wie aber beim Klimawandel mit seinen langfristigen Zeitdimensionen, bei der Artenvielfalt oder bei der Weltarmut überhaupt die Rede von „Versorgungsbezügen zwischen den Generationen“ mit Sinn gefüllt werden kann, wird von Suchanek nicht gezeigt. Versorgungsbezüge sind im Normalfall Rentenbezüge. Für meine Rente sind Bürger meines Staates verantwortlich. Es wäre also zu zeigen, wie genau deutsche Renten in den nächsten ca. 50 Jahren vom Klimawandel und von der Artenvielfalt abhängen, und dass man sie am kostengünstigsten sichern kann, wenn man diese Gefahren bekämpft.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Wirtschaftsethik und Menschenrechte»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Wirtschaftsethik und Menschenrechte» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Wirtschaftsethik und Menschenrechte» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.