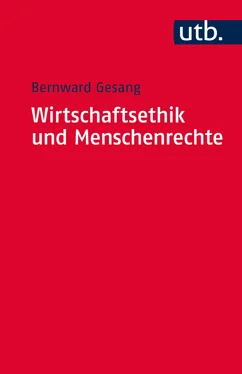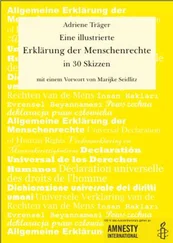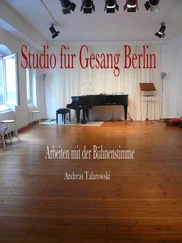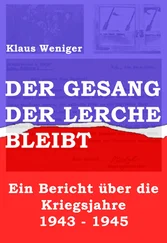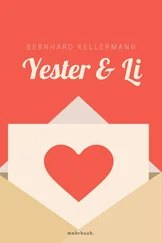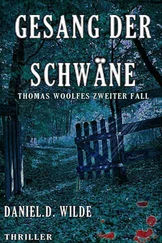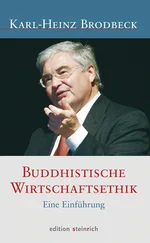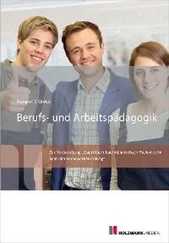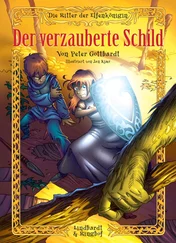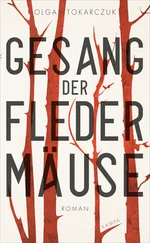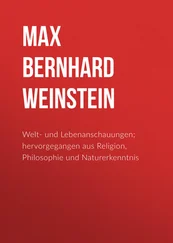Bernward Gesang - Wirtschaftsethik und Menschenrechte
Здесь есть возможность читать онлайн «Bernward Gesang - Wirtschaftsethik und Menschenrechte» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Wirtschaftsethik und Menschenrechte
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Wirtschaftsethik und Menschenrechte: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Wirtschaftsethik und Menschenrechte»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Wirtschaftsethik und Menschenrechte — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Wirtschaftsethik und Menschenrechte», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Weiterhin wird von Homann auch mehr Solidarität als Ziel des Wirtschaftens und als vorteilhafte Wirkung der Marktwirtschaft ausgewiesen (Homann und Blome-Drees 1992, 26, 45). Aber diese Solidarität zu gewähren, heißt in modernen Massengesellschaften, Mittel für einen sozialen Ausgleich bereitzustellen. Diese müssen erwirtschaftet werden, eine arme Gesellschaft kann nicht solidarisch sein. Da die nötigen Mittel nur auf den Märkten und damit unter Konkurrenz erwirtschaftet werden können, gilt für die ökonomische Ethik: Wettbewerb ist solidarischer als Teilen (Homann und Blome-Drees 1992, 26). Sankt Martin hätte demnach nicht seinen Mantel teilen, sondern eine Fabrik für Mäntel bauen und dann Mäntel verkaufen sollen, das wäre marktwirtschaftliche Solidarität. (Man denke an all die Sankt-Martins-Aufführungen, für die dementsprechend ein neues Drehbuch geschrieben werden müsste.) So kommt Homann zu dem Fazit, dass „das Streben nach individueller Besserstellung – unter einer geeigneten Rahmenordnung – auch den anderen, allen anderen, Vorteile bringt“ (Homann 2003, 171).[6]
|12|All das begründet einen Perspektivwechsel: „Habgier“ von Unternehmern sei nicht schuld an moralischen Problemen, sondern sei moralisch erwünscht, sofern sie auf dem Boden der Rahmenordnung verbleibe. Es sei niemandem damit gedient, wenn ein „guter“ Unternehmer, der Moralappellen folge, vom Markt verschwinde. Der Bankrott würde sich zwangsläufig bei einem Unternehmen einstellen, wenn es Moralvorstellungen gegen die bestehenden Anreize durchsetze und zulasten seiner Gewinne handele (Homann und Blome-Drees 1992, 34). Der Wettbewerb wird als scharf aufgefasst (es gebe keine „Schlafmützenkonkurrenz“ und es solle sie auch nicht geben) und es wird behauptet, Unternehmen könnten sich seinem Zwang nicht entziehen und trotzdem fortbestehen. Wenn moralisches Handeln dauerhafte Gewinneinbußen bewirken würde, könne dies vom Individuum bzw. Unternehmen nicht gefordert sein (zur vertragstheoretischen Begründung dessen, s.u.). Alles andere wäre eine „Hypermoralisierung“ (Homann und Blome-Drees 1992, 36), eine Überdehnung der Individualethik (Pies 2010, 254). Eine Ethik des Opferns und Teilens stamme aus vergangenen Zeiten, in denen es keine modernen Massengesellschaften gab.
Fazit: Moral wird umgesetzt, indem von Institutionen dafür Sorge getragen wird, dass sie sich langfristig lohnt. Es muss gewährleistet sein, dass Moral eine langfristige Investition zur Steigerung der Gewinne eines Unternehmens ist. I. Pies nennt eines seiner Bücher sogar „Moral als Produktionsfaktor“ (Pies 2009; vgl. Suchanek 2007, 51). So werden Win-win-Situationen aufgezeigt und erzeugt, um den wechselseitigen Vorteil zu mehren. Wenn das gelingt, wird Moral schnell umsetzbar, weil sie keine Revolution des menschlichen Denkens erfordert, sondern an die bestehenden, egoistischen Motivationsmuster der Mehrheit anschlussfähig ist. (Zwischenzeitlich mag man an die beste aller möglichen Welten von Leibniz erinnert werden, in der jedes „Übel“ in einen Vorteil umgemünzt wird – es gab allerdings schon Religionsphilosophen, die hier leichte Zweifel hatten …). Win-win-Situationen werden erzeugt, indem Institutionen geschaffen werden, die Moral möglich machen. Das heißt, es müssen Regeln eingeführt werden, die nicht von Trittbrettfahrern ausnutzbar sind, denn dauerhaft ausgenutzt zu werden, tötet die Motivation jedes moralischen Akteurs. Daher müssen die Institutionen und Regeln so konzipiert werden, dass sie den sogenannten HO-Test bestehen. Das heißt, dass sie es für einen HO-Akteur nicht attraktiv machen, sie auszunutzen, denn das kann eine Erosion auslösen: „Ein Anbieter, der legal die Umwelt |13|verschmutzt, zwingt die moralischer gesinnten Konkurrenten, ihre freiwillige Zurückhaltung aufzugeben.“ (Homann und Blome-Drees 1992, 42)[7]
III. Der Rahmen und seine Krankheiten
Soweit das Grundmodell der ökonomischen Ethik. Nun kümmern sich deren Vertreter aber auch um die tiefergehende Rechtfertigung und um einige Probleme des Grundmodells. Auch an die Rahmenordnung selbst, die sich vorrangig aus Gesetzen und weit verbreiteten Moralvorstellungen in der Gesellschaft zusammensetzt (Homann und Blome-Drees 1992, 23), sind moralische Anforderungen zu stellen, gerade damit sie jedermann nützlich sein kann. Wann ist der Rahmen moralisch? Homann bettet seine Konzeption in eine Hobbessche Vertragstheorie ein.[8] Diese besagt, wenn man sie auf die Moral überträgt, dass moralische Regeln (oder „Verträge“) nur zustande kommen, wenn sie dem Eigeninteresse jedes Menschen dienen. Beim Urahn dieses Theorietyps, bei T. Hobbes (Hobbes 1970/2002, Kpt. 13–14), gebe ich mein „Recht“ jemanden zu töten oder zu berauben nur dann auf, wenn ich mir davon selbst einen Nutzen versprechen kann (auch ich werde von den anderen nicht getötet und beraubt). Moral wird völlig auf Eigennutzen zurückgeführt. Mithilfe eines Cartoons lässt sich das wunderbar veranschaulichen. In diesem geben sich zwei Herren im Anzug die Hand und jeder hält hinter seinem Rücken eine steinzeitliche Keule versteckt: Der Vertrag ist nur eine besondere Form der Gewalt. Homann wählt diese Ethik aufgrund des gesellschaftlichen Wertpluralismus . Das heißt, die Menschen sind sich über Werte heutzutage nicht mehr einig. Daher kann man Homann folgend nur auf einem von allen geteilten, nicht strittigen und nicht moralischen Fundament aufbauen, dem Eigeninteresse (Homann und Blome-Drees 1992, 22, 167ff.; Homann 2005, 205).[9] Homann geht davon aus, dass der Rahmen in einem bestimmten Sinne moralisch sein muss, um |14|eine optimale Verwirklichung des je eigenen Vorteils zu garantieren: „Der Mensch erlegt sich autonom per kollektiver Selbstbindung die moralischen Regeln auf – um größerer Vorteile willen und aus keinem anderen Grund.“ (Homann 2003, 174) Nur wenn die Rahmenordnung zum wechselseitigen Vorteil aller (d.h. „moralisch“ im Sinne der ökonomischen Ethik) ist, werden der individuelle Vorteil und der soziale Friede als Bedingung für bessere Geschäfte gewahrt (Homann und Blome-Drees 1992, 85; Homann 2003, 176).[10] Um die Moralität des Rahmens und des gesamten Wirtschaftssystems zu sichern, wenden Homann und Blome-Drees ein scharfes Konsenskriterium an: Jedes Mitglied der Gesellschaft und genau genommen jeder Vertragspartner des Welt-Gesellschaftsvertrags (Homann 2003, 176) müssen der durch den Rahmen vorgegebenen Wirtschaftsordnung im Prinzip zustimmen können (Homann und Blome-Drees 1992, 54ff.). Sonst ist das Wirtschaftssystem eben keines zum wechselseitigen Vorteil aller (Homann 2003, 171). Jeder nicht berücksichtigte Akteur droht das gesamte System der Kooperation zu beenden, indem er bei geeigneten Dilemmastrukturen alle anderen zwingen kann, die Kooperation aufzugeben und Gegenausbeutung zu betreiben (Homann und Suchanek 2000, 425).
Zustimmung aller zu einer Ordnung, die dem Einzelnen auch Opfer auferlegt, wenn er arbeitslos wird, kann nur die Ausweitung der Marktwirtschaft zur sozialen Marktwirtschaft garantieren (Buchanan 1975/1984, 91). Durch Sozialleistungen wird die Zustimmung zum System „erkauft“, denn in der sozialen Marktwirtschaft wird es den Schlechtestgestellten – frei nach Adam Smith (Smith 1989/2009, 58) – immer noch bessergehen als den Schlechtestgestellten in anderen Wirtschaftssystemen (Homann und Blome-Drees 1992, 58f.). Daher gibt es ein Recht auf Sozialleistungen. Nur so wird das System als eines ausweisbar, das den wechselseitigen Vorteil vermehrt, d.h. nur so wird das Grundsystem ein moralisch gerechtfertigtes. Anders formuliert, darf die Wirtschaft nicht zu (unkompensierten) Lasten Dritter gehen (wie etwa im Falle der Korruption) (Suchanek 2007, 43), denn dann würden diese „Dritten“ den Konsens zu Recht aufkündigen. Allerdings darf auch nicht gefordert werden, das Eigeninteresse irgendeines Akteurs zu opfern, um die Interessen Dritter zu wahren. Auch dann ist der Kon|15|sens mit diesem Akteur bzw. die Vertragsgrundlage des wechselseitigen Vorteils hinfällig.[11]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Wirtschaftsethik und Menschenrechte»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Wirtschaftsethik und Menschenrechte» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Wirtschaftsethik und Menschenrechte» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.