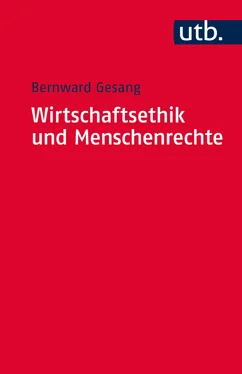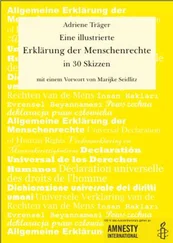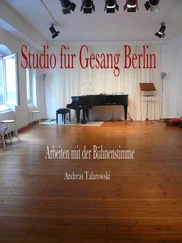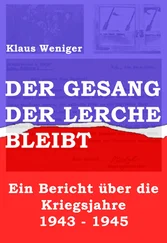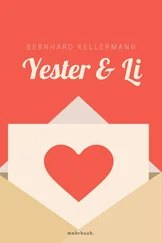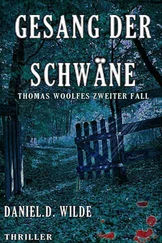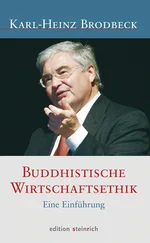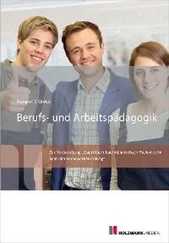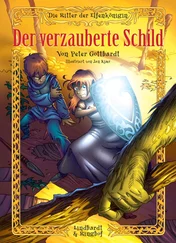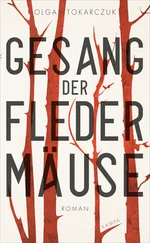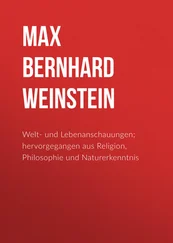Bernward Gesang - Wirtschaftsethik und Menschenrechte
Здесь есть возможность читать онлайн «Bernward Gesang - Wirtschaftsethik und Menschenrechte» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Wirtschaftsethik und Menschenrechte
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Wirtschaftsethik und Menschenrechte: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Wirtschaftsethik und Menschenrechte»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Wirtschaftsethik und Menschenrechte — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Wirtschaftsethik und Menschenrechte», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Es gibt viele Indizien dafür, dass viele aktuell lebende Bürger der Staaten der „dritten Welt“ nicht von der Marktwirtschaft profitieren bzw. von ihr geschädigt werden. Lokale Märkte werden durch internationalen Freihandel ruiniert, insbesondere in Afrika, wo kein sozialer Ausgleich stattfindet, der die Zustimmung zum Wirtschaftssystem schaffen würde.[17] Das ist ein Problem für die Vertragstheorie, denn diese Betroffenen sind, anders als zukünftige Lebewesen, nach ihren eigenen Maßstäben Vertragspartner im Weltgesellschaftsvertrag und sind daher jedenfalls zu berücksichtigen. Alternativ muss man vertreten, dass nicht alle Betroffenen, sondern nur besonders mächtige Vertragspartner relevant sind – ein eklatanter Widerspruch zur Definition von Moral, der den egozentrischen und den nationalen Wirtschaftszweck prägt und diskreditiert.
Das alles soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir heutigen Bewohner der Industrienationen der Marktwirtschaft sehr viel verdanken. Davon aber auf das gesteigerte Wohl jedes Einzelnen zu schließen, ist verkürzt. Allerdings kann eine marktwirtschaftliche Ordnung angesichts der Aufgabe, die Erfüllung der Bedürfnisse in Massengesellschaften zu koordinieren, derzeit als alternativlos gelten (vgl. die Einleitung).
Es ist jedoch eine offene Frage, ob sich die Marktwirtschaft angesichts der ökologischen Bedrohungen der Zukunft als Erfolgsmodell erweist (vgl. Kpt. 3). Dass die Rahmenordnung die drohenden Katastrophen, z.B. des Klimawandels, aufhalten kann, ist derzeit unwahrscheinlich und unsere Art zu wirtschaften, verursacht diese existentiellen Gefahren. Diese Wirtschaftsweise bewirkt zudem, dass Staaten als Akteure geschwächt werden, weshalb es in Zeiten der Globalisierung als schwierig erscheint, mit der ökonomischen Ethik auf von Staaten durchgesetzte Rahmenordnungen zu setzen. Sicher hat die Marktwirtschaft dafür gesorgt, dass es vielen Bewohnern der Industrienationen |23|besser geht als denen vor 65 Jahren. Aber wenn die Marktwirtschaft über die Klimakatastrophe oder über atomare Verseuchung zu einer Verelendung der Menschheit führt, dann vernichtet sie das Wohl vieler einzelner Individuen und letztlich auch in der Summe mehr Nutzen, als sie geschaffen hat. So würde dann manche spontane Zustimmung zur Marktwirtschaft zurückgezogen werden, wenn diese Wirtschaftsform langfristig als gegen die wahren Präferenzen nicht nur einiger, sondern vieler Betroffener verstoßend entlarvt würde. Marktwirtschaft ist also kein Weltbeglücker, sondern eine lebensgefährliche Notwendigkeit , die nicht automatisch auf den Konsens aller Betroffenen setzen kann.
Zusätzlich muss man fragen, ob Konsum und das marktwirtschaftliche, auf Wachstum ausgerichtete System wenigstens alle Menschen in den reichen Ländern der „ersten Welt“ weiter glücklich machen. Dabei setze ich voraus, dass „Glück“, „Wohlergehen“ oder „Lebenszufriedenheit“, für wen auch immer, Ziel des Wirtschaftens sind. Bezüglich eines linearen Zusammenhangs von Glück und Wohlstand lehrt die empirische Glücksforschung seit Jahrzehnten Skepsis (Diener und Seligman 2004). Das sogenannte „Easterlin-Paradox“ sorgt für Irritationen: Wenn die Existenz gesichert ist, führt mehr Einkommen nicht automatisch zu mehr Glück (Clark et al. 2008).[18] Jedenfalls kann durch manche Teile der Glücksforschung der Befund erhärtet werden, dass Marktwirtschaft und Wachstum nicht einmal alle Bürger der „ersten Welt“ wirklich glücklich machen. Im Gegenteil, sie kosten diese vieles, was sie glücklicher machen würde (Muße, echte persönliche Bindungen etc.). Also liegt auch hier Potenzial dafür bereit, dass Betroffene der marktwirtschaftlichen Ordnung nicht den Segen erteilen werden. Sollte die Vertragstheorie darauf reagieren, indem sie auch einige mächtige Vertragspartner ignoriert? Was ist die Idee vom Konsens aller dann noch wert? Damit betrachte ich mein zweites Beweisziel als eingelöst: die These, dass ein Konsens aller über die Marktwirtschaft nicht wahrscheinlich ist (vgl. Gesang 2011, 3. Kpt.). Das gilt selbst wenn die Individuen immer dem zustimmen, was zu ihrem Vorteil führt. Ob es auch andere Formen der Marktwirtschaft geben könnte, die konsensfähiger sind, bleibt Spekulation. Jedenfalls beziehen wir uns mit der ökonomischen Ethik auf die heutige soziale Marktwirtschaft.
Die Befunde der Glücksforschung belegen die allgemeinere These, dass die ökonomische Ethik die wahren, aufgeklärten Präferenzen der |24|Individuen aus den Augen verliert, welche die Glücksforschung z.T. ausführt. Die aufgrund des Konsenskriteriums der Vertragstheorie notwendige Zustimmung jedes Einzelnen zur Wettbewerbswirtschaft wird also noch fragwürdiger, wenn man von den voll informierten Präferenzen der Vertragsparteien ausgeht. Die ökonomischen Ethiker denken hingegen, dass gerade Aufklärung Zustimmung zur Marktwirtschaft schaffe. Aufklärung zeige, dass Marktwirtschaft die Interessen eines HO erfülle, die letztlich jeder habe („wenn’s um die Wurst gehe“). Aber dass diese HO-Präferenzen nicht immer die wahren Präferenzen der Individuen sind, werden wir im Folgenden weiter vertiefen.
VII. Ist Dagobert Duck der Held der Moderne?
Bevor näher auf den HO eingegangen werden kann, ist zunächst eine problematische Annahme der ökonomischen Ethik zu diskutieren: Die Annahme, dass der Wettbewerb derartig scharf sei, dass Unternehmen, die nicht in jedem Augenblick Gewinne maximieren, aus dem Markt ausscheiden müssten (Homann und Blome-Drees, 1992, 34).[19] Dabei verwechselt die ökonomische Ethik allerdings Modell und Wirklichkeit (dazu auch: Sautter 1994, 67). Diesen Vorwurf muss man dieser Ethik ganz allgemein machen. Unsere Marktwirtschaft wird de facto an so vielen Stellen eingeschränkt, dass das Vorgehen der ökonomischen Ethik, erst vom idealen Rahmensystem und vom idealen Wettbewerb auszugehen und dann Störfälle zu behandeln, wie eine Lehrbuchweisheit erscheint, die mit der Realität wenig zu tun hat. Die Wirklichkeit beschreibt der Ökonom N. Stern sehr gut, wenn er zahlreiche Gründe für Marktversagen anführt, etwa unvollständige Informationen, unvollkommene Kapitalmärkte, politische Eingriffe, nicht repräsentierte Konsumenten etc. (Stern 2009, 101). Diese Faktoren sind nicht etwa temporäre Übergangserscheinungen auf dem Weg hin zum perfekten Markt, sondern es gibt keine empirische Begründung, nach der sie sich als vorläufig erweisen würden. Zum Teil liegen sie im Wesen des Menschen begründet.
Die strikten Wettbewerbsbedingungen, von denen die ökonomische Ethik ausgeht, werden durch zahllose Gegenbeispiele in Frage gestellt |25|(Kimakowitz et al. 2011, 1f; Diercksmeier 2014, 60f).[20] So konnte ein Marktführer wie Levi-Strauss sehr wohl häufiger zugunsten ethischer Standards auf Gewinne verzichten (Shaw 2005, 178–182). Ebenso sind Unternehmen wie SAP, BASF und Danone zu nennen, die sich explizit Social-Business-Projekten verschrieben haben, bei denen die erwirtschafteten Profite zurück in das jeweilige soziale Projekt fließen. Hier ist unklar, ob sich das durch Know-How-Gewinne oder neue Vertriebsstrukturen für besondere Märkte gegenrechnen lässt. Banken, die sämtliche Dienstleistungen anhand von Nachhaltigkeitskriterien neu strukturieren (zum Beispiel ABN Amro Real oder die Triodos Bank), entlarven den Mythos der Wettbewerbszwänge ebenso. Sämtliche Fälle von Fehlmanagement und Verschwendung (nicht zuletzt bei Vorstandsgehältern und Abfindungen vgl. Kpt. 5. VI) durch Unternehmen, die diese Vorfälle überlebt haben, sind zu ergänzen. Daher meine These: Unternehmen, können – begrenzt – Normen umsetzen, die langfristige Gewinneinbußen bedeuten. Das zeigt, dass man auch auf Märkten nicht immer als HO handeln muss, wenn man überleben will.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Wirtschaftsethik und Menschenrechte»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Wirtschaftsethik und Menschenrechte» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Wirtschaftsethik und Menschenrechte» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.