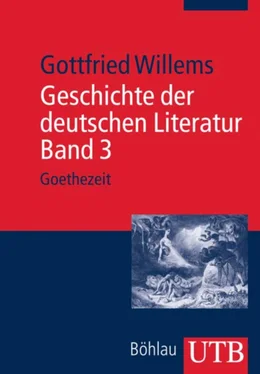1 ...6 7 8 10 11 12 ...22 Französische Revolution
Eben gegen solche Verhältnisse sind die Männer der Französischen Revolution 20seit 1788/89 angetreten, um dem Prinzip der „Volkssouveränität“ Geltung zu verschaffen. Nicht der Fürst, sondern das Volk sollte nun als Souverän fungieren; alle Macht sollte vom Volke ausgehen. Dieser Grundsatz sollte mit Hilfe von Verfassungen durchgesetzt werden, die die Macht an Wahlämter knüpften; sie sollte sich in Volkswahlen legitimieren müssen. Damit zog die Französische Revolution auf ihre Weise die Konsequenzen aus dem Denken der Aufklärung und den Erfordernissen der Modernisierung, aus dem aufklärerischen Prinzip der Emanzipation von der Autorität der Tradition, wie er aller Modernisierung zugrunde liegt, und dem aufklärerischen
[<< 36]
Gedanken der allgemeinen Menschennatur, der natürlichen Gleichheit aller Menschen.
„Terreur“ und Revolutionskriege
Mit solchen Neuerungen verwickelte sich der Französische Staat – vor allem nachdem er sich 1792/93 seines Königs Ludwigs XVI. entledigt und in eine Republik verwandelt hatte – in Konflikte mit den alten Monarchien um Frankreich herum. Hinzu kam, daß die revolutionären Kräfte mehr und mehr aus dem Ruder liefen und bürgerkriegsähnliche Zustände heraufführten, die schließlich in die „Terreur“, das Schreckensregime der Jakobiner einmündeten, mit Massenhinrichtungen in Paris und in der französischen Provinz. Die alten Mächte schlossen sich in Koalitionen gegen Frankreich zusammen, um die Revolution einzudämmen, wo nicht vollends aus der Welt zu schaffen. So wurden die Jahre von 1792 bis 1815 zu einer Zeit immer wieder neu aufflammender Kriege, mit einer Militärmaschinerie, wie sie die Menschheit bis dahin noch nicht gesehen hatte. Denn auch das Militär hat sich damals modernisiert. So wurde nun durch einen Revolutionär namens Barras in Frankreich die allgemeine Wehrpflicht eingeführt; deshalb geht man noch heute „zum Barras“, wenn man Soldat wird. Riesige Heere zogen kreuz und quer durch Europa, von Holland bis Italien und von Spanien bis Rußland, und das hieß naturgemäß zunächst einmal: sie zogen kreuz und quer durch Deutschland.
Das erste große Treffen in diesen Kriegen war die Schlacht bei Valmy (1792), in der sich das revolutionäre Frankreich ein erstes Mal gegen die Koalition der alten Mächte behaupten konnte. Goethe hat diese Schlacht aus nächster Nähe miterlebt; sein Herzog Carl August, der im Nebenamt auch ein preußischer General war, hatte ihn auf den Feldzug mitgeschleppt. Goethe will dabei den Anbruch eines neuen Zeitalters gespürt haben, wie wir aus einer seiner autobiographischen Schriften, der „Campagne in Frankreich“ (1822) wissen, einer ausführlichen Schilderung jener ersten kriegerischen Verwicklung der Revolutionszeit.
Deutsche Jakobiner
Nichts hat seinerzeit die Gemüter so sehr beschäftigt wie die Französische Revolution. 21Das gilt natürlich auch für die Schriftsteller, und
[<< 37]
es gilt ausnahmslos für einen jeden von ihnen. Über der permanenten Auseinandersetzung mit den Vorgängen in Frankreich vollzieht sich – vereinfacht gesprochen – eine Spaltung des intellektuellen Deutschland in drei Parteien. Eine erste Gruppe umfaßt alle die, die von Verfechtern der Aufklärung zu Anhängern der Revolution werden und die deutschen Verhältnisse nach dem französischen Vorbild umgestalten wollen, die deutschen Jakobiner. 22Jakobiner nannte man zunächst die Mitglieder eines bestimmten politischen Clubs im revolutionären Paris, einer Art politischer Partei, zu der sich die Radikalen unter den Revolutionären zusammenschlossen; ihr Wortführer war der berühmt-berüchtigte Maximilien de Robespierre (1758–1794). Später bedachte man auch alle anderen Anhänger einer radikalen Revolution mit dem Namen „Jakobiner“.
Politische Romantik
Seht euch das revolutionäre Frankreich nur genau an!, hält eine zweite Gruppe von Intellektuellen dagegen; da kann man studieren, was bei all der Aufklärerei letztlich herauskommt, wohin es führt, wenn man wie die Aufklärer mit der Autorität der Tradition bricht, altehrwürdige Institutionen, Dogmen und Normen verwirft, sogar die Religion und die Kirche in Frage stellt und nur noch auf die Natur und das Naturrecht setzt – das Ergebnis sind Chaos, Terror und Krieg. Deshalb weg mit der Aufklärung, zurück zu den alten Ordnungsstrukturen, zu Monarchie, Adelsherrschaft, Ständegesellschaft, Religion und Kirche! Dieses Denken entfaltet sich vor allem im Raum der Romantik, genauer: im Raum einer politisierten Romantik, also noch nicht so sehr in der Jenaer Frühromantik, erst in der Hoch- und Spätromantik, soweit sie über poetische Konzepte hinaus zu politischer Programmatik übergeht. 23Die romantische Verherrlichung des Mittelalters, der mittelalterlichen Frömmigkeit und der alten Ritterherrlichkeit ist mithin keineswegs eine Ausgeburt allein des poetischen Sinnes; sie hat einen politischen Unterton, den man nicht überhören darf.
Das antirevolutionäre und gegenaufklärerische Denken dieser zweiten Gruppe von Intellektuellen geht bald schon eine eigentümliche Verbindung mit dem neuen Nationalismus ein, der doch eigentlich zum
[<< 38]
ideologischen Repertoire der Jakobiner gehört. Es entsteht die Vorstellung, das Gedankengut der Aufklärung sei den Deutschen eigentlich immer wesensfremd geblieben, die deutsche Aufklärung sei im Grunde das Ergebnis einer Überfremdung der deutschen Verhältnisse durch den französischen Geist gewesen – und so viel ist daran immerhin richtig, daß die Impulse der Aufklärung, nachdem sie zunächst vor allem von England und Schottland ausgegangen waren, zuletzt mehr aus Frankreich nach Deutschland gelangt waren. Die Aufklärung, so heißt es nun, sei das Werk einer oberflächlichen Vernünftelei gewesen, eines oberflächlichen Rationalismus, der den Deutschen nie wirklich etwas hätte bedeuten können, denn der Deutsche sei seinem Wesen nach auf Tiefe hin angelegt, er neige zu metaphysischem und religiösem Tiefsinn; der Deutsche sei nicht aufgeklärt, sondern tiefsinnig. Hier der deutsche Tiefsinn – da der oberflächliche Rationalismus, die „instrumentelle Vernunft“ des aufgeklärten Frankreich.
Aufklärung „trotz alledem“
Zwischen diesen beiden Gruppen, den radikalen Anhängern und den radikalen Gegnern von Aufklärung und Revolution, hält sich eine dritte Gruppe, für die Aufklärung und Französische Revolution keineswegs ein- und dasselbe sind, auch wenn sich die Revolutionäre natürlich immerzu auf die Aufklärung berufen haben, insbesondere auf den großen Aufklärer Rousseau. Hier bekennt man sich zu einer Aufklärung „trotz alledem“, will man an den Prinzipien der Aufklärung auch und gerade angesichts dessen festhalten, was während der Revolution an Schrecklichem geschehen ist.
Zu dieser Gruppe gehören die meisten der namhaften deutschen Autoren, allen voran die Weimarer Größen: Wieland, Goethe, Herder, Schiller. Sie wollen in der Französischen Revolution nicht so sehr die logische Folge und Vollendung der Aufklärung sehen denn vielmehr einen überstürzten Versuch zur Umsetzung ihrer Ziele, einen Versuch, der wegen der Ungeduld und Radikalität der Revolutionäre drauf und dran sei, alles zu verderben, was die Aufklärung auf den Weg gebracht hatte. Die Französische Revolution gilt hier nicht als Vollendung, sondern als Desavouierung der Aufklärung, als eine Blamage, die man um so heftiger empfindet, je mehr man sich mit den Zielen der Aufklärung identifiziert.
Hier heißt Aufklärung mithin Reform und nicht Revolution; hier glaubt man, daß der aufgeklärte Kopf, gerade weil er sich am Vorbild
[<< 39]
der Natur orientiere, nicht auf den radikalen Bruch mit dem Alten setzen könne, sondern das Neue, Bessere immer nur im Zuge einer „organischen Entwicklung“ anstreben werde; daß er nicht in spektakulären geschichtlichen Aktionen die Erlösung der Menschheit von allem Übel suche, sondern in der geduldigen Arbeit an vielen kleinen Entwicklungsschritten auf pragmatische Lösungen ausgehe. Der Aufklärer, so denkt man hier, sucht immer den Mittelweg und meidet Extremismus und Radikalismus; er wirft das Alte nicht einfach über Bord, sondern weiß es differenziert zu würdigen, verwirft nur, was er als unfruchtbar erkennt, und sucht die produktiven Momente der Tradition weiterhin zu nutzen. Und in der Tat: mit dieser Sicht der Dinge ist diese dritte Gruppe von Intellektuellen näher bei der Aufklärung des 18. Jahrhunderts als die Radikalen unter den Revolutionären in Frankreich.
Читать дальше