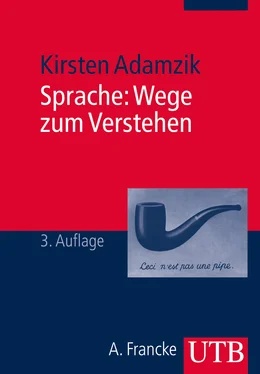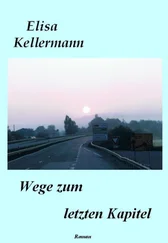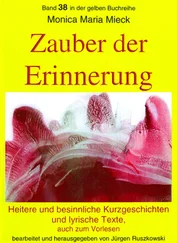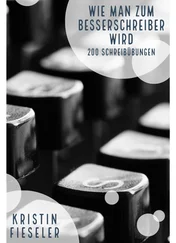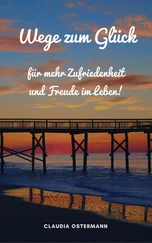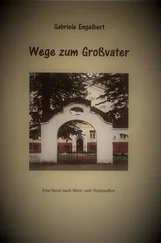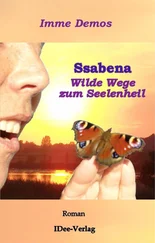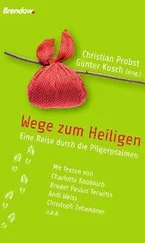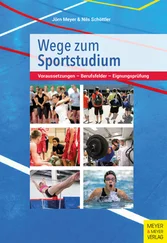Die Relativität der Grenze zwischen Homonymie und Polysemie
Mitunter haben sich die Dinge derartig stark verändert, dass eine Rekonstruktion der früher mehr oder weniger offenkundigen Ähnlichkeit nicht mehr unmittelbar möglich ist. In diesen Fällen würde man dann das Vorliegen von Homonymie rekonstruieren. So ist es z.B. für viele schwer einsehbar, was das Gemeinsame an einer serrure und einem château sein soll; für Schloss werden dementsprechend zwei unabhängige Lexeme rekonstruiert. Für andere gehören jedoch beide Bedeutungen klar zum Verb schließen, denn bei dem Gebäude Schloss hatte man zunächst eine befestigte Burg vor Augen, in der man sich vor Eindringlingen schützen, sich abschließen konnte. Erst später bauten sich die Mächtigen besonders prunkvolle und repräsentative Gebäude, die keineswegs mehr einen besonderen Schutz nach außen bieten. Wer diese Verbindung sieht, rekonstruiert demnach ein Lexem mit mehreren Lesarten.
|61◄|
|►62|
11 Wortbedeutungen im Bewusstsein der Sprecher
Können wir nun sagen, dass die eine oder die andere Lösung die richtige ist? Welche Aufgabe hat der Wörterbuchschreiber, der Lexikograf? Soll er erklären, wie es zu der Bedeutungsvielfalt von Lexemen (Polysemie) und zu verschiedenen Lexemen mit identischem signifiant (Homonymie) gekommen ist, oder ist es nur wichtig festzuhalten, welche Lexeme gegenwärtig konventionell in welchen Bedeutungen gebraucht werden? Die Frage stellt sich um so mehr, als es ja in der parole ständig zu neuen Bedeutungsübertragungen kommen kann. Wer z.B. seinen Computer nur zu Textverarbeitungszwecken benutzt (und das waren einmal viele!), für den könnte es durchaus naheliegen, ihn als Schreibmaschine zu bezeichnen. Soll man deswegen für das Lexem Schreibmaschine eine Lesart ›Computer, der nur mit einem Textverarbeitungsprogramm ausgestattet ist‹ rekonstruieren? Schließlich haben wir auch eine elektronisch unter einem bestimmten Namen gespeicherte Datenmenge schon als Dokument bezeichnet, als etwa das Duden Universalwörterbuch in diesem Zusammenhang nur die Lesarten ›Urkunde, amtliches Schriftstück‹ und ›Beweisstück, Zeugnis‹ vorsah, was ja nicht auf Computerdokumente passt. Inzwischen ist auch die folgende Variante verzeichnet: ›(EDV) strukturierte, als Einheit erstellte u. gespeicherte Menge von Daten; [Text]datei‹.
Synchronie und Diachronie im Wörterbuch
Bei der Beantwortung der Frage, was denn nun die Aufgabe des Lexikografen, oder allgemeiner: der Sprachwissenschaft, ist, sollten wir noch einmal an Saussures Überlegungen zurückdenken. Nach seiner Auffassung geht es in der Linguistik der langue um die Rekonstruktion des Sprachsystems zu einem gegebenen Zeitpunkt (Synchronie). Wie die Verhältnisse früher einmal waren – die Diachronie also – ist für die Rekonstruktion des Systems irrelevant. Folgt man dieser Auffassung streng, so sind irgendwelche Erklärungen sprachlicher Phänomene, für die man erst auf frühere Sprach- und Weltzustände zurückgreifen muss, für die Rekonstruktion des Systems ohne Bedeutung. Viele konkrete Entscheidungen bei der Beschreibung einer Einzelsprache, wie man sie etwa in Wörterbüchern und Grammatiken findet, werden denn auch tatsächlich mit dem synchronen Standpunkt begründet: Wenn eine Beziehung synchron nicht mehr einsehbar ist, wird sie nicht als Gegebenheit des Systems gerechnet. So betrachten wir z.B. den Ausdruck Eltern als nicht weiter analysierbares Lexem, obwohl er natürlich historisch mit alt-älter-(die) Älter(e)n zusammenhängt; aber tatsächlich dürfte heutzutage bei Eltern kaum jemand an diese Verbindung denken. Synchron ist die Beziehung also nicht mehr gegeben, das Lexem erscheint unmotiviert. So wird es auch verständlich, dass heutzutage (vor allem jugendliche) Sprecher ihre Eltern auch als meine|62◄ ►63| Alten bezeichnen, d.h. dass sie auf ein Lexem zurückgreifen, in dem wieder neu die relative Motiviertheit hergestellt ist.
Etymologische Wörterbücher
Die Aufdeckung synchron nicht mehr unmittelbar einsichtiger Beziehungen erleichtert uns aber das Lernen der Sprache und fördert unser Verständnis für ihr Funktionieren. Tatsächlich interessiert viele Sprachteilhaber an linguistischer Arbeit ganz besonders dieser Aspekt. Sie fragen: Wo kommt dieser Ausdruck her, wie kommt es zu dieser Bedeutung? Sie empfinden offenbar Vergnügen und Befriedigung, wenn sie erkennen können, dass etwas, was auf den ersten Blick arbiträr erscheint, doch relativ motiviert ist. Auch die Sprachwissenschaftler haben die diachrone Fragestellung natürlich nie ganz aus dem Auge verloren. Wir können also die Frage nach den Aufgaben der Lexikografen zunächst mit dem Hinweis auf eine Arbeitsteilung beantworten: Die diachron orientierte Linguistik beschäftigt sich mit der Frage nach der Entwicklung von Sprachen. Auf lexikografischem Gebiet fasst sie ihre Ergebnisse in etymologischen oder Herkunfts-Wörterbüchern zusammen, die auch für an Sprachfragen interessierte Laien aufschlussreich sein können. Die synchron orientierte Linguistik versucht dagegen, das Funktionieren eines sprachlichen Systems zu einem gegebenen Zeitpunkt zu beschreiben und vernachlässigt dabei die Frage nach dem Sprachwandel. In synchron orientierten Wörterbüchern (für die heutige Zeit also: Wörterbüchern der Gegenwartssprache) braucht sie nur die konventionellen Lexemverwendungen aufzubereiten, die im Augenblick geläufig sind. Solche Beschreibungen sind daher für Sprachteilhaber relevant, die vor allem wissen wollen, welche Konventionen im Moment gültig sind.
Die historische Tiefe des sprachlichen Wissens
Allerdings lassen sich beide Orientierungen dennoch nicht ganz scharf voneinander trennen. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass die Rekonstruktion des synchronen Systems ja letzten Endes der Versuch ist, das sprachliche Wissen der Sprachteilhaber, also eine psychische Größe, zu rekonstruieren. Nun hat jedoch das sprachliche Wissen jedes einzelnen immer eine gewisse historische Tiefe. Wer schon 1920 gehört und gelesen hat, kennt selbstverständlich noch viele Lexemverwendungen, die heute ganz ungebräuchlich sind, und vielleicht kennt er viele nicht, die erst in neuester Zeit aufgekommen sind, weil er z.B. kaum mit jungen Leuten kommuniziert. Auch das Bewusstsein für bestimmte Zusammenhänge, die Motiviertheit von einzelnen Lesarten etwa, verschwindet in der Sprachgemeinschaft nicht plötzlich, sondern nur allmählich und kann überdies – z.B. durch etymologische Erläuterungen – auch immer wieder (re-)aktiviert werden. So kommt es dazu, dass manche Menschen den Zusammenhang zwischen den Lesarten von Schloss oder zwischen Eltern und alt erkennen und andere nicht. Außerdem werden sich manche für solche Zusammenhänge interessieren und andere nicht.
|63◄ ►64|
Jeder Wörterbuchschreiber muss daher immer gewisse Kompromisse machen. Das Wörterbuch, aus dem wir unsere beiden Eingangsbeispiele entnommen haben, ist ein vor allem synchron orientiertes. Trotzdem führt es am Anfang der Einträge auch etymologische Erläuterungen an und greift hier und da auf historische Erklärungen zurück, z.B. wenn der Ausdruck Sack Zement als Entstellung aus Sakrament erklärt wird oder die Hintergründe für den Ausdruck der Weiße Sonntag aufgedeckt werden. Dies entspricht Zugeständnissen an den Tatbestand,
Ein synchroner Schnitt betrifft nicht einen Zeitpunkt, sondern einen größeren Zeitraum
dass ein wirklich synchroner Schnitt, die Momentaufnahme einer Sprache (z.B. Deutsch am 17.9.1998, 11 Uhr 50) ohnehin gar nicht möglich und auch nicht sinnvoll ist. Wie schnell sich nun allerdings die sprachlichen Verhältnisse wirklich ändern, ist außerordentlich schwer zu sagen. Leicht festzustellen ist hingegen, dass die Wörterbücher alle paar Jahre neu herausgegeben werden. Ist das eigentlich notwendig, muss man ständig das neueste haben, geht es dabei nur um Änderungen in der Orthografie, die die Diskussion im letzten Jahrzehnt ja beherrscht haben?
Читать дальше