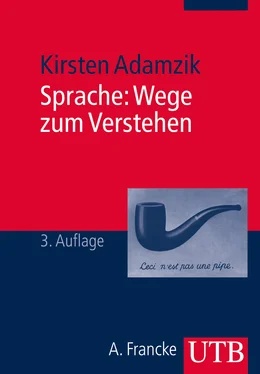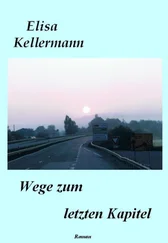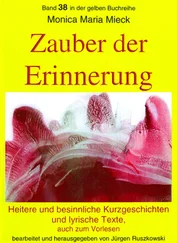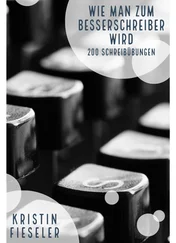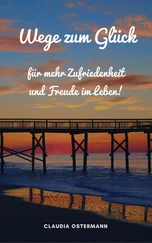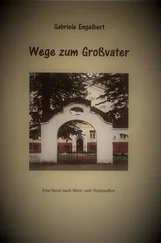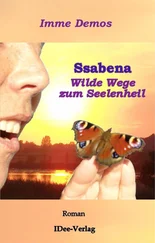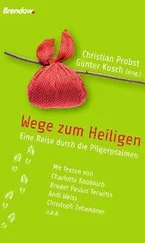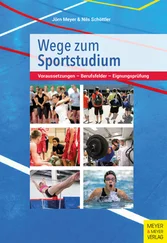Das Textbeispiel 11 habe ich aus dem Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in sechs Bänden entnommen, das im Jahre 1981 vollständig vorlag. Die 2. Auflage erschien in acht Bänden (1995), die 3. in zehn Bänden liegt seit 1999 vor. Wächst die deutsche Sprache so schnell und zunehmend rasant, dass man alle zwei Jahre einen neuen Band füllen kann? Schauen wir uns am Beispiel etwas genauer an, welche
Veränderungen beim Eintrag Sack
Veränderungen vorgenommen wurden: Der Eintrag zu Sack ist in der neuesten Version etwa doppelt so lang wie 1980 (in diesem Jahr erschien der 5. Band mit der Buchstabenstrecke O-So). Eine echte Neuigkeit in der Wirklichkeit ist der gelbe Sack, der erst mit dem dualen System der Müllbeseitigung in den 1990er Jahren auch als komplexes Lexem in die Welt kam, so dass erst in den Neuauflagen erklärt werden konnte: ›gelber Plastiksack, in dem recycelbare Wertstoffe gesammelt werden‹.
Alle anderen Änderungen beruhen meiner Einschätzung nach nicht auf Sprach- und/oder Weltwandel, sondern auf veränderten Prinzipien oder Entscheidungen der Wörterbuchmacher. Die wesentlichste, d.h. diejenige, die zu einer so bedeutenden Umfangserweiterung führt, besteht darin, dass viel großzügiger nicht nur Beispielsätze, sondern auch authentische Verwendungen, Belege also, aufgenommen werden, z.B.:
»Nachdem er als Moderator von ›Show u. Co. mit Carlo‹ … in den S. gehauen hat [Hörzu 19, 1986, 5]«,
»Zusatzlichter mit Batterie … lassen sich abnehmen und in den S. stecken (Basler Zeitung 2.10.1985, 27)«.
Häufiger geworden sind auch die Erklärungen zur (eventuellen) Herkunft von Phraseologismen: jemanden in den Sack stecken » geht wohl auf |64◄ ►65| eine frühere Art von Wettkampf zurück, bei der der Besiegte vom Sieger tatsächlich in einen Sack gesteckt wurde«. Die Wendung in Sack und Asche gehen erfährt folgende Erläuterung: »wohl nach dem Alten Testament [Esther 4, 1], wo von dem altorientalischen Brauch berichtet wird, dass die Menschen sich zum Zeichen der Trauer in grobes Tuch [Säcke] kleideten u. sich Asche auf die Haare streuten«. Auch die eigentliche Bedeutung des griechischen sákkos ist neu hinzugekommen: »= grober Stoff aus Ziegenhaar; (aus solchem Material hergestellter) Sack«.
Als eine gewisse Selbstkorrektur betrachte ich die Aufnahme zusätzlicher Fügungen, die man 1980 wohl vergessen bzw. für nicht so wichtig gehalten hatte. Schon länger gehören jedenfalls die folgenden Verwendungen zur deutschen Sprache:
das Kleid sitzt, sieht aus wie ein S. (ist unförmig, schlecht geschnitten); lieber einen S. [voll] Flöhe hüten als … (… ist eine kaum zu bewältigende Aufgabe): lieber einen S. [voll] Flöhe hüten als diese drei Kinder [zu] beaufsichtigen.
Nicht sicher bin ich mir bei angeben wie ein, zehn Sack Seife, was eine saloppe Ausdrucksweise mit der Bedeutung ›sehr prahlen‹ sein soll, die mir noch nicht begegnet ist.
Als Korrektur muss man auch betrachten, dass der dritte Unterfall der ersten Lesart, nämlich ›Geldbeutel‹ entfallen ist und keinen Pfennig im Sack haben jetzt auf die Tasche im Kleidungsstück bezogen wird (die Anpassung des Beispielsatzes an die neue Währung ist im Universalwörterbuch seit 2003 vorgenommen).
Ob es sich um Sprachwandel oder eine veränderte Einschätzung der Lexikografen handelt, ist mir am wenigsten klar bei einigen Veränderungen, die die Gebrauchsbedingungen betreffen. Während nämlich 1980 die Lesart ›Mann, Mensch‹ als ›derb, meist abwertend‹ bezeichnet wurde, ist sie 1999 nur noch als ›salopp abwertend‹ charakterisiert. Umgekehrt sind jemandem auf den Sack fallen und etwas bzw. eins auf den Sack kriegen nun nicht mehr ›salopp‹, sondern ›derb‹. Aber solche Einschätzungen sind ja ohnehin recht subjektiv.
Das Wörterbuch ist eine Annäherung an das unterschiedliche Sprachwissen vieler Individuen
Dies zeigt am deutlichsten, dass ein Lexikograf auch in anderer Hinsicht die Idealisierung von der langue als einem stabilen und homogenen System zurücknehmen muss.
Wie wir im zweiten Kapitel gesehen haben, umfasst eine Einzelsprache tatsächlich ja verschiedene Varietäten, z.B. landschaftliche, stilistische und soziale. Das Wörterbuch versucht, die Varietäten umfassend zu beschreiben (und gibt damit übrigens ein Sprachwissen wieder, über das kein einziger konkreter Sprachteilhaber wirklich verfügt).
Zusammenfassung
Es sind, so können wir zusammenfassend feststellen, hauptsächlich drei Tatbestände, die dazu führen, dass ein Wörterbuchartikel |65◄ ►66| viel komplizierter ist, als es das einfache Zeichenmodell von Saussure erwarten lässt:
Polysemie Wörter und Wendungen: Idiomatik
– Lexeme haben meist mehrere Lesarten (Polysemie).
– In ihrer Bedeutung konventionalisiert sind nicht nur Einzelausdrücke (von der Größe eines Worts, also Sack und weiß), sondern auch komplexere Ausdrücke, Fügungen wie der Weiße Sonntag, Redewendungen wie in den Sack hauen oder jemandem nicht das Weiße im Auge gönnen, Redensarten oder Sprichwörter wie Den Sack schlägt man, den Esel meint man und schließlich geläufige Sätze wie Ihr habt zu Hause wohl Säcke an den Türen. Auch diese Einheiten haben den Status von Lexemen in dem Sinne, dass sie fest im Lexikon gespeichert sind, d.h. nicht erst im jeweiligen Parole-Akt neu konstruiert werden.
Varietätenspezifik
– Lexeme und deren Lesarten sind zum Teil nur in bestimmten Varietäten der Sprache gebräuchlich. Ihre regional, stilistisch usw. nur begrenzt gültige Verwendbarkeit muss erläutert werden.
|66◄|
|►66|
12 Sprache als Mittel des Denkens: Die Kategorisierung der Welt
Bei der Betrachtung der Bedeutungsbeschreibung in Wörterbüchern waren wir bereits auf die Wichtigkeit der Polysemie von Lexemen für das Funktionieren einer natürlichen Sprache gestoßen. Die Polysemie von Lexemen kommt vor allem dadurch zustande, dass ein Ausdruck, der eigentlich für eine bestimmte Art von Referenten gebraucht wird, auch für ganz andere Referenten verwendet werden kann, die in irgendeiner Ähnlichkeitsbeziehung dazu stehen. Wenn sich ein solcher Gebrauch einbürgert, liegt eine neue konventionalisierte Lesart vor.
Die Vielfalt der außersprachlichen Gegenstände
Schon in einer einzelnen Lesart referiert jedoch ein Lexem potenziell auf Gegenstände, die einander durchaus nicht besonders ähnlich sein müssen. So kann man als Sack sowohl einen großen Behälter aus Jute bezeichnen, in dem z.B. Kartoffeln oder Kohle transportiert werden und der oben zugebunden werden kann, als auch einen großen Sack aus festem Papier (z.B. für Zement), der nicht zugebunden, sondern nur verklebt werden kann, als auch z.B. einen kleinen Plastikbeutel, in dem gerade einmal ein Kilo Mohrrüben Platz hat und der an zwei Stellen auf die gleiche Weise verschweißt ist. In manchen Gegenden des deutschen Sprachraums (in der Schweiz) kann man dann auch noch Plastikbeutel oder Papiertüten, wie sie z.B. in Supermärkten |66◄ ►67| ausgegeben oder verkauft werden, als Säcke bezeichnen. Im Norden würde man dagegen bei der Bitte um einen (Plastik-) Sack wohl auf ziemliches Unverständnis an der Kasse stoßen. Auch wenn jemand von seinem Schweizer Sackmesser oder vom zu geringen Sackgeld spricht, reizt das viele Nordlichter zum Lachen. Bei ihnen heißt es nämlich Taschenmesser bzw. Taschengeld.
Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Gegenständen sind relativ
Nun ist es natürlich nicht so, dass die Norddeutschen nicht in der Lage wären, die große Ähnlichkeit zwischen einer Plastiktüte der Coop und einem kleinen Beutel für Gemüse zu erkennen, denn beide haben miteinander ja wohl mehr gemeinsam als mit dem großen Kartoffelsack. Auch die Ähnlichkeit von solchen Säcken oder Säckchen mit der Hosen- oder Jackentasche kann man nicht als besonders abwegig ansehen, wenn man sogar die Ähnlichkeit zum Tränensack erkennt. Verschieden sind also nicht die kognitiven Fähigkeiten (nämlich Ähnlichkeiten zu sehen), sondern lediglich die sprachliche Strukturierung der Welt.
Читать дальше