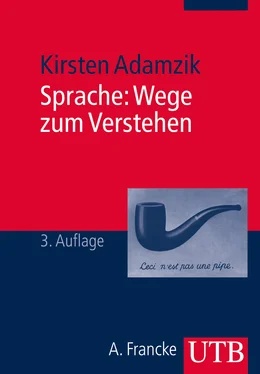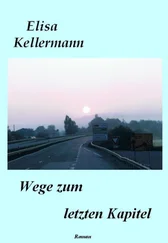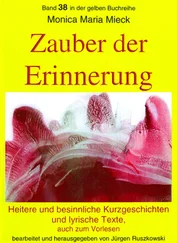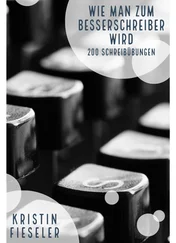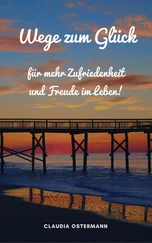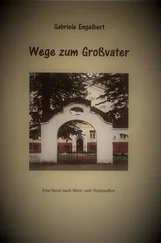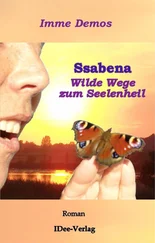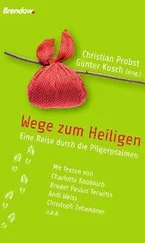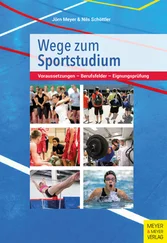Homografie
Wenn die signifiants zweier Zeichen grafisch übereinstimmen, sprechen wir von Homografie; dabei kann zugleich Homophonie vorliegen (livre, weiß) oder nicht: Montage (›lundis‹ – ›montage‹); Druck|erzeugnis (›publication‹) – Drucker|zeugnis (›diplôme d’imprimeur‹); sens (›ich fühle‹ – ›Sinn‹).
Die angeführten Beispiele sind allerdings nicht alle gleich überzeugend, um die These zu stützen, dass jeweils zwei (oder mehr Zeichen) mit denselben signifiants vorliegen, und es ist kein Zufall, dass livres und livrent gar nicht als Eintrag im Wörterbuch geführt werden. Denn |58◄ ►59| es handelt sich ja nur um verschiedene Formen von livre oder livrer.
Lexikalische und grammatische Zeichen zusammengesetzt
Tatsächlich sind livres und livrent zusammengesetzte Zeichen, in denen -s und -nt grammatische Bedeutung tragen. Wir kommen auf diese grammatischen Zeichen später zurück und wollen hier nur eine terminologische Differenzierung einführen, die uns erlaubt, die verschiedenen Fälle auseinanderzuhalten. Dies führt uns auf den Unterschied zwischen langue und parole zurück.
Wort versus Lexem
Ein Äußerungsakt, ein Satz oder ein Text, stellt normalerweise ein komplexes Zeichen dar, in dem mehrere Einzelzeichen miteinander kombiniert sind. Sie sind linear angeordnet. Die Grenzen zwischen den Einzelzeichen werden aber nur zum Teil auch physisch markiert, in der grafischen Realisation etwa durch die Abstände zwischen Wörtern und die Satzzeichen. Bei der lautlichen Realisation können Pausen als Grenzsignale eingesetzt werden. Davon macht man jedoch nur beschränkt Gebrauch, eher zwischen Sätzen oder Satzteilen, kaum zwischen einzelnen Wörtern, und schon gar nicht zwischen den referenziellen und den grammatischen Zeichen, aus denen viele Wörter zusammengesetzt sind. Ein Wort im Text, in der parole, kann also aus mehreren Einheiten der langue bestehen. Wir legen nun fest: Jede Einheit der langue, die eine referenzielle Bedeutung trägt und deren signifié im Wörterbuch erläutert wird, nennen wir Lexem. Die Einheit, die im (geschriebenen) Text durch Abstände von anderen abgegrenzt ist, nennen wir demgegenüber Wort. Das Wort ist eine Einheit der parole, das Lexem eine Einheit der langue. wissen, wusste, gewusst sind daher drei Wörter (Zeichen im Text), sie gehören aber zu einem Lexem (Zeichen der langue, das im Wörterbuch unter der Form wissen geführt wird). weiß, weißer und wissen sind dagegen drei Wörter, die zwei Lexemen zugeordnet werden können, dem Adjektiv (weiß und weißer) oder dem Verb (weiß und wissen).
Verschiedene, aber miteinander zusammenhängende Bedeutungen
Wenn wir uns im Wörterbuch über die Bedeutung eines Zeichens im Text orientieren wollen, kommt es also zunächst darauf an, das richtige Lexem zu identifizieren. Bei dem Beispiel Sack nun scheint nur ein einziges Lexem zu existieren. Dennoch finden wir auch hier in der Wörterbuchbeschreibung mehrere Bedeutungen angeführt. Sie seien hier zusammengefasst und versuchsweise durch französische Entsprechungen umschrieben:
1.
a.›sac‹
b.›poche‹
c.›porte-monnaie, bourse‹
2.??? (injure)
3.›lacrymal‹
4.›testicule‹
|59◄ ►60|
Polysemie Lesarten
Obwohl wir nun davon ausgehen können, dass wir es mit einem einzigen Lexem zu tun haben, ruft der signifiant auch hier nicht genau einen, sondern mehrere – und sehr verschiedene! – signifiés im Geiste hervor. Das Lexem ist offenbar mehrdeutig. Hier handelt es sich nun jedoch nicht (wie bei der Homonymie) um eine gewissermaßen regelwidrige Ausnahmeerscheinung, sondern um den Normalfall. Er wird als Polysemie (›viel-bedeutend‹) bezeichnet. Wie man jedem Wörterbuch schnell entnehmen kann, sind die meisten Lexeme polysem; ihnen sind mehrere Bedeutungsvarianten oder Lesarten zugeordnet, die allerdings irgendwie miteinander zusammenhängen. Der Bedeutungszusammenhang kann enger oder weiter sein, deswegen hat man sich in dem Wörterbuch bei unserem Beispiel für die Unterscheidung von vier Lesarten entschieden, von denen die erste in nochmals enger verwandte Unterlesarten zerfällt.
Bedeutungsübertragung
Es ist auch ganz leicht zu erkennen, warum die Varianten der ersten Lesart enger zusammenhängen; sie fallen nämlich alle unter denselben Oberbegriff. In der Bedeutungsbeschreibung wird er bezeichnet als ›Behältnis‹, d.h. ›ein Gegenstand, in den man etwas hineintun, in dem man etwas verstauen kann‹. Das gilt natürlich für die Lesarten 3 und 4 nicht; es handelt sich dabei ja um Körperteile. Wie kommt es dennoch dazu, dass auch diese Referenten mit dem Ausdruck Sack bezeichnet werden können, und warum sehen wir darin eine Erscheinung der Polysemie, gehen also davon aus, dass diese Lesarten etwas miteinander zu tun haben? Auch die Antwort auf diese Frage ist nicht sehr schwer zu finden: Die Gemeinsamkeit der Referenten, auf die man sich mit dem Zeichen in den Lesarten 3 und 4 einerseits und 1 andererseits bezieht, besteht nicht in ihrer Funktion (Behältnis), sondern in der Form: Tränensäcke und Hodensäcke erinnern an die Form bestimmter Referenten des Lexems in der Lesart 1, nämlich an kleine Beutel, Behältnisse aus einem flexiblen Material, die an sich eigentlich keine fixe Form haben, sondern ihre besondere Gestalt (nach unten breit, ausgebuchtet) dadurch gewinnen, dass man etwas hineintut. Wir haben es hier also mit einer übertragenen Bedeutung zu tun, und der Anlass der Übertragung, das tertium comparationis, ist die Ähnlichkeit in der Form. Selbstverständlich können auch andere Ähnlichkeiten zum Anlass für Bedeutungsübertragungen werden. In einem anderen Wörterbuch der deutschen Sprache, dem Wahrig (Ausgabe 1997), wird dies in der Beschreibung einer Lesart ausdrücklich festgestellt:
etwas mit einem Sack (1) [d.h. in der Lesart 1 = ›länglicher Behälter …‹] Vergleichbares, entweder weil es nur einen Eingang u. keinen Ausgang hat [Sackgasse] oder weil es schlaff oder bauschend hängt.
Freilich sind die Ähnlichkeiten immer nur relativ und nicht unbedingt auf den ersten Blick erkennbar. In unserem Beispiel ist vor allem die |60◄ ►61| Lesart 2, Sack als Schimpfwort in Verbindungen wie alter, fauler, blöder Sack, wohl recht schwer rekonstruierbar. Worin könnte die Ähnlichkeit eines Menschen mit dem Behälter bestehen? Ist es vielleicht die Form (z.B. dicker Bauch) bzw. die Formlosigkeit eines Menschen, der ›sich hängen lässt wie ein Sack‹, d.h. sowohl in der Körperhaltung als auch im moralischen Sinne keine Standfestigkeit, kein Rückgrat hat? Oder ist der Grund für die Übertragung vielleicht darin zu sehen, dass Säcke im Allgemeinen keinen großen materiellen Wert haben? Sie sind typischerweise aus grobem Stoff oder Wegwerfmaterial (Papier, Plastik) gefertigt. Vielleicht spielt auch beides eine Rolle, oder noch etwas anderes?
Die Bedeutung der Sach- und Sprachgeschichte für die Erklärung von Polysemie
Wie man sieht, begeben wir uns mit solchen Fragen auf die Suche nach der relativen Motiviertheit der Anwendung bestimmter Lexeme auf bestimmte Referenten, anders gesagt: Wir versuchen zu rekonstruieren, wie es zu solchen Lexemverwendungen und zu bestimmten Lesarten kommen konnte. Um solche Fragen beantworten zu können, ist es oft nützlich, ja manchmal notwendig, in die Geschichte zurückzublicken, sowohl in die Sach- als auch in die Sprachgeschichte. Wenn z.B. auch ein Portmonnee mit dem Ausdruck Sack belegt wird, so liegt das natürlich am Geldverkehr zu früheren Zeiten. Als es noch kein Papiergeld, sondern nur Münzen gab, trug man diese in mehr oder weniger großen Behältern von sackartiger Form bei sich. Für Geldscheine eignet sich dieser Aufbewahrungsbehälter nicht besonders gut, als Behältnisse kamen also Gegenstände anderer Form in Gebrauch. Sie hatten jedoch noch dieselbe Funktion wie die früheren Geldbeutel oder -säcke, und dies bildet einen hinreichenden Grund für die Beibehaltung des Lexems. Beispiele für solchen Wandel gibt es in Hülle und Fülle; wir führen nur ein zweites an: Schreibgeräte, die auf Deutsch als Bleistifte, auf Französisch als crayons bezeichnet werden, enthalten heutzutage weder Blei (›plomb‹) noch Kreide (›craie‹), sondern Grafit; die Ähnlichkeit in Funktion und Form bildet den Grund für die Anwendung des Lexems auch auf den neuen Typ der Stifte.
Читать дальше