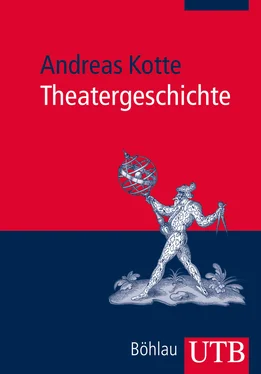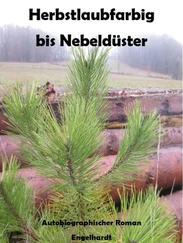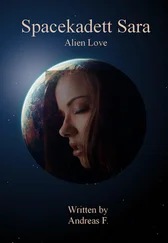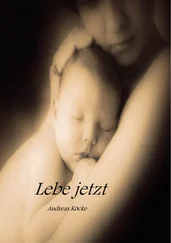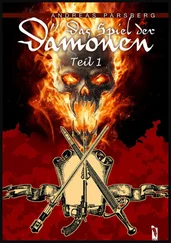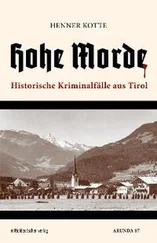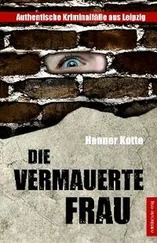Zu Stefan Hulfelds Weiterentwicklung des Konzeptes gehört vor allem das Ersetzen der einander zu ähnlichen Begriffe durch solche von höherer Trennschärfe: Lebenstheater, Kunsttheater, Theaterspiel und Nichttheater. Er weist auch darauf hin, dass grundsätzlich die Theatralität eines jeden „konkreten Zeit / Raums“ ermittelt werden kann. 15In diesem Sinne geht es in jedem ersten Abschnitt eines Kapitels der Einführung vornehmlich um die Beziehungen zwischen Lebensprozess und Theater, speziell um die Modi, wie sich Letzteres aus Ersterem herauslöst oder Ersterer durch Letzteres theatralisiert wird, es geht um „Lebenstheater“. Im zweiten Abschnitt eines jeden Kapitels werden in ästhetischem Kontext Beispiele eines wie auch immer gearteten „Kunsttheaters“ angesprochen oder verglichen. Der dritte Abschnitt gehört besonders starken spielerischen Impulsen, dem „Theaterspiel“, das sowohl die Formen von „Lebenstheater“ als auch jene von „Kunsttheater“ konterkariert. „Theaterspiel“ fluktuiert im öffentlichen Raum oder formiert sich zu einer Theaterform wie zum Beispiel zur Commedia dell’arte. Bevor der fünfte Abschnitt unter dem Gesichtspunkt „Nichttheater“ wesentliche Haltungen, die im angegebenen Zeitraum gegenüber Theater eingenommen werden, versammelt, erschien es ratsam, einen vierten Abschnitt ei [<< 21] nzufügen, der sich jeweils einer weiteren oder dem Nebeneinander von „Theaterformen“ widmet, ihr synchrones Vorhandensein herausstellt, das in asynchron-entwicklungsbetonter Theaterhistoriografie oft unbeachtet bleibt. Außerdem fragt ein abschließender sechster Abschnitt eines jeden Kapitels nach den äußeren Aufführungsbedingungen, den Bühnen, Dekorationen und der Technik, also nach jenen Faktoren, die man zu einer Mediengeschichte von Theater zusammenfassen könnte.
Eine solche Abfolge der Abschnitte betont das exemplarische Herangehen. Die unterschiedlichen Aspekte erhellen in ihren reichen Beziehungen untereinander das Theatralitätsgefüge des jeweils in der Kapitelüberschrift ausgewiesenen Zeitraumes, welches jeweils am Kapitelende knapp umrissen wird. Das Theatralitätskonzept bietet Lesenden den Vorteil, in verschiedenen Jahrhunderten zu ähnlichen Themenkomplexen Aussagen vorzufinden, die in jeder selbst gewählten Abfolge rezipiert werden können: Wen zum Beispiel die Entfaltung des Bühnenwesens und der Theatertechnik interessiert, der nimmt die jeweils letzten Abschnitte der Kapitel zur Kenntnis. Durch solche Wechsel von Synchronizität und Asynchronizität kann vielleicht in gezielter Collage doch die Ganzheitlichkeit der Theaterentfaltung in den Blick genommen werden, die auf beschreibendem Wege nicht auszudrücken wäre.
Die dargelegten Ziele, vor allem die Vermeidung von Normativität, sind mit der Vorgabe eines festen Theaterbegriffs als ordnender Instanz nicht erreichbar. Daher wird das dynamische Konzept der szenischen Vorgänge benutzt, welches das spielerische Hervortreten von Theater aus dem Lebensprozess betont. Spiel ist insofern die genuine Komponente von Theater, indem es szenische Vorgänge hervorbringt, von denen Zuschauende dann einige als Theater bezeichnen. Sie urteilen einerseits abhängig von der Konsequenz des Geschehens, deren Steigerung oder Verminderung, und andererseits abhängig von den Arten der Hervorhebung des Geschehens, also, wenn man so will, vom Spiel- und vom Zeichenaspekt her. Szenische Vorgänge sind im Vergleich graduell unterscheidbar, was in der Theatergeschichte viele Theaterreformer und Theatergegner auf den Plan rief, die den Namen Theater zielgerichtet vergaben oder verweigerten. Ihnen gilt unter solcher Perspektive besondere Aufmerksamkeit.
Als ein lehrend Lernender bin ich dankbar für die Unterstützung und Förderung, die mir 30 Jahre lang durch meinen verehrten Lehrer Rudolf Münz zuteil wurde, mit dem ich 2006 das Vorgehen, die Beispiele und das beim Verlag gerade eingereichte Inhaltsverzeichnis des Buches noch ausführlich diskutieren konnte. Ebenso dankbar bin ich für die Anregungen und Ratschläge der jüngeren Generation, insbesondere von Stefan Hulfeld, Freund und Weggefährte, die sich bis auf den gegenseitigen Austausch von Materialien ausdehnte. Ohne die Neugier einzelner Berner Studierender, [<< 22] die mehrjährige Hilfe in Recherche und formaler Bearbeitung durch Maria-Elisabeth Heinzer, studentische Durchsicht von Corinna Hirrle, ein kritisches Probelesen von Beate Hochholdinger-Reiterer, die Korrekturen von Tobias Hoffmann, den ermutigenden Beistand meiner Frau Edit und schließlich die Hartnäckigkeit des Verlages, wäre der Band nicht entstanden.
Andreas Kotte
Bern, im Januar 2013 [<< 23]
1Dubech 1931 – 1934. Kindermann 1957 – 1974. Berthold 1968. Brockett 1968. Frenzel 1984. Brauneck 1993 – 2007. Wickham 1999. Simhandl 2001. Brown 2001. Williams 2010 usw.
2Vgl. das Standardwerk zur Geschichte der Theatergeschichtsschreibung: Hulfeld 2007.
3Vgl. Napoli-Signorelli 1777.
4Vgl. dazu Steinbeck 1970, S. 161 sowie Bayerdörfer 1990, S. 41 – 63. Zum Herangehen an Theaterhistoriografie vgl. Lazardzig; Tkaczyk; Warstat 2012.
5Vgl. Kotte 2005, S. 227.
6Gut zusammengefasst bei Latacz 1993, S. 29 – 83.
7Vgl. Simon 2003, S. 38.
8Der Medienforscher Derrick de Kerckhove beantwortet die Frage, wo sich denn die zeitgenössische Bühne befinde, wie folgt: „Wir haben heutzutage zwei Bühnen: die Computerbildschirme und den gesamten Globus.“ Er erklärt: „Ein prägnantes Beispiel für globales Theater war die weltweite Trauer über den Tod von Prinzessin Diana.“ Oder: „Eine andere Form globalen Theaters ist der Krieg. […] Kosovo war ein globales Theater, eine globale Inszenierung.“ Kerckhove 2001, S. 501 – 525.
9Acton 1988, S. 627.
10Vgl. für Letztere die Kapitel zu Afrika und Asien in den neueren Auflagen der Theatergeschichte von Oscar G. Brockett.
11Postlewait 1988, S. 299 – 318, 305f.
12Platter 1968, S. 305 – 308.
13Münz 1998, S. 66 – 103.
14Münz 1998, S. 69f.
15Hulfeld 2000, S. 394 – 401, 400. Vgl. auch S. 538 – 567.
1 Theater vor dem 5. Jahrhundert
Wo beginnt Theatergeschichte? Befreit von einem literarisch geprägten Theaterbegriff des 19. Jahrhunderts, der mit seinem Entwicklungszwang eine ‚erste Geburt‘ von Theater in Griechenland postuliert, und befriedet durch den Fortfall einschränkender thematischer Periodisierungen, können einige historiografische Anhaltspunkte für Theater in frühen Phasen der gesellschaftlichen Menschwerdung diskutiert werden ( Kap. 1.1, Seite 26). Die griechische Komödie und Tragödie ( Kap. 1.2, Seite 33) haben neben dem Mimus, das heißt Formen nicht-literarisch körperbetonten Stegreiftheaters, existiert ( Kap. 1.3, Seite 44). In Rom gewinnen solche Formen sogar die Oberhand gegenüber Komödie und Tragödie, die sich innerhalb eines breiten Spektrums Römischer Spiele zu behaupten versuchen ( Kap. 1.4, Seite 51). Schwerpunktsverlagerungen bei der Entfaltung spezifischer Formen geschehen aber nie ohne Widerstand. Während Theater bis in seine griechische Institutionalisierungsphase des 6. bis 4. Jahrhunderts v. Chr. unbefragt zum allgemeinen Lebensprozess gehörte, gerät es nun allmählich in den Verdacht, parallele kulturelle Anstrengungen, nämlich die Konzeptbildungen der Philosophie, der Historiografie und der Religion sowie die jeweiligen Herrschaftsstrategien durch seine ästhetische Eigenart, mehrere Wahrheiten gleichzeitig gelten zu lassen, zu unterminieren ( Kap. 1.5, Seite 56). Philosophen halten Theater für unehrlich, weil es nur nachahme. Historiker halten es für unwahr, weil es Zeiten, Orte und Figuren vermenge. Rhetoriker werten es gegenüber ihrer eigenen Kunst ab. Christliche Kirchenlehrer verwerfen es als zu heidnisch und zu körperlich. Ohne auf das Sprichwort „Viel Feind‘, viel Ehr‘“ auszuweichen, ist zuzugestehen: Es muss schon etwas ganz Besonderes sein, dieses Theater, wenn es auf solch massive Ablehnung und erdrückende Gegenmittel wie die Zensur stößt. Historisch ist die Theaterfeindschaft ein Glücksfall, denn oft sind die Verbote die einzigen erhaltenen schriftlichen Quellen zum Theaterleben. Andere Zeugen der Theatergeschichte haben die Zeit besser überstanden, vor allem einige Spielstätten ( Kap. 1.6, Seite 65). Sie erhellen die Aufführungspraxis und den Stand der Theatertechnik sowie einige Verknüpfungen zwischen Theaterformen und Lebensprozess. [<< 25]
Читать дальше