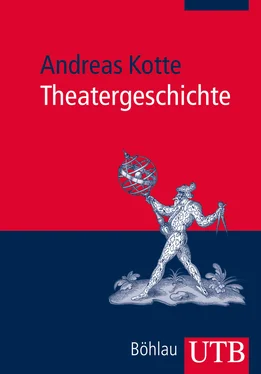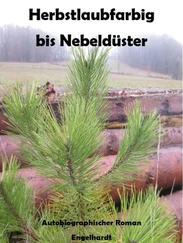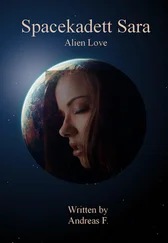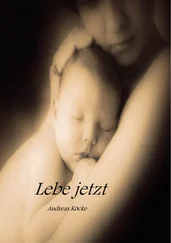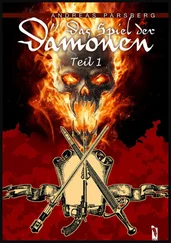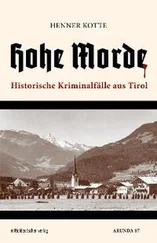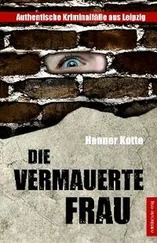2.3 Der Narr und die Verkehrung
2.3.1 Zur Genealogie der Narren
2.3.2 Bezüge der mittelalterlichen Narrenfigur
2.4 Das vermeintliche Theatervakuum
2.4.1 Auferstehungsfeiern
2.4.2 Herodesspiele
2.4.3 Die Liturgie als Drama
2.4.4 Die Spielverbote für Mimen
2.4.5 Die Dramen der Hrotsvit von Gandersheim
2.4.6 Die humanistische Alternative zur christlichen ‚zweiten Geburt‘
2.5 Zur Marginalisierung der Giulleria
2.5.1 Einteilung der Fahrenden
2.5.2 Die Vorwürfe des Klerus an die Giulleria
2.5.3 Sanktionen: Exkommunikation, Gerichtsfähigkeit
2.6 Sukzessions- und Simultanbühnen
2.6.1 Flächige Simultanbühnen
2.6.2 Räumliche Simultanbühnen
3 Humanismus und Commedia im 15. und 16. Jahrhundert
3.1 Mensch sein, scheinen oder spielen
3.1.1 Fürsten der Neuzeit – Der Zweck heiligt die Mittel
3.1.2 Schauspielkunst im höfischen Leben
3.2 Humanistentheater als ein Reproduktionsinstrument für Dramen
3.2.1 Pomponius Laetus – vom Umzug zum Theater
3.2.2 Zum Repertoire der Accademia Romana
3.2.3 Die Schausprech- und Schauspielkunst der Pomponianer
3.3 Die Commedia italiana
3.3.1 Der Streit um den Ursprung
3.3.2 Varianten der Commedia dell’arte
3.3.3 Die Comédie-italienne in Frankreich
3.4 Synthese der Künste im Fest
3.4.1 Die Medici-Hochzeit von 1589
3.5 Humanistische Theaterablehnung
3.5.1 Die Ablehnung des Lebenstheaters
3.5.2 Zur Stellung von Theater in den Sozialutopien der Renaissance
3.6 Die schöne Stadt auf der Bühne
3.6.1 Die Bühnen des Humanistentheaters
3.6.2 Sebastiano Serlio und die Winkelrahmenbühne
3.6.3 Drehprismen nach Vitruv
3.6.4 Die Architekturbühne des Teatro Olimpico in Vicenza
4 Die Welt ist (k)ein Theater – das 17. Jahrhundert
4.1 Lebenstheater statt Welttheatermetapher
4.1.1 Die Welttheatermetapher
4.1.2 Lebenstheater am Beispiel von Machtdemonstrationen
4.2 Autos sacramentales, Hoftheater und Comedias in Spanien
4.2.1 Die Autos sacramentales
4.2.2 Hoftheater italienischer Prägung
4.2.3 Die Comedias in den Corrales
4.3 Die Commedia dell’arte und ihre Konkurrenten in Paris
4.3.1 Jahrmarktskünstler – Das Beispiel Tabarin
4.3.2 Die Hôtels als Theaterbauten – Beispiel Hôtel de Bourgogne
4.3.3 Molière adaptiert die Commedia
4.3.4 Die klassizistische Tragödie
4.3.5 Die Ancienne Troupe de la Comédie-italienne bis 1697
4.4 Die Welt im Jesuitentheater
4.4.1 Die Vorstellung vom theatrum mundi durchdringt den Schulunterricht
4.4.2 Einige Formen des Jesuitentheaters im Überblick
4.4.3 Vom Drama zur Aufführung
4.5 Blüte und Verbot – englisches Theater an der Jahrhundertwende
4.5.1 Elisabethanisches Theater
4.5.2 Die Antitheaterbewegung führt zum Theaterverbot 1642 – 1660
4.6 Plattform-, Perspektiv- und Kulissenbühnen
4.6.1 Plattformbühne
4.6.2 Perspektivbühnen, zwei Beispiele
4.6.3 Die Kulissenbühne
5 Nationaltheateridee und Hoftheaterpraxis – das 18. Jahrhundert
5.1 Von der Verhaltenskritik am Adel zum veristischen Schauspielstil
5.1.1 Bürgerliches Verhalten kontra höfische Schauspielerei
5.1.2 Verhaltensschulung durch Theater – Die Ackermannsche Truppe
5.1.3 Eine Spielweise bürgerlichen deutschen Theaters
5.1.4 Das Lebenstheater des Bon Ton
5.2 Von der Kunst des Körpers zum Drama
5.2.1 Die Reformversuche des Luigi Riccoboni
5.2.2 Carlo Goldonis Literarisierung von Theater
5.3 Hanswurst und die Wanderbühne
5.3.1 Faust und Pickelhering bei Johannes Velten
5.3.2 Joseph Anton Stranitzky als Hanswurst
5.3.3 Haupt- und Staatsaktion – ein Kampfbegriff
5.4 Ein bürgerliches Nationaltheater für Hamburg
5.4.1 Impetus der Nationaltheateridee
5.4.2 Konrad Ernst Ackermann eröffnet 1765 in Hamburg ein Schauspielhaus
5.4.3 Hamburger Entreprise – Plan und Realisierung
5.5 Wirkungen der Französischen Revolution
5.5.1 Gezwungen zum Kompromiss
5.5.2 Dramen für und wider die Revolution
5.5.3 Der Sieg des Trivialen
5.6 Ephemere Bühnen und Theaterhäuser aus Stein
5.6.1 Kulissenbühne im Opernhaus
5.6.2 Ephemere Bühne
5.6.3 Zuschaukonventionen
6 Theaterreformen und -reformer – das 19. Jahrhundert
6.1 Verhaltensreglementierung und Schauspielkunst
6.1.1 Natur versus Kunst – Schauspielstile an der Wende zum 19. Jahrhundert
6.1.2 Die Ermordung August von Kotzebues stärkt die Theaterzensur
6.2 Das Käthchen von Heilbronn in Wien
6.2.1 Können Aufführungen rekonstruiert werden?
6.2.2 Der Rekonstruktionsversuch
6.3 Theaterspiel kontra Zensur
6.3.1 Johann Nepomuk Nestroy
6.3.2 Der Schauspieler als Dramatiker
6.3.3 Weder Räsoneur noch Hanswurst – Nestroy ist nicht zu fassen
6.4 Moderne Theaterorganisation
6.4.1 Reformziele
6.4.2 Zur Reform der Theaterorganisation unter Heinrich Laube
6.4.3 Das Meininger Hoftheater
6.5 Literarische Direktion
6.5.1 Der Weimarer Stil
6.5.2 Goethes Regeln
6.5.3 Der rebellische Schauspieler Carl Reinhold
6.6 Der Guckkasten und die Abstraktion
6.6.1 Die unvollkommene Shakespearebühne
6.6.2 Richard Wagners Festspielhaus 1876
6.6.3 Die Reformvorschläge des Adolphe Appia
7 Mythos Ausdifferenzierung – das 20. Jahrhundert
7.1 Nicht alle spielen Theater
7.1.1 Auf- und Umzüge, Feste
7.1.2 Theatralisierung der Gesellschaft
7.2 Regieoffensive
7.2.1 Ein Regisseur ohne Kompromisse
7.2.2 Kollektive Experimente
7.3 Theater als Störung
7.3.1 Politisches Theater
7.3.2 Postdramatisches Theater
7.4 Kontinuum der Formen
7.4.1 Theaterformen am Beispiel der Schweiz
7.4.2 Der Hunger der Medien
7.5 Theaterfreiheit
7.5.1 Theater unterm Hakenkreuz
7.5.2 Die Regulative
7.6 Multiple Räume
7.6.1 Der optimale Raum
7.6.2 Aktionskunst im Verwertungsprozess
Epilog
Abbildungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Personenregister
Rückumschlag
Prolog
Dieses Buch widmet sich den Problemen der Theatergeschichte und der Theatergeschichtsschreibung. Es gibt mehrere ein- bis zehnbändige Überblicksdarstellungen der Theatergeschichte, die ein zusammenhängendes Bild des Gegenstandes bieten. Die schmaleren Bände fassen dabei jeweils die voluminöseren Werke abstrahierend zusammen, indem weniger am Beispiel argumentiert wird und Problematisierungen entfallen. 1Vom Organismus bleibt dessen Skelett übrig, der Vorgang gerinnt zur Information und das aktuelle Jahrhundert wird meist überproportional breit dargestellt. Das Wagnis einer weiteren einbändigen Theatergeschichte lohnt sich daher nur dann, wenn die Beispiele als exemplarisch und die Problematisierungen als erkenntnisleitend erhalten bleiben können.
Theatergeschichte und Theaterhistoriografie
Viele Missverständnisse und Fehleinschätzungen rühren heute daher, dass der Begriff Theatergeschichte doppelt verwendet wird, sowohl für die Ebene der Erscheinungen als auch für die Ebene des Diskurses über die Erscheinungen; für die Theaterlandschaft selbst und für den Schleier, das Netz oder die Plastikfolie, die reflexiv darüber ausgebreitet werden. Sobald dann die Ebene des Diskurses fälschlich für die Ebene der Erscheinungen gehalten wird, scheint endlich die Theatergeschichte geschrieben zu sein, doch dies ist weniger denn je der Fall.
Die beiden Ebenen unterscheiden sich. Die Theatergeschichte besteht aus Prozessen, die die Theatergeschichtsschreibung erläutert. Es sind spezifische Beziehungen zwischen leibhaftig anwesenden Agierenden und Schauenden, welche in flüchtigen Ereignissen als eine kulturelle Praxis erfahrbar sind, die erst im Nachhinein partiell beschrieben werden kann. Die Schilderung kann sich aber wegen ihres unzulänglichen Mittels Sprache nur bis zu einem gewissen Grade den Geschehnissen oder Aufführungen annähern und erfolgt unter bestimmten Voraussetzungen zu bestimmten Zwecken, ist also subjektiv geprägt. Sie macht aus ihrer notwendigen Unvollkommenheit – Sprache [<< 13] erfasst nur schlecht Geschehen – die Tugend sinngebender Auswahl. Der Diskurs ist traditionsstiftend und insofern eine zweite kulturelle Praxis. Sie ist durch und durch paradox. Denn viel zu viel ist geschehen, ohne dass wir Kunde davon hätten. Trotzdem haben wir immer noch von viel zu viel Geschehen Kunde, als dass es aufschreibbar wäre. Und dann nennt sich auch noch ein Buch, das sich theaterhistoriografisch mit Theatergeschichte als Prozess beschäftigt, Theatergeschichte.
Читать дальше