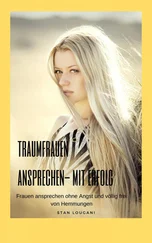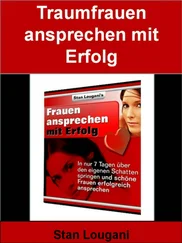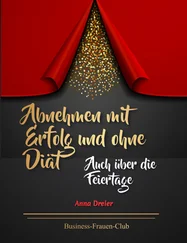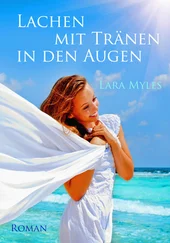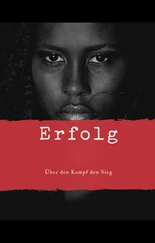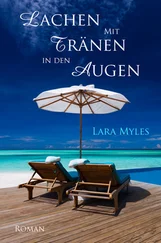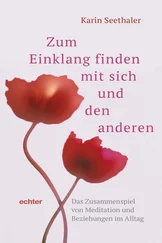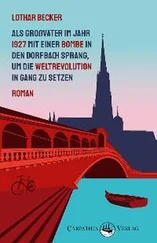1.5Der Inhalt der Promotion im Wandel der Zeit
Die heutige Promotion in der Biomedizin ist der Nachweis der eigenverantwortlichen und selbstständigen Forschung auf einem definierten Themengebiet. Dies war nicht immer so. An der mittelalterlichen Universität stand das Lernen und Aneignen von Wissen im Vordergrund und nicht das Forschen. Mit dem Doktorgrad erwarb man die unbeschränkte Lehrbefähigung an hohen Schulen. Erst im 18. Jahrhundert bildeten sich die Universitäten aus reinen Lehrstätten auch in Forschungseinrichtungen um. Damit hat sich der Ausbildungsweg von Akademikern deutlich gewandelt. Strebt man heute eine universitäre Karriere an, erbringt man über die Promotion zunächst den Nachweis der Forschungsbefähigung. Erst danach erwirbt man die Lehrbefugnis, die Venia legendi (lateinisch = Erlaubnis zu lesen), die man im Zuge einer Habilitation erhält. Die Habilitation ist der Nachweis, dass der Kandidat sein Fach in voller Breite in Forschung und Lehre vertreten kann. Die Habilitation schließt sich der Promotion an, dauert in der Regel mehrere Jahre und ist an bestimmte Leistungen geknüpft wie Anzahl und Güte von Veröffentlichungen in einem Forschungsgebiet sowie Lehrleistungen in Form von regelmäßigen Vorlesungen und Praktikumsbetreuungen. An einigen Fakultäten wird nach erfolgreichem Abschluss des Habilitationsverfahrens die akademische Bezeichnung Privatdozent (PD oder Priv.-Doz.) verliehen. Alternativ verleihen zahlreiche Fakultäten zusätzlich den akademischen Grad eines habilitierten Doktors (Doctor habilitatus, kurz: Dr. habil.). Die Habilitation war bis vor kurzem der einzige Zugang in Deutschland, um auf eine Professur berufen werden zu können. Heute gibt es hierzu alternative Karrieretracks, wie z. B. die Juniorprofessur (siehe auch Seite 124).
1.6Akademische Grade in den Lebenswissenschaften heute
Der akademische Grad, der in den Lebenswissenschaften für Kandidaten mit naturwissenschaftlichen Studium in Deutschland heute am häufigsten vergeben wird, ist der Doktor der Naturwissenschaften Dr. rer. nat. (doctor rerum naturalium). Er wird für erfolgreiche Promotionen in den Fächern Biologie, Biomedizin, Molekulare Medizin, (Bio-)Chemie, (Bio-)Physik, Mathematik und (Bio-)Informatik vergeben. Einige wenige Universitäten haben zudem das Promotionsrecht zur Vergabe des angelsächsischen Äquivalents zum Dr. rer. nat., dem Doctor of Philosophy (PhD). Die Leistungen, die zum Erbringen beider Grade notwendig sind, sind vielfach identisch und einige Universitäten bieten ihren Promovierenden die Wahlmöglichkeit zwischen den beiden Graden für ihre Promotion an. Zudem ist es nach angelsächsischem Vorbild oft möglich, den PhD als Zusatz mit dem Fachgebiet zu versehen, in dem die Dissertation erlang wurde. So sind akademische Grade wie „PhD in Immunology“ oder „PhD in Physiology“ möglich.
Es gibt eine klare Tendenz bei der Wahl zwischen dem deutschen Grad Dr. rer. nat. und dem angelsächsischen PhD: Deutsche Promovierende bevorzugen in der Regel den Dr. rer. nat., wogegen Ausländer, insbesondere aus den asiatischen Staaten, beispielsweise aus Indien, Pakistan, China oder aus den angelsächsischen Ländern, sich eher für den PhD entscheiden. Die Gründe hierfür sind nicht ganz klar. Doch mag dies einerseits den Bekanntheitsgrad und/oder die bessere Akzeptanz des Doctor of Philosophy in diesen Ländern widerspiegeln. In Deutschland kommt hinzu, dass das Kürzel für den Doktorgrad (Dr.) in amtliche Urkunden wie Personalausweis, Reisepass und Führerschein eingetragen werden kann. Allerdings ist der Grad entgegen der landläufigen Meinung kein Namenszusatz, wie der Bundesgerichtshof schon vor mehr als 50 Jahren entschieden hat. Ein Eintragen des Grades PhD ist zur Zeit nur aufgrund einer universitären Äquivalenzbescheinigung als Dr. rer. nat. möglich.
Ein weiterer wichtiger Grad in den Lebenswissenschaften ist der Dr. med. (doctor medicinae) bzw. Dr. med. dent. (doctor medicinae dentariae). Dabei kann ersterer nur von Absolventen eines Humanmedizinstudiums und zweiterer von Absolventen eines Studiums der Zahnheilkunde erworben werden. Im Vergleich zu den prinzipiell naturwissenschaftlichen Graden Dr. rer. nat. und PhD gibt es drei gravierende Unterschiede:
(1) Während die Promotion in den naturwissenschaftlichen Fächern im Anschluss auf ein Masterstudium folgt, fertigen Promovenden in der Human- und Zahnmedizin ihre Dissertation in den meisten Fällen bereits während des Studiums an. Da die Voraussetzung zur Erlangung eines Doktorgrades aber der Abschluss eines mindestens vierjährigen Hochschulstudiums ist, erfolgt die Disputation und damit auch die Vergabe des akademischen Grades erst nach dem Staatsexamen.
(2) Die Dauer zur Anfertigung der medizinischen Dissertation ist deutlich kürzer. Während in den Naturwissenschaften als Richtwert eine Promotionsdauer von drei bis vier Jahren Vollzeit angestrebt werden soll, ist die Bearbeitung in der Human- und Zahnmedizin deutlich kürzer, studienbegleitend und – falls nicht in einem speziellen Promotionsprogramm durchgeführt – häufig nicht in Vollzeit.
(3) Nur wenige medizinische Doktorarbeiten beinhalten eine experimentelle Phase. Häufig werden vorhandene Patientendaten statistisch ausgewertet, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Auf die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zu forschungs- und lehrförderlichen Strukturen in der Universitätsmedizin (2004) sind wir bereits weiter oben eingegangen.
Zur Beseitigung dieser Mängel werden an den Medizinischen Fakultäten seit einigen Jahren gezielt sogenannte strukturierte Promotionsprogramme für medizinische Doktorarbeiten aufgelegt (siehe Seite 65). In diesem Zusammenhang soll erwähnt werden, dass Absolventen des Humanmedizinstudiengangs an einigen Einrichtungen auch den Grad Dr. rer. nat. oder PhD erwerben können. Dies setzt aber eine drei bis vierjährige Vollzeit-Promotionsphase nach dem Staatsexamen voraus. Da aber Medizinische Fakultäten in der Regel nicht entsprechende Promotionsverfahren durchführen dürfen, setzt dies eine Kooperation mit einer Naturwissenschaftlichen Fakultät oder mit einer Graduiertenschule voraus. Um den Qualitätskriterien zu genügen, sind solche Kandidaten zudem häufig Mitglieder in spezifischen Promotionsprogrammen.
Neben diesen Hauptabschlüssen gibt es noch eine Reihe von weiteren akademischen Graden, die im Bereich der Lebenswissenschaften vergeben werden. Beispielhaft seien erwähnt der Doktor der Humanbiologie (Dr. biol. hum., biologiae humanum), Doktor der Tiermedizin (Dr. med. vet., medicinae veterinariae), Doktor der Biomedizin/Medizintechnologie/medizinischen Biometrie und Bioinformatik/Gesundheitswissenschaften (Dr. rer. medic., rerum medicinalium). Die Erlangung des Grades Dr. biol. hum. setzt in der Regel den Abschluss eines mindestens vierjährigen (Regelstudienzeit) Studiums in naturwissenschaftlichen Fächern, Humanbiologie, Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Informatik, Psychologie, Soziologie oder Pharmazie voraus. Nicht zu verwechseln ist der Dr. biol. hum. mit dem Studium der Humanbiologie, das in Deutschland z. B. an den Universitäten Greifswald und Marburg angeboten wird (www.hochschulkompass.de). Dieses befasst sich mit der Biologie des Menschen sowie den biologischen Grundlagen der Humanmedizin. Ziel ist es, die Absolventen zur wissenschaftlichen und praktischen Arbeit auf dem Gebiet der biomedizinischen Grundlagenforschung der Medizin zu qualifizieren. Dieses Studium schließt mit dem Master ab.
Der Abschluss Dr. med. vet. kann man nur nach dem Studium der Tier- bzw. Veterinärmedizin erlangen und dies auch nur an Universitäten mit einer entsprechenden Fakultät, z. B. an der Tierärztlichen Hochschule Hannover, der Ludwig-Maximilians-Universität München, der Freien Universität Berlin oder den Universitäten Giessen und Leipzig.
Читать дальше