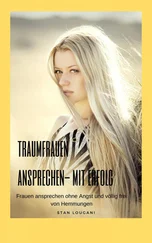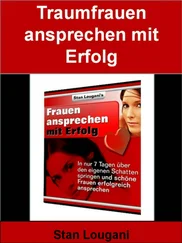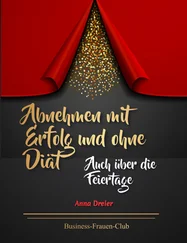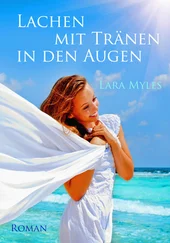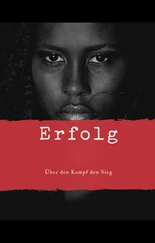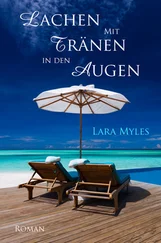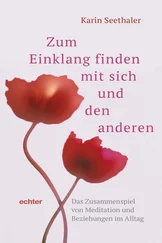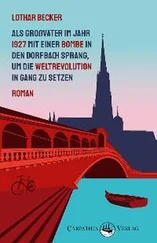Die Kosten, die mit einer Promotion verbunden waren, waren sehr hoch und abhängig von der jeweiligen Universität bzw. Fakultät. Nach Wollgast (2001) lagen die Gebühren für eine theologische Promotion in Deutschland im 17. Jahrhundert im Durchschnitt bei 100 Talern. Hinzu kamen die indirekten Kosten wie der essenzielle Doktorschmaus. Hierzu wird berichtet, dass auf einer Feier der Theologischen Fakultät der Leipziger Universität im April 1666 folgendes Essen und Getränke auf Kosten des frischen Doktors angeboten wurden: „1 Reh, 19 Hasen und 3 andere Stück Wild, 9 Wildenten, 15 Trut- und 3 Auerhähne, 5 Wasserhühner sowie 52 Junghühner. Hinzu kamen Aale, Lachse und Hechte, 12 Kannen italienischen Weins, 3 Faß Bier, für 205 Thaler gewöhnlicher Tischwein sowie für 124 Thaler Konfekt, Marzipan und Mandeltorte.“ (Wollgast 2001)
Als äußeres Zeichen der Erlangung der Doktorwürde trugen die Promovierten den Doktorhut (Barett), einen Mantel (Talar) und einen Ring, die zum Teil nach erfolgreicher Prüfung feierlich übergeben wurden. Durch diese Markenzeichen unterschieden sich die Lehrenden von den Lernenden und waren zudem äußerlich gut erkennbar. Diese Tradition hat sich bis heute teilweise erhalten; die Übergabe des Doktorhutes nach bestandener mündlicher Prüfung wird nach wie vor zelebriert. Nur ist dies nicht mehr ein formaler Akt, der vom Dekan durchgeführt wird, sondern vielmehr ein Brauch, bei dem Mitglieder der Arbeitsgruppe diesen Doktorhut basteln und überreichen. Vorgaben über das Aussehen existieren nicht. Zudem wird dieser Doktorhut heute mit vielerlei Laborutensilien geschmückt, die einerseits an das durchgeführte Forschungsprojekt erinnern sollen und andererseits lustige (Alltags-)Begebenheiten repräsentieren, die sich während der Promotionsphase ereignet haben.
1.3Dissertation, Disputation und Rigorosum
Heute unvorstellbar, aber wahr: In der frühen Neuzeit (16. Jahrhundert) konnte die Promotionsschrift, die Dissertation, vom Promovenden (bzw. Respondent) oder seinem Doktorvater, dem Präses, verfasst werden (Wollgast 2001). Der Präses leitete zudem die Verteidigung des Kandidaten. Ebenso verwunderlich ist, dass es besonders geeigneten Kandidaten oder Kandidaten aus dem Stand der Adeligen erlaubt war, sine praeses zu verteidigen. Die Dissertation musste publiziert werden, aber lange Zeit wurden sie nicht unter dem Namen des Promovenden, sondern unter dem Namen des Praeses publiziert, der dadurch eine hohe akademische Anerkennung erhielt.
Diese Vorgehensweise hatte einen kommerziellen Hintergrund. Druckkosten für wissenschaftliche Publikationen waren hoch und einen Geldgewinn konnte man durch deren Verkauf kaum erzielen. Somit bot sich die einfache Lösung an, die Ergebnisse wissenschaftlicher Studien in eine Dissertation zu verpacken und einen Respondenten zu suchen, der bereit war, einerseits über die Schrift des Präses zu disputieren und andererseits die Druckkosten zu tragen. Auf diese Art und Weise konnten von einem Präses z. T. Dutzende an Promotionen veröffentlicht werden.
Abgeschlossen wurde das Studium durch ein mündliches Examen, das Rigorosum oder Disputation genannt wurde. Beides findet auch heute noch Anwendung. Im Examen rigorosum können neben dem eigentlichen Promotionsthema angrenzende Fachgebiete geprüft werden. Die Disputation ist hingegen ein wissenschaftliches Streitgespräch, in dem der Promovend (der Respondent) die Arbeit kritisch diskutieren und gegenüber seinen Prüfern verteidigen muss. Ein Sonderfall ist hierunter die Prüfungsform des Kolloquiums. Dieses teilt sich meistens in zwei Abschnitte. Der erste Abschnitt ist identisch mit der klassischen Disputation, in der die Ergebnisse der Dissertation kritisch diskutiert, von den Prüfern hinterfragt und vom Promovenden verteidigt werden müssen. Im zweiten Teil der Prüfung muss der Promovend heute eine biomedizinische oder molekularbiologische Hypothese vorstellen und sie gegen den Prüfungsausschuss verteidigen. Die Art der Abschlussprüfung variiert von Universität zu Universität und von Fachbereich zu Fachbereich. Länge und Art der Prüfung sind in der jeweiligen Prüfungsordnung bindend festgelegt.
1.4Promotionsregeln und Promotionsordnung
Wie das bisherige Kapitel zeigt, werden Promotionen seit Anbeginn nach bestimmten strengen Regeln durchgeführt, auch wenn diese aus heutiger Sicht nicht immer nachvollziehbar sind. Sehr seltsam mutet z. B. der Eid an, den die Promovenden im Mittelalter zur Promotion ablegen mussten: „Im Falle einer Abweisung durften sich die Kandidaten nicht an den Prüfern rächen.“ Er durfte körperlich nicht abnorm erscheinen und nicht unehelicher Geburt sein (Wollgast 2001). Andererseits hat sich zumindest eine der Vorgaben des Mittelalters bis in die heutigen Tage gehalten: Dem Promovend musste ein guter Leumund eigen und sein moralischer Wandel einwandfrei sein. Diese Voraussetzung spiegelt sich in dem polizeilichen Führungszeugnis wider, dass auch heute noch für eine Promotion notwendig ist.
Die erste den Autoren bekannte Promotionsordnung stammt aus dem Jahr 1219 von der Universität Bologna. Die älteste bekannte ausgefertigte Promotionsurkunde zur Verleihung des akademischen Grads eines Doktors an der damaligen deutschen Universität Prag ist auf den 12. Juni 1359 datiert und wurde für einen Theologen ausgefertigt (Blecher 2006). Bologna gilt als die älteste Universität Europas und gibt auf ihrer Homepage als Gründungsjahr 1088 an (http://www.eng.unibo.it, Stand: 06.02.2014). Ende des 11. Jahrhunderts gab es nachweislich eine Rechtsschule, aus der sich schrittweise eine Universität nach heutigen Maßstäben mit einem breiten Fächerspektrum entwickelte. Alle Universitätsgründungen bedurften damals einer Gründungsurkunde des Papstes oder Kaisers, den Vertretern der geistlichen beziehungsweise weltlichen Herrschaft. Die Promotionsordnung erhielt Bologna folgerichtig durch eine Dekretale des Papstes Honorius III (Wollgast 2001) an den Archidiakon (Erzdiakon; Archidiakonat = kirchliche Verwaltungseinheit, die mehrere Dekanate umfassen konnte) des Domstiftes von Bologna. Eine Dekretale ist eine in Urkundenform veröffentlichte Antwort des Papstes auf eine Rechtsanfrage oder eine Entscheidung im Rahmen der päpstlichen Jurisdiktionsgewalt, die in kirchenrechtliche Sammlungen aufgenommen und dadurch als allgemeine Norm wahrgenommen bzw. verstanden wurde. In seiner Dekretale verfügte Honorius III, das „künftig niemandem das Doktorat verliehen werden dürfe, der nicht zuvor sorgfältig geprüft und durch den Archidiakon mit der Licencia docendi ausgestattet worden war“ (Wollgast 2001). Bis zu diesem Zeitpunkt stand das Recht zur Erteilung der Lehrlizenz und des Doktorgrads dem Doktorandenkollegium ohne zusätzliche externe Qualitätskontrolle zu. Da dies zu einer Abnahme der Qualität der Promotion führte, erhoffte man sich durch die Mitwirkung des Archidiakons an der Erteilung der Lehrlizenz eine qualitativen Verbesserung des Lehrkörpers. Dies zeigt, dass man sich auch zu damaliger Zeit schon über das Qualitätsmanagement im Promotionsprozess Gedanken machte.
Das Verfahren verlief so, dass ein Kandidat, der die erforderliche Zeit studiert hatte, von einem Doktor dem Archidiakon präsentiert wurde. Dieser lud offiziell zum Examen ein, wobei die eigentliche Prüfung vom Doktorkollegium abgenommen wurde und der Archidiakon lediglich die Überwachung der Prüfung übernahm. Bestand der Kandidat die Prüfung, erteilte der Archidiakon die formelle Erlaubnis zur Verleihung des Grades. Die Promotion selbst wurde daraufhin durch die Überreichung der Insignien vom präsentierenden Doktor vorgenommen. Auch in diesem Verfahren gibt es durchaus Parallelen mit den heutigen Promotionsverfahren. So leitet der Vorsitzende des Promotionsausschusses oder einer seiner Vertreter das Promotionsverfahren, kontrolliert die ordnungsgemäße Durchführung des Verfahrens und lässt – gleich dem Archidiakon – Fragen zu oder lehnt sie ab.
Читать дальше