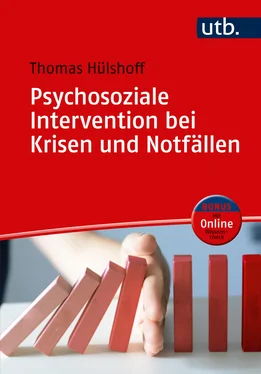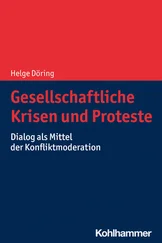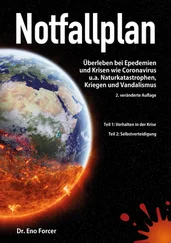Der Begriff Krise kommt aus dem Griechischen (krinein: trennen, unterscheiden), bezeichnet eine entscheidende Wendung und bedeutet eine schwierige Situation, die den Höhe- und Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung darstellt. Insofern sprechen wir von Krisen, wenn wir mit einem bis dato zumindest in dieser Ausprägung unbekannten Ereignis konfrontiert sind, das eine Entscheidung verlangt und ein Problem darstellt, für dessen Lösung wir keine hinlänglichen Erfahrungen und bewährten Lösungsstrategien (Coping-Strategien) haben oder zu haben meinen. Insofern führen solche Situationen zu erheblichen Unsicherheiten, Ängsten und Aufregungen, stellen andererseits aber auch eine Herausforderung dar, nach deren Meisterung wir uns (emotional, körperlich, seelisch und kognitiv) auf einem höheren Niveau befinden.
Krisen als Übergangsphänomen
Krisen sind typische Phänomene des Übergangs. Sie sind allgegenwärtig, kommen in jeder Lebenssituation vor und sind letztlich nicht zu vermeiden. In der Pubertät treten sie als phasentypische Übergangskrisen auf, beispielsweise, wenn der erste Samenerguss oder die erste Menstruation erlebt wird, eine besondere Abschlussprüfung ansteht, der Auszug aus dem Elternhaus zu bewerkstelligen ist usw. Darüber hinaus kann es durch außergewöhnliche, individuell auftretende oder gesellschaftlich bedingte Auslöser zu Krisensituationen kommen: Hierzu zählen beispielsweise gesellschaftlich bedingte, sich aber auch individuell auswirkende Arbeitslosigkeit, Krieg, Flucht und Vertreibung, Naturkatastrophen, soziale Verwerfungen und andere Traumata.
Zeitliche Begren zung von Krisen
Krisen sind zeitlich begrenzt. Der situative und emotionale Ausnahmezustand ist oft so unerträglich, dass wir auf jeden Fall dieser Situation zu entkommen versuchen – im günstigen Fall durch Inanspruchnahme von Hilfe, beispielsweise von Freunden, aber auch durch geschulte Krisenhelfer oder Therapeuten; im weniger günstigen Fall, in dem wir Einzelaspekte der Krise abwehren (beispielsweise eine drohende Krebserkrankung leugnen, uns mit Drogen betäuben, Gefahren nicht wahrhaben wollen etc.). Im ungünstigsten Fall können sich schwerwiegende Entwicklungsstörungen (psychosoziale Isolation und Rückzug, Schulabbruch, Karriereknick und dergleichen mehr), körperliche oder psychische Erkrankung (Psychosen, Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen etc.) oder gar akut lebensbedrohliche Situationen (z. B. Suizidalität) einstellen.
Psychosoziale Krise
Da der Krisenbegriff sehr vielgestaltig – um nicht zu sagen schwammig – ist, führt Sonneck (2002, zit. in Stein 2009, 22) den Begriff der „psychosozialen Krise“ ein. Nach Stein (2009, 23) sind psychosoziale Krisen dadurch charakterisiert, dass sie mit neuen Lebensumständen oder belastenden Ereignissen einhergehen, wesentliche Lebensziele in Frage stellen, zu befürchtetem oder tatsächlichem Versagen von Problembewältigungsmöglichkeiten führen, als bedrohlich erlebt werden und zu einem gestörten psychosozialen Gleichgewicht führen, das Selbstwertgefühl beeinträchtigen und als wichtige Weichenstellung für die Zukunft erlebt werden.

Unter einem Notfall soll im Folgenden eine Situation verstanden werden, in der sich eine Krise so zugespitzt hat, dass die akute Gefahr einer schweren seelischen oder körperlichen, möglicherweise sogar irreversiblen oder lebensbedrohlichen Gefährdung besteht. Auch die Gefährdung anderer (beispielsweise durch Gewalt im Rahmen akuter Erregungszustände) ist in diesem Sinne als Notfall zu betrachten.
Eine Notfallsituation erfordert unmittelbares Eingreifen zum Schutz des Betroffenen, manchmal auch des Umfeldes, und ist in der Regel von Angehörigen einer Berufsgruppe allein nicht zu meistern. Oft sind medizinische (psychiatrische oder notfall- bzw. intensivmedizinische) stationäre Maßnahmen erforderlich (Intensivstation, Entgiftungsstation, psychiatrische Klinik). In der Regel beschränkt sich die akute psychiatrische oder intensivmedizinische Behandlung darauf, den körperlichen oder seelischen Ausnahmezustand zu überwinden, körperliche wie seelische Abläufe zu stabilisieren und das Überleben zu ermöglichen. Hieran setzt im Folgenden die Krisenintervention sowie die Reintegration in das normale Umfeld an. Wo dies nicht ausreicht, sind möglicherweise psychotherapeutische Behandlungen, längerfristige pädagogische Förderungen oder sozial unterstützende Maßnahmen hilfreich.
1.1.3 Psychodynamik und psychisches Erleben
Ohnmachtsgefühle und Hilflosigkeit
Eine Krise geht u. a. mit Gefühlen von Ohnmacht und Hilflosigkeit, gesteigerter Anspannung, seelischer und sozialer Desorientierung sowie Verwirrung einher. Unter einem „Skotom“ versteht man das Phänomen, dass man quasi mit Scheuklappen in die Welt schaut und weder eigene Kräfte, noch Hilfsangebote oder Lösungsmöglichkeiten von außen wahrnehmen kann. Das Erleben, dass bisherige Kräfte und Lösungsmöglichkeiten nicht weiterhelfen, wird verallgemeinert – etwa in dem Sinne, dass man grundsätzlich nicht in der Lage sei, die Situation zu bewältigen, indem man neue Fähigkeiten entwickelt. Diese Hilflosigkeit geht mit dem Erleben überbordender Belastungen, Herausforderungen und Bedrohungen, möglicherweise sogar lebensgefährlicher Bedrohungen, einher.
Kontrollverlust
Die Unfähigkeit, die Situation zu strukturieren und zu kontrollieren, wird als Chaos erlebt, die Betroffenen fühlen sich verwirrt und geraten außer Gleichgewicht. Grundsätzlich meint man, wichtige – sogar überlebenswichtige – Dinge nicht mehr kontrollieren zu können und fühlt sich wie gelähmt. Auf emotionaler Ebene geht dieses Erleben oft mit extremer Angst bis hin zu Panikattacken und dem Gefühl einer „Lähmung“ einher. Das gleichzeitige Erleben von „Lähmung“ bei hochgradiger Erregung ist auf der vegetativ-physiologischen Ebene durch eine extreme Reaktion sowohl des sympathischen wie auch des parasympathischen Nervensystems zurückzuführen.
Verlust von Selbstwirksamkeitserwartung
Mit der erlebten Ohnmacht sinkt das Gefühl der Selbstwirksamkeit, also das subjektive Vermögen, etwas gemäß den eigenen Zielvorstellungen erreichen zu können. Eng damit verknüpft ist das Selbstwertgefühl, also das Empfinden, ein wertvoller, eigenständiger, für andere wichtiger und zu sich selbst stehender Mensch zu sein.
Psychodynamische und situative Einengung
Mitunter kann es in Krisensituationen auch zu einer psychodynamischen und situativen Einengung kommen. Psychodynamisch in dem Sinne, dass sich Sichtweisen und Handlungsspielräume zunehmend verengen und der Betroffene immer weniger Alternativen zur Überwindung seiner misslichen Situation sieht. Dies kann mit einer primär situativen, krisenbedingten Einengung verbunden sein, wenn etwa der Zusammenbruch sozialer Netze, der Verlust eines Angehörigen oder eines Arbeitsplatzes oder eine schwere Krankheit tatsächlich zu massiven Einschränkungen führen, die dann auch krisenhaft erlebt werden. Es kann aber auch sein, dass infolge der dynamischen Einengung, des Rückzugs oder der sozialen Situation sekundär soziale Netze verschwinden, Krankheiten entstehen oder ein Arbeitsplatz verloren geht.
1.1.4 Krisenmodelle, Formen der Krise
Krisenkategorien
Es dürfte bereits deutlich geworden sein, dass Krisen äußerst vielschichtig und heterogen sind. Krisenmodelle versuchen, verschiedene Ausprägungen und Formen von Krisen in Einheiten / Entitäten zusammenzufassen und daraus möglichst passgenaue Interventionsempfehlungen abzuleiten. Einem auch in Deutschland weit verbreiteten Schema des österreichischen Psychiaters Claudius Stein (2009, 49) folgend, kann man mit einer gewissen Pragmatik Verlustkrisen, Krisen bei Lebensveränderung, Entwicklungskrisen, akute Traumatisierung, posttraumatische Belastungsstörungen, Zustände des Burnouts, narzisstische Krisen (bei Persönlichkeitsstörung) sowie psychiatrische Notfälle unterscheiden. Hinzu kommen krisenbedingte medizinisch-relevante Notfälle anderer Art (beispielsweise Intoxikationen). Die meisten dieser Krisenkategorien werden, wenn auch in einer anderen Reihenfolge und einem eher arbeitsfeldbezogenen Duktus, in diesem Buch aufgegriffen.
Читать дальше