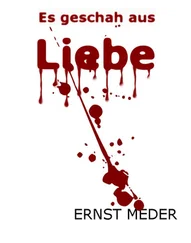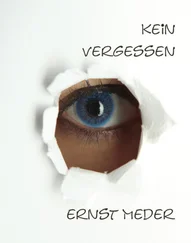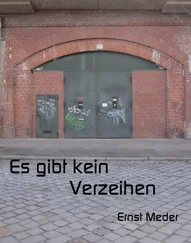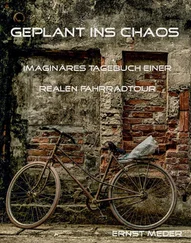1Digesten (D.) und Codex (C.) sind jeweils in Bücher, Titel, Fragmente und Paragraphen unterteilt. Zitiert werden nacheinander die Nummern von Buch, Titel, Fragment und Paragraph (z.B.D. 1.1.1.3). Dem entspricht die Zitierweise der Institutionen (Inst.) – mit dem Unterschied, dass die Fragmente entfallen. Die Novellen (Nov.) stehen in zeitlicher Reihenfolge, ohne Einteilung in Bücher. Die größeren Novellen sind in Kapitel unterteilt (z. B. Nov. 98.2).
2Vgl. den Überblick über das vor 1900 in den verschiedenen Gebieten Deutschlands geltende Recht in der 2. Auflage, 8 f.
1. Kapitel
Das altrömische Recht
Auf dem hügeligen Gelände, das später „Rom“ heißen wird, befanden sich um 1000 v. Chr. einige Siedlungen, die überwiegend von Latinern und Sabinern bewohnt waren. Über die Anfänge dieser Siedlungen ist kaum etwas bekannt. Gegen Ende des 7. Jahrhunderts geriet die dort ansässige Bevölkerung unter den Einfluss der Etrusker. Sie sind die eigentlichen Gründer der Stadt Rom. Nach der sagenhaften Überlieferung fällt die Stadtgründung in das Jahr 753 v. Chr., in Wirklichkeit steht aber nicht einmal das Jahrhundert der Gründung fest. Man vermutet, dass der Gründungsakt im Zusammenschluss verschiedener Bevölkerungsgruppen bestanden hat. Etwa zweihundert Jahre regierten in der Stadt etruskische Könige (reges), von denen insbesondere der Name der Tarquinier in Erinnerung geblieben ist. Auch der Name des legendären Gründers und ersten Königs Romulus (Rumelna, Rumele) ist etruskischen Ursprungs.
Unter der Herrschaft der Etrusker begann der eigentliche Aufstieg Roms. Die mit der Stadtbildung verbundene Konzentration der politischen Kräfte und die dadurch bewirkte Verdichtung der Staatlichkeit ermöglichte überhaupt erst die Entwicklung der einheimischen Bevölkerung zu einer Macht. Im Jahre 508 v. Chr. organisierte der römische Adel eine Revolte gegen den etruskischen König Tarquinius Superbus. Nach dessen Vertreibung übernahmen die erfolgreichen Adelsfamilien die Macht im Stadtstaat. Sie hießen Patrizier (patricii), weil sie sich wie Väter (patres) um den Staat gekümmert haben sollen. An dessen Spitze standen Beamte, die man zunächst Prätoren (praeire, vorangehen) und später Konsuln nannte. Nach dem Bericht des römischen Geschichtsschreibers Livius (59 v. Chr.–17 n. Chr.) schwor das Volk, nie wieder einen König über Rom zu dulden. Von der Königszeit grenzte sich die frühe Republik dadurch ab, dass die leitenden Beamten jährlich wechseln mussten (Annuität). Die Annuität, eine Art Rotationsprinzip, war aus Sorge vor [<<25] einer Wiederholung der Geschichte eingeführt worden. Nie wieder sollten sich einzelne Personen zum Herren (dominus, tyrannus, rex) über die römische Bevölkerung emporschwingen können.
Die römische Bevölkerung gliederte sich in zwei soziale Gruppen: Den Patriziern, einer relativ kleinen Gruppe von Adeligen, die über Grundeigentum verfügten, standen die zwar zahlenmäßig überlegenen, wirtschaftlich aber unterlegenen Plebejer gegenüber, die aus zugewanderten auswärtigen Flüchtlingen hervorgegangen waren. Die Rechtsordnung beruhte auf ungeschriebenem Gewohnheitsrecht, das mündlich von einer Generation zur nächsten weitergegeben wurde. Bald kam es zu Spannungen und schließlich zum offenen Kampf zwischen Patriziern und Plebejern. Zwar gelang es einigen plebejischen Familien, in wirtschaftlich und gesellschaftlich bedeutsame Positionen aufzusteigen. Von leitenden politischen Ämtern blieben sie aber weitgehend ausgeschlossen. Unzugänglich waren ihnen insbesondere der Senat (senex, alt, Versammlung der Alten) und die Priesterämter der Auguren und Pontifices.
Die Pontifices waren ausschließlich Patrizier. Wegen der engen Verflechtung von religiösem und weltlichem Leben hatte sich ihre Bedeutung nach Beseitigung des Königtums erheblich vergrößert. Zunehmend bewarben sich auch Politiker um das begehrte Amt des Oberpriesters (pontifex maximus). Als Hüter der Kultrituale und der Technik ihrer Anwendung hatten die Pontifices ein Monopol für die Beratung des Senats und der Privatpersonen über die Richtigkeit und Wirksamkeit kultischer Handlungen. Ihre Befugnis erstreckte sich auch auf Situationen, in denen die Anwendung einer Regel des Gewohnheitsrechts auf einen bestimmten Fall zweifelhaft war. Die Normen, nach denen sie ein Urteil fällten, hielten sie geheim. Juristische Entscheidungen waren daher kaum vorhersehbar. Unter den Plebejern regten sich zunehmend Zweifel an der Unparteilichkeit der Pontifices. Sie argwöhnten, dass juristische Entscheidungen nicht immer frei von eigenem Interesse gefällt wurden und empfanden es daher als besonders schmerzlich, dass ihnen der juristische Bereich verschlossen war. Einen Ausweg hätte die schriftliche Fixierung des Gewohnheitsrechts bieten können. Dadurch wären die grundlegenden Rechtsquellen für jeden Römer zugänglich geworden: Würden die Plebejer ihre Rechte besser kennen, so müssten sie die [<<26] Priesterschaft nicht mehr in jedem Fall um Rat fragen. Um 450 v. Chr., als die einzige Kodifikation, die es in Rom jemals gegeben hat, auf zwölf – vermutlich hölzernen – Tafeln veröffentlicht wurde, hatten die Plebejer ihren ersten großen Erfolg im Ständekampf errungen. 3
1. Das Zwölftafelgesetz
Gesetze dienen der Freiheit, indem sie die Befugnisse von Einzelnen beschränken. „Es ist vorzuziehen“, schreibt bereits Aristoteles, „wenn das Gesetz regiert und nicht ein einzelner Staatsbürger“. Bis heute hat dieser Gedanke seine Gültigkeit bewahrt, alle modernen Kodifikationen lassen sich auf ihn zurückführen. Auch im alten Rom musste er auf fruchtbaren Boden fallen, da Freiheit dort seit der „Vertreibung der Könige“ zu einem Zentralbegriff der Gemeinschaftsordnung geworden war. Merkmale eines freiheitlichen Rechts sind Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit. Rechtssicherheit gewähren die Zwölf Tafeln durch ihre allgemeine, in konfliktträchtigen Bereichen bisweilen pedantisch genaue Aufzeichnung der Normen in Form von Gebotssätzen. Auch Rechtsgleichheit (aequum ius) suchen die Tafeln zu verwirklichen, was in der römischen Geschichtsschreibung als revolutionäre Tat gefeiert wurde. Das Gesetz habe, so Livius, „die Rechte aller, der Hohen und der Niedrigen, gleichgemacht“, es verhindere, dass einzelne zuviel Macht über die anderen bekommen (Römische Frühgeschichte, III, 34). Die Identifikation der „Rechte aller“ mit den Rechten aller Männer lässt Livius freilich nicht danach fragen, ob die Gleichbehandlung vor dem Gesetz für Frauen ebenfalls gelte (S. 39). Auch haben die Tafeln keineswegs alle Standesunterschiede beseitigt. So war etwa das Eheverbot zwischen Patriziern und Plebejern [<<27] zunächst bestehen geblieben. Es ist allerdings schon kurze Zeit später, nach Livius bereits 445 v. Chr., beseitigt worden (lex Canuleia).
Über die Entstehungsgeschichte der Zwölftafelgesetzgebung weiß man nicht viel. Livius zufolge soll eine Kommission aus Rom nach Griechenland gereist sein, um das eigene Recht nach dem Vorbild der um 600 v. Chr. entstandenen athenischen Gesetze aufzuzeichnen. Wahrscheinlich hatte sich in der antiken Welt herumgesprochen, dass die Athener soziale Spannungen durch Gesetzgebung erfolgreich zu entschärfen wussten. Bis heute sind die Gesetze des Solon wegen ihrer Weisheit und die des Drakon wegen ihrer Strenge sprichwörtlich geblieben. Soziale Spannungen bilden aber nicht den einzigen Grund für den Erlass dieser Gesetze. Sie können – zumindest auch – als das Ergebnis eines durch die griechische Erfindung des Alphabets in Gang gebrachten Veränderungsprozesses betrachtet werden. Aus Griechenland stammt der Gedanke, das Recht aufzuzeichnen und die Aufzeichnungen bequem zugänglich zu machen. Die römischen Geschichtsschreiber zeigen sich in eigentümlicher Weise blind für den Anteil des Mediums der Schrift an der Entstehung ihrer Rechtskultur. Dagegen gibt es mehrere Beispiele aus der griechischen Literatur, wo die Rolle der Schrift, insbesondere auch für die Gesetzgebung, gewürdigt wird. So enthält etwa das Stück „Die Hilfeflehenden“ des Euripides eine Stelle, die wegen ihrer Parallelen mit dem Bericht des Livius hier wiedergegeben sei:
Читать дальше