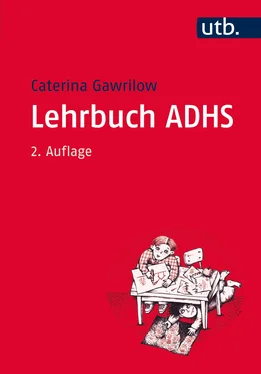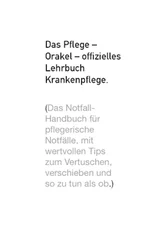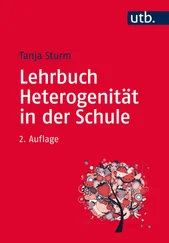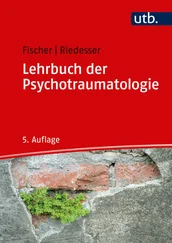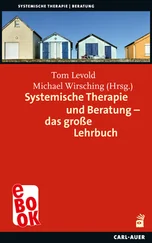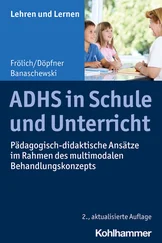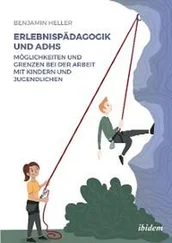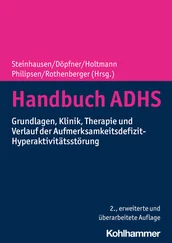4.2.1 Der Einfluss des relativen Lebensalters
Aktuelle Analysen zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, eine ADHS-Diagnose zu erhalten, vom relativen Lebensalter der Kinder abhängt. In umfassenden Analysen von Daten zur Einschulung, zum Alter und zu einer möglichen ADHS-Diagnose von Kindern wurde festgestellt, dass die Kinder, die in ihrer jeweiligen Klasse die jüngeren Kinder sind, eine größere Wahrscheinlichkeit haben, ADHS diagnostiziert zu bekommen. Dies bedeutet also, dass Kinder, deren Lebensalter jünger ist als das ihrer Klassenkameraden, in diesem Gefüge stärker dahingehend mit Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität auffallen, dass sie letztlich eine diagnostische Untersuchung erhalten, welche die Diagnose ADHS bestätigt. Eine Analyse gibt Hinweise darauf, dass dies auf Initiative der jeweiligen Lehrer und nicht der Eltern geschieht. Wichtig ist jedoch, dass dieses Phänomen in den ersten drei Grundschuljahren am stärksten zu beobachten ist. Danach verschwindet der Einfluss des relativen Lebensalters auf die ADHS-Diagnose, was bedeutet, dass es nach dieser Zeit eher irrelevant ist, ob ein Schüler im Vergleich zu den anderen in der Schulklasse relativ jünger ist.

Studien zur Bedeutung des relativen Lebensalters auf ADHS- Diagnose
In den letzten Jahren haben sich vor allem Wirtschaftswissenschaftler mit der Frage des Einflusses des relativen Lebensalters von Kindern auf das Erstellen einer ADHS-Diagnose beschäftigt. Zwei beispielhafte Studien sollen hier berichtet werden. Die Studie von Elder (2010) bedient sich den Daten einer großen Paneluntersuchung. In der Early Childhood Longitudinal Study-Kindergarten Cohort (ECLS-K) des National Center for Education Statistics der USA wurden Eltern- und Lehrerratings zu ADHS-Symptomen, ADHS-Diagnosen und ADHS-Therapien mit MPH erhoben. In die Befragung wurden zu Beginn 18.644 Kindergartenkinder aus über 1.000 Kindergärten im letzten Jahr vor der Einschulung einbezogen. Die erste Befragung fand im Herbst des letzten Kindergartenjahres 1998–1999 statt; im Frühjahr 1999, im Herbst und Frühjahr des Schuljahres 1999–2000 (die meisten Kinder waren in der 1. Klasse), im Frühjahr 2002 (3. Klasse), 2004 (5. Klasse) und 2007 (8. Klasse) fanden weitere Befragungen statt. Zu jedem Zeitpunkt wurden Daten von den Kindern, Eltern und Lehrern erfasst. In dieser Studie wurde festgestellt, dass das relative Lebensalter von Kindern einen starken Einfluss darauf hat, ob Lehrer bei diesen Kindern ADHS-Symptome wahrnehmen oder nicht. Konkret bedeutet dies: Bei Kindern, die im Vergleich zu ihren Klassenkameraden jünger sind (also in einem jüngeren Alter eingeschult worden sind als die anderen Kinder in der Schulklasse) wird von den Lehrern häufiger als bei anderen Kindern ADHS-Verhalten festgestellt. Diesen Effekt gibt es nicht bezüglich der Elternratings: Die Einschätzung des ADHS-Verhaltens durch die Eltern ist also nicht vom relativen Lebensalter abhängig. In dieser Studie hat das relative Lebensalter einen langfristigen Effekt: Die jüngsten Kinder in den Klassen 5 und 8 nehmen doppelt so häufig wie ihre Klassenkameraden MPH zur Behandlung von ADHS ein. Die Ergebnisse dieser Analyse sind unabhängig vom sozioökonomischen und Migrationshintergrund der Kinder.
Evans, Morrill und Parente (2010) führten eine weitere Analyse durch, in die sie Daten verschiedener großer, amerikaweiter Untersuchungen einbezogen (National Health Interview Survey, Medical Expenditure Panel Survey, Daten einer privaten Krankenversicherung). In allen drei Stichproben stellten die Autoren fest, dass Kinder, deren 5. Geburtstag nach dem cut-off Termin für den Schuleingang ist (und die aus diesem Grund bei der Einschulung etwas älter sind als ihre Klassenkameraden) signifikant seltener mit ADHS diagnostiziert werden und auch seltener aufgrund einer ADHS behandelt werden. Der Einfluss des relativen Lebensalters auf eine ADHS-Diagnose konnte also nochmals bestätigt werden.
Die Studien zum Zusammenhang des relativen Lebensalters und der ADHS-Diagnose können jedoch keine Aussagen darüber machen, ob ein Kind, welches erst ein Jahr später eingeschult (also die Einschulung „zurückgestellt“) wird, eine geringere Wahrscheinlichkeit für eine ADHS-Diagnose hat, als wenn es früher eingeschult wird. Eine bedeutende Schlussfolgerung lässt sich jedoch vor allem aus der Studie von Elder (2010) ziehen: Da anscheinend vor allem Lehrer geneigt sind, bei Kindern, die im Vergleich zu ihren Schulkameraden jünger sind, eine ADHS zu vermuten, sollte die ADHS-Diagnostik so differenziert wie möglich sein. Nicht nur eine Einschätzung der Lehrer, sondern auch der Eltern und „objektiver“ Beobachter ist notwendig (→ Kapitel 11).

Vertiefungsfragen
10. Was kennzeichnet typische und beeinträchtigte Aufmerksamkeitsprozesse?
11. Wie sollte ein Diagnostiker mit dem Dilemma umgehen, dass ADHS möglichst früh festgestellt und behandelt werden sollte – aber gleichzeitig auch Ausdruck einer alterstypischen Entwicklung sein könnte?
12. Welchen Einfluss hat das relative Lebensalter auf eine ADHS-Diagnose?
5 Häufigkeit der ADHS
Wie oft tritt ADHS auf? Gibt es Unterschiede der Auftretenswahrscheinlichkeit in verschiedenen Ländern, d. h. gibt es ADHS zum Beispiel in Deutschland häufiger als in den USA? Diese und weitere Fragen sollen in diesem Kapitel behandelt werden ( Tab. 5.1).

Ergebnisse zur ADHS aus den KiGGS-Studien
Die KiGGS-Studien sind große, umfassende Studien des Robert-Koch-Instituts, die Fragen zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland erforschen. An einer ersten Studie aus den Jahren 2003–2006 nahmen 17.641 Mädchen und Jungen im Alter von 0 bis 17 Jahren zusammen mit ihren Eltern teil. Somit konnten erstmals deutschlandweit aktuelle und aussagekräftige Daten zum Gesundheitszustand von Kindern und Jugendlichen gesammelt werden. Neben Daten zum physischen Gesundheitszustand (z. B. körperliche Verfassung der Kinder und Jugendlichen) wurden umfangreiche Daten zur psychischen Gesundheit erhoben und ausgewertet.
Tab. 5.1: Weltweite Prävalenzraten der ADHS
| Quelle |
Prävalenz |
Land |
Anmerkungen |
| Polanczyk et al. (2007) |
5,29 % |
weltweit |
systematisches Review, gepoolte Prävalenz |
| Cuffe et al. (2001) |
1,51 % |
USA |
ältere Jugendliche, DSM-III-R |
| Cuffe et al. (2005) |
4,19 % (Jungen), 1,77 % (Mädchen) |
USA |
im Rahmen des National Health Interview Survey |
| Froehlich et al. (2007) |
8,7 % |
USA |
im Rahmen des National Health and Nutrition Examination Surveys |
| Canino et al. (2004) |
8,0 % |
Puerto Rico |
|
| Ford et al. (2003) |
2,23 % |
UK |
im Rahmen des British Child and Adolescent Mental Health Survey |
| Goodman et al. (2005) |
1,3 %; 1,4 % |
Russland; UK |
nach ICD-10 |
| Huss et al. (2008) |
4,8 % |
Deutschland |
im Rahmen der KiGGS |
| Graetz et al. (2001) |
7,5 % |
Australien |
repräsentative Stichprobe |
| Rohde et al. (1999) |
5,8 % |
Brasilien |
Schulstichprobe |
| Smalley et al. (2007) |
8,5 % |
Finnland |
Geburtenkohorte, jugendlich |
| Kessler et al. (2006) |
4,4 % |
USA |
Erwachsene, National Comorbidity Survey Replication |
| Fayyad et al. (2007) |
4,1 %1,9 %7,3 %3,1 %2,8 %1,8 %1,9 %5,0 %1,2 %5,2 % |
BelgienKolumbienFrankreichDeutschlandItalienLibanonMexikoNiederlandeSpanienUSA |
Erwachsene, im Rahmen der World Health Organization World Mental Health Survey Initiative |
| Simon et al. (2009) |
2,5 % |
|
Erwachsene, Meta-Analyse, gepoolte Prävalenz |
5.1 Aktuelle deutsche Daten zur Häufigkeit von ADHS
Читать дальше