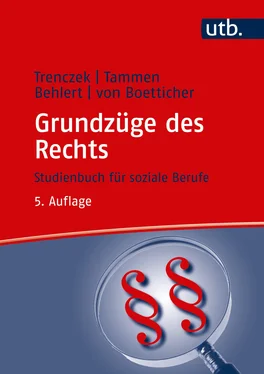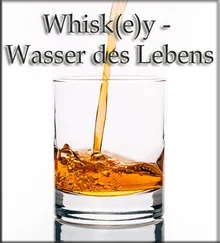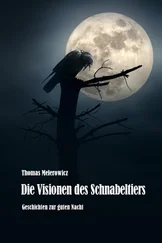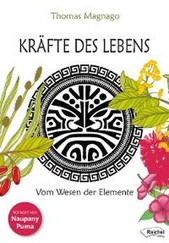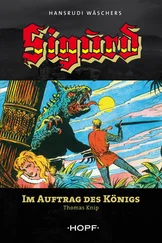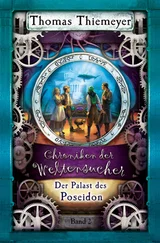Rechtsdienstleistung
In Deutschland ist die Rechtsberatung erlaubnispflichtig und war als sog. geschäftsmäßige Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten nach dem (alten) RBerG grds. „Volljuristen“ (d. h. Personen, die beide juristischen Staatsexamina bestanden haben), insb. den Rechtsanwälten und Notaren vorbehalten (sog. Rechtsberatungsmonopol). Seit Juli 2008 gelten für die außergerichtliche Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten die Regelungen des Rechtsdienstleistungsgesetzes (RDG). Die Befugnis zur Vertretung im Gerichtsverfahren ist in den jeweiligen Prozessordnungen der Gerichte geregelt. § 2 Abs. 1 RDG definiert den Begriff der Rechtsdienstleistung, um diesen von anderen rechtsbezogenen Tätigkeiten abzugrenzen: Rechtsdienstleistung ist jede Tätigkeit in konkreten fremden Angelegenheiten, sobald sie eine rechtliche Prüfung des Einzelfalls erfordert. Keine Rechtsdienstleistung dagegen stellen nach § 2 Abs. 2 RDG die Erstattung wissenschaftlicher Gutachten, die Tätigkeit von Einigungs- und Schlichtungsstellen sowie die Mediation und jede vergleichbare Form der alternativen Streitbeilegung (hierzu I-6) dar. Im Unterschied zu diesen ist die Rechtsdienstleistung erlaubnispflichtig nach § 3 RDG und damit weiterhin im Wesentlichen zugelassenen Rechtsanwälten vorbehalten. Allerdings erlaubt das RDG weitreichende Ausnahmen (vgl. §§ 5 ff. RDG). So sind Rechtsdienstleistungen erlaubt,
■ als Nebenleistung im Zusammenhang der Hauptaufgabe (§ 5 RDG), z. B. Testamentsvollstreckung, Haus- und Wohnungsverwaltung, Fördermittelberatung;
■ unentgeltlich im Familien-, Freundes- und Nachbarschaftskreis oder in der Kirchengemeinde (§ 6 RDG), außerhalb dieses personellen Nahbereichs nur durch einen Volljuristen oder durch diesen angeleitet;
■ durch Berufs- und Interessenvereinigungen (z. B. Gewerkschaften, Mietervereine, Sozialverbände, Automobilklubs) für ihre Mitglieder im Rahmen des satzungsgemäßen Aufgabenbereiches (§ 7 Abs. 1 RDG);
■ durch öffentliche und öffentlich anerkannte Stellen (§ 8 RDG), d. h. gerichtlich oder behördlich bestellte Personen (Nr. 1), Behörden (Nr. 2), die Schuldnerberatungsstellen (Nr. 3), die Verbraucherberatungsstellen (Nr. 4) sowie die Verbände der freien Wohlfahrtspflege im Sinne des § 5 SGB XII, die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe im Sinne des § 75 SGB VIII und die nach § 15 Abs. 3 BGG anerkannten Verbände zur Förderung der Belange von Menschen mit Behinderung (Nr. 5).
Wer auch immer Rechtsdienstleistungen erbringt, muss nach § 7 Abs. 2 RDG über die zur sachgerechten Erbringung dieser Rechtsdienstleistungen erforderliche personelle, sachliche und finanzielle Ausstattung verfügen (vgl. auch § 6 Abs. 2 RDG). Schon deshalb sollten die Fachkräfte der Sozialen Arbeit (vgl. § 72 SGB VIII, § 6 SGB XII) im juristischen Denken und in der Rechtsanwendung geschult sein. Wenn die Beratung nicht unmittelbar durch einen Rechtsanwalt / Volljuristen erfolgt, muss eine qualifizierte juristische Anleitung durch einen Rechtsanwalt oder sonstigen Volljuristen sichergestellt sein (§ 6 Abs. 2 S. 2 RDG).Hierzu reichen ggf. auch Kooperationsvereinbarungen mit (externen) Rechtsanwälten aus (z. B. regelmäßige Beratungssprechstunde eines Rechtsanwalts für Klienten und Mitarbeiter eines Jugendklubs, Gemeindetreffs, Selbsthilfevereins).
Rechtsberatung durch soziale Dienste
Die Fachkräfte der öffentlichen Jugend- und Sozialbehörden dürfen nicht nur, sie müssen im Rahmen ihrer Zuständigkeit Rechtsberatung leisten (§ 14 SGB I), die Sozialämter z. B. in allen mit der Sozialhilfe zusammenhängenden Fragen (vgl. §§ 10 Abs. 2, 11 SGB XII). Die Beratungspflicht und -erlaubnis ist allerdings inhaltlich begrenzt und erstreckt sich nicht auf die über den spezifischen Zuständigkeitsbereich hinausgehende, allgemeine rechtliche Konfliktbewältigung. So dürfen z. B. im Rahmen der Trennungs- und Scheidungsberatung nach § 17 SGB VIII die Klienten der Jugendämter rechtlich nur beraten werden, soweit dies vom Handlungsauftrag der Kinder- und Jugendhilfe gedeckt ist. Dabei darf in einer Beratung in einer sozialen Angelegenheit auch auf Rechtsfragen aus sonstigen Rechtsgebieten eingegangen werden, wenn dies aus Sorge um das Wohl der Kinder und ihrer Familien notwendig ist, so z. B. bei rechtlichen Hinweisen, die im Zusammenhang mit der persönlichen Hilfe in einer besonderen Lebenslage gegeben werden (etwa Aufklärung über die rechtlichen Folgen einer Scheidung; nicht aber z. B. die Regelung der Haushalts- oder Vermögensauseinandersetzung). Mit der persönlichen Hilfe nach dem SGB ist die Rechtsberatung umfasst, nicht aber die rechtliche Vertretung oder gerichtliche Durchsetzung von Ansprüchen. Eine Ausnahme bilden die rechtsbezogenen Tätigkeiten, die auf die Erlangung von Rechtsberatungs- und Prozess- bzw. Verfahrenskostenhilfe (s. u.) gerichtet sind (vgl. LG Stuttgart 21.6.2001 – 5 KfH O 21 / 01 –info also 2001, 169).
Im strafrechtlichen Bereich (s. IV-6) haben sowohl die sozialen Dienste (des JA im Rahmen der Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, sog. JGH, sowie die Gerichts- und Bewährungshilfe) eine Rechtsberatungskompetenz (vgl. § 8 Abs. 1 Nr.2 RDG) als auch die freien Träger der Jugend- und Straffälligenhilfe (§ 8 Abs. 1 Nr. 5 RDG). Das Gleiche gilt für den sog. Beistand im Jugendstrafverfahren, der zudem ein Akteneinsichtsrecht und in der Hauptverhandlung die gleichen Rechte wie ein Verteidiger hat (§ 69 JGG). Gerichtlich bestellte Betreuer (§§ 1896 ff. BGB) als gesetzliche Vertreter insb. geschäftsunfähiger Personen (hierzu II-2.4.3.2) und die Verfahrensbeistände nach §§ 158, 174 FamFG (sog. Anwalt des Kindes, hierzu II-2.4.6.4) bzw. Verfahrenspfleger (§§ 276, 317 FamFG) gehören zu den gerichtlich bestellten Personen i. S. d. § 8 Abs. 1 Nr. 1 RDG, denen die Erbringung von Rechtsdienstleistungen erlaubt ist.
Die kirchlichen Beratungsdienste von Caritas und Diakonie sind aufgrund des besonderen Rechtsstatus der Kirchen als Körperschaften des Öffentlichen Rechts (vgl. Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 Abs. 5 Weimarer Verfassung) den öffentlichen Sozialleistungsträgern nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 RDG gleichgestellt. Sie sind deshalb zur Rechtsdienstleistung berechtigt, i. d. R. aber nicht zur Abfassung von Schriftsätzen oder zur Prozessvertretung (vgl. noch unter Geltung des RBerG LG Stuttgart info also 2001, 167 ff.).
Rechtsberatungshilfe
Für Rechtsuchende (nach § 116 Nr. 2 ZPO auch juristische Personen wie Vereine oder GmbHs) mit beschränkten finanziellen Ressourcen ermöglicht das BerHG den Zugang zu einer nicht behördlichen, vor allem anwaltlichen Rechtsberatung außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens und im obligatorischen Güteverfahren nach § 15a EGZPO (ausführlich Groß 2013). Die Beratungshilfe besteht bei zivil-, arbeits-, verwaltungs-, sozial-, steuer- und verfassungsrechtlichen Angelegenheiten nicht nur in der bloßen Beratung und Information, sondern soweit erforderlich auch in der Vertretung nach außen. Ist man in den Verdacht geraten, eine strafbare Handlung oder eine Ordnungswidrigkeit begangen zu haben, so kann man sich zwar beraten lassen, erhält jedoch über die Beratungshilfe keine Vertretung oder Verteidigung (vgl. § 2 Abs. 2 BerHG). Die Beratungshilfe ist grds. auf das deutsche Recht begrenzt; im Hinblick auf ausländisches Recht greift sie nur, wenn der Sachverhalt einen Bezug zum Inland hat. Bei Streitsachen innerhalb der EU mit grenzüberschreitendem Bezug wird Beratungshilfe für die vorprozessuale Rechtsberatung im Hinblick auf eine außergerichtliche Streitbeilegung sowie zur Unterstützung bei Anträgen auf Prozesskostenhilfe im Ausland gewährt (§ 10 Abs. 1 BerHG).

Nach § 1 BerHG erhält auf Antrag Beratungshilfe, wer die erforderlichen Mittel nach seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen nicht aufbringen kann, wenn keine anderen zumutbaren Möglichkeiten der Rechtsberatung zur Verfügung stehen (z. B. aufgrund einer Rechtsschutzversicherung, durch die Sozialverwaltung, Gewerkschaften, Verbände oder z. B. durch die öffentlichen Rechtsauskunftstellen, wie die ÖRA in Hamburg, http://www.hamburg.de/oera/;vgl. die Sonderregelungen für Berlin und Bremen) und die Wahrnehmung der Rechte nicht mutwillig ist (z. B. bereits bei einer anderen Stelle erfolgt ist). Mutwillig wäre es nach § 1 Abs. 3 BerHG auch, wenn ein Rechtsuchender bei verständiger Würdigung aller Umstände der Rechtsangelegenheit ohne Beratungshilfe davon absehen würde, sich auf eigene Kosten rechtlich beraten oder vertreten zu lassen. Bei der Beurteilung der Mutwilligkeit sind die Kenntnisse und Fähigkeiten des Antragstellers sowie seine besondere wirtschaftliche Lage zu berücksichtigen. Einem Beschwerdeführer kann aber nicht zugemutet werden, den Rat derselben Behörde in Anspruch zu nehmen, deren Entscheidung er im Widerspruchsverfahren angreifen will (BVerfG 11.05.2009 - 1 BvR 1517 / 08 – info also 2009, 170-173).
Читать дальше