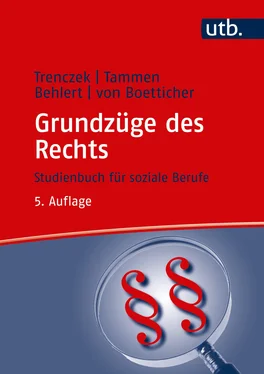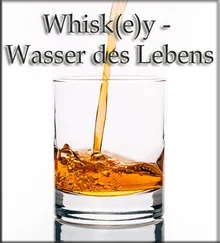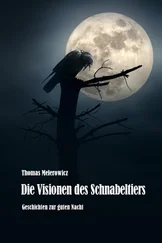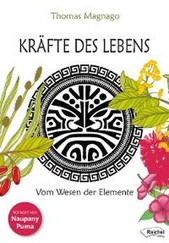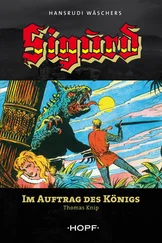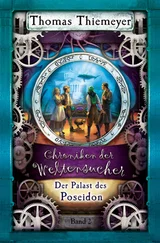Darüber hinaus nehmen die Kommunen auch Staatsaufgaben wahr, und zwar im Auftrag und ggf. nach Weisung des Landes bzw. Bundes. Man spricht hier von Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis (Auftragsangelegenheiten oder Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung), z. B. im Bereich des Polizei- und Ordnungsrechts, im Bereich des Feuerschutzes, der Wohnungsbauförderung, der Ausbildungsförderung (vgl. § 39 Abs. 1 BAföG i. V. m. z. B. § 2 Abs. 1 SächsAG BAföG), im Asylbewerberleistungsrecht und Flüchtlingsaufnahmegesetz; Auftragsangelegenheiten sind auch die Wehrerfassung nach § 15 Wehrpflichtgesetz, die Lebensmittelüberwachung und Gaststättenkontrolle oder das Handeln der Straßenverkehrsämter (Kfz-Zulassungsstelle und Fahrerlaubnisbehörde) sowie der Standesämter nach dem Personalstandsgesetz (aufgrund der Föderalismusreform darf der Bund seit 2006 den Gemeinden keine neuen Aufgaben mehr übertragen, Art. 84 Abs. 1 GG). Insoweit handelt es sich um eine Staatsverwaltung durch die Kommunen.
Schwierig zu verstehen ist der Aufgabendualismus der Kommunen auch deshalb, weil es unter den Bundesländern unterschiedliche Modelle der organisatorischen Zuordnung gibt. So handeln in einigen Ländern (z. B. Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, NRW) insb. die Landkreise als untere staatliche Landesbehörde (man spricht hier davon, dass die Kommunen dem Staat ihre „Organe leihen“), womit sie unmittelbar in die staatliche Verwaltungshierarchie eingebunden sind. In den anderen Bundesländern (z. B. Niedersachsen, Saarland, Sachsen) geht man davon aus, dass die Landkreise auch die Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis eigenverantwortlich wahrnehmen und deshalb im organisationsrechtlichen Sinne nicht als untere Landesbehörde gelten.
Übersicht 18: Wirkungskreis der Kommunalverwaltung
| Wirkungskreis |
| Selbstverwaltung (eigener Wirkungskreis) |
Staatliche Aufgaben (übertragener Wirkungskreis) Gesetzl. Auftragsangelegenheiten oder sog. Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung |
| Originäre Selbstverwaltung |
Gesetzliche Verpflichtung |
des Bundes |
des Landes |
| z. B. Kultur- und Freizeiteinrichtungen |
Sozial- und Jugendhilfe |
Ausbildungsförderung, Personenstandsaufgaben, Wehrerfassung, Asylbewerberleistungen, Wohnungsbauförderung |
Schulen Aufgaben nach PsychKG |
| Rechtsaufsicht |
Rechtsaufsicht |
Fachaufsicht mit Weisungsmöglichkeit |
Die Unterscheidung in Aufgaben des eigenen (Selbstverwaltungsaufgaben) oder des übertragenen Wirkungskreises (Staatsaufgaben; s. Übersicht 18) hat Bedeutung vor allem für die Finanzierung und Kontrolle der Verwaltung. Im Rahmen der übertragenen staatlichen Aufgaben unterliegen die Gemeinden der Fachaufsicht des Landes, bei den Selbstverwaltungsaufgaben dagegen „nur“ der Rechtsaufsicht (hierzu 5.2.1). Die sog. Finanzhoheit umfasst auch das Recht der Kommunen, im Rahmen der Gesetze Kommunalabgaben (insb. Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Getränkesteuer; Gebühren und Beiträge) zu erheben. Von der Lohn- und Einkommensteuer erhalten sie einen Anteil von 15 % und von der Umsatzsteuer 2,2 %. Zusammen machen diese Einnahmen allerdings nur ca. 15 % der Steuereinnahmen der Kommunen aus (Bogumil / Holtkamp 2013, 20). Im Juni 2016 haben sich Bund und Länder auf eine Entlastung der Kommunen in Höhe von 5 Mrd. € u. a. durch Erhöhung ihres Anteils an der Umsatzsteuer geeinigt, um dadurch die gestiegenen Kosten in der Eingliederungshilfe zu kompensieren (s. III-4.2.4.2 und III-5.3.4; umgesetzt durch Gesetz vomx 01.12.2016, BGBl. I S. 2755).
Übertragen die Bundesländer staatliche Aufgaben auf die Kommunen, müssen sie diesen nach ihren Landesverfassungen auch die dafür erforderlichen Mittel bereitstellen (sog. Konnexitätsprinzip). Teilweise beklagen sich die Kommunen darüber, dass der Gesetzgeber sie zu Aufgaben und Leistungen verpflichtet und dabei (zu Recht!) einheitliche Regelungen im Hinblick auf die soziale Grundversorgung und fachliche Mindeststandards fordert, ohne gleichzeitig eine ausreichende Finanzierung hierfür sicherzustellen (vgl. die erfolgreiche Verfassungsbeschwerde von mehreren Städten und Kreisen in NRW im Hinblick auf die finanzielle Mehrbelastung der Kommunen durch den durch das KiFöG geforderten Ausbau der Kinderbetreuung: VerfGH NRW 12.10.2010 – VerfGH 12 / 09 – NVwZ-RR 2011, 41 = JAmt 2011, 52). Aber auch ohne die Übertragung neuer Aufgaben überfordern Art und Umfang der (Selbstverwaltungs-)Aufgaben mittlerweile die Finanzkraft vieler Kommunen.
Behörde
Vom Träger der öffentlichen Verwaltung begrifflich zu unterscheiden ist die „Behörde“. Der Begriff wird im Sozialverwaltungsrecht durch § 1 Abs. 2 SGB X funktional bestimmt (vgl. § 1 Abs. 4 VwVfG). Behörden sind alle organisatorischen Einheiten, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung – selbstständig und gegenüber dem Bürger in eigenem Namen – wahrnehmen und die insb. mit der Befugnis zum Erlass von Verwaltungsakten (s. u. III-1.3) ausgestattet sind. Das trifft z. B. auf die Jobcenter nach §§ 6, 6d SGB II (s. III-4.1.3) ebenso zu wie auf die Sozialversicherungsträger. Die gesetzlichen Krankenkassen (z. B. AOK, Ersatzkassen), Berufsgenossenschaften und die Deutsche Rentenversicherung sind deshalb Behörden i. S. d. § 1 Abs. 2 SGB X.
Ämter
Keine Behörden sind dagegen grds. die einzelnen (funktionalen) Dienststellen (Ämter, Referate, Sachgebiete) eines Verwaltungsträgers, soweit sie nicht über eine organisatorische Eigenständigkeit verfügen, wie z. B. das Finanzamt als Ortsbehörde der Finanzverwaltung (zu dem vom „Amt“ bzw. der „Behörde“ zu unterscheidenden funktionellen Stellenbegriff im Hinblick auf den Datenschutz s. III-1.2.3). So ist z. B. das Sozialamt ebenso wie das Bau- oder Ordnungsamt unselbstständiger Teil der Kommunalverwaltung. Behörde der Kommunalverwaltung ist deshalb grds. der nach außen handelnde Teil (Organ) der Kommunalverwaltung, also der (Ober-)Bürgermeister bzw. der Landrat. Deshalb erlässt dieser formal den z. B. vom Sozialamt erarbeiteten Bewilligungsbescheid über Sozialhilfeleistungen. Die Mitarbeiter der Kommunalverwaltung (welchen Amtes auch immer) handeln gleich auf welcher Ebene oder in welcher Abteilung immer in dessen Auftrag. Soweit das Gesetz allerdings funktionalen Einheiten der Kommunalverwaltung ausdrücklich besondere Aufgaben zuweist, wie dem JA z. B. in §§ 8a, 42 SGB VIII, kann man durchaus von einer Behörde i. S. d. § 1 Abs. 2 SGB X sprechen. Im Hinblick auf das JA ist auch zu beachten, dass das SGB VIII der kommunalen Organisationshoheit Grenzen setzt und z. B. ein selbstständiges JA mit einem zweigleisigen Verwaltungsaufbau (Verwaltung und Jugendhilfeausschuss) vorschreibt (s. III-3.2.3). Mittlerweile ist durch die Föderalismusreform (2006) den Bundesländern die Befugnis übertragen worden, vorrangige Regelungen zur Behördenorganisation und deren Zuständigkeit zu treffen.
Gesundheitsämter sind entweder staatliche Behörden der Landesverwaltung (z. B. die Gesundheitsämter in Baden-Württemberg und Bayern als untere Gesundheitsbehörden in den kreisfreien Städten und Landkreisen) oder kommunale Behörden (vgl. z. B. § 2 Abs. 1 S. 2 NGöGD). Gesetzliche Grundlage für die Arbeit der Gesundheitsämter sind die Landesgesundheitsgesetze (Gesetze über den öffentlichen Gesundheitsdienst) bzw. rechtliche Vorschriften auf Bundesebene wie das Infektionsschutzgesetz und die Trinkwasserverordnung. Aufgaben der Gesundheitsämter sind u. a. der Amtsärztliche sowie der Sozialpsychiatrische Dienst, der Infektionsschutz und die Aids-Beratung, die Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatung sowie die Hygieneüberwachung.
Schulämter sind staatliche Behörden für ein bestimmtes Gemeindegebiet. Nach den Schulgesetzen der Bundesländer unterscheidet man staatliche und kommunale Aufgaben. Das Land ist zuständig für die Lehrer und die (pädagogischen) Fachinhalte im Bereich der Schulen, während sich die Städte und Landkreise als Träger ihrer Schulen für die baulichen Anlagen, deren Ausstattung und Betrieb, die sächlichen Kosten sowie die personelle Besetzung der Schulsekretariate und Hausmeisterstellen verantwortlich zeichnen.
Читать дальше