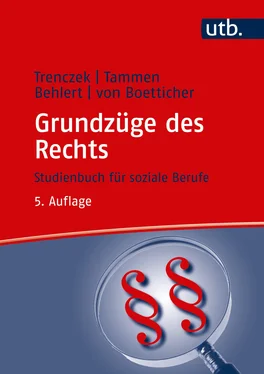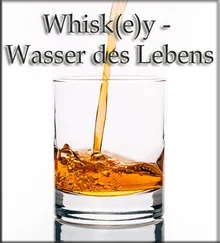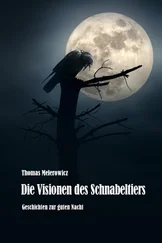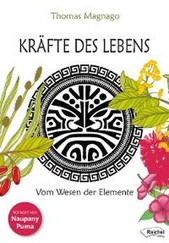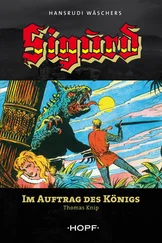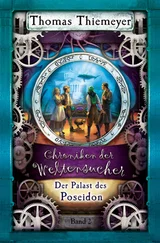4.1.2.2 Privatrechtlich organisierte Träger
Neben den juristischen Personen des Öffentlichen Rechts gibt es auch solche des Privatrechts, die ebenso wie natürliche Personen Träger von Rechten und Pflichten sein können (Rechtsfähigkeit, hierzu II-1). Wie bereits beschrieben (s. o. Verwaltungsprivatrecht, 1.1.4), kann die öffentliche Verwaltung ihre Aufgaben nicht nur durch öffentlich-rechtliches Verwaltungshandeln, sondern auch in privatrechtlichen Rechtsformen erbringen (z. B. kommunale Wohnungsbau GmbH).
Beleihung
Der Staat kann darüber hinaus auch anderen, nicht von ihm selbst gegründeten juristischen Personen des Privatrechts oder natürlichen Einzelpersonen aufgrund eines Gesetzes Aufgaben der öffentlichen Verwaltung übertragen. Es handelt sich dabei aber nicht um eine Privatisierung, da die wahrzunehmende Aufgabe nach wie vor von einer Stelle erledigt wird, deren Handeln dem Staat zugerechnet wird. Von „Beleihung“ und „beliehenen Unternehmern“ spricht man nach h. M. allerdings erst, wenn dem Privaten zur Wahrnehmung der ihm überlassenen Zuständigkeiten zugleich auch öffentlich-rechtliche Hoheitsbefugnisse (insb. zum Erlass von VAs; Eingriffskompetenzen) übertragen werden. Die Übertragung der öffentlichen Rechtsmacht ist für die Beleihung konstitutiv, ansonsten handelt es sich lediglich um Verwaltungshelfer oder eine sog. Indienstnahme Privater im öffentlichen Interesse. Bekannte Alltagsbeispiele sind der TÜV oder die DEKRA, die als Vereine hoheitliche Aufgaben der Verkehrssicherheit wahrnehmen (vgl. §§ 29, 47 Abs. 9, 47a Abs. 5 StVZO, Anlage VIIIB zur StVZO). Beliehene Unternehmer sind aber auch die Notare, Bezirksschornsteinfeger und Seeschifffahrtskapitäne. Privatschulen sind dann Beliehene, wenn sie öffentlich („staatlich“) anerkannt sind; dann sind sie staatlichen Schulen gleichgestellt, dürfen Prüfungen abhalten und berechtigende Zeugnisse ausstellen. In all diesen Fällen liegt mittelbare Staatsverwaltung vor. Aber auch ohne Übertragung von Hoheitsbefugnissen sind von den Privatpersonen die rechtlichen Grenzen staatlichen Handelns einzuhalten, wenn sie öffentliche Aufgaben wahrnehmen. Der Staat kann sich seiner Verantwortung und Rechtsbindung nicht durch die Einbeziehung privatrechtlicher Personen entziehen (s. 1.1.4).
freie Träger
Keine Beleihung liegt grds. bei den sog. freien, d. h. nach den Regeln des Privatrechts (z. B. als Verein, GmbH, aber auch als Einzelperson; hierzu II-1.1.1) organisierten Trägern der Sozial- und Jugendhilfe vor. Zu diesen gehören insb. die in der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossenen sechs Spitzenverbände (vgl. § 75 Abs. 3 SGB VIII):
Träger der freien Wohlfahrtspflege
■ Arbeiterwohlfahrt
■ Caritasverband
■ Deutsches Rotes Kreuz
■ Diakonisches Werk
■ Paritätischer Wohlfahrtsverband
■ Zentralwohlfahrtsverband der Juden in Deutschland
Neben diesen können sowohl andere Organisationen, die im Sinne des § 52 AO gemeinnützig tätig sind, als auch frei-gewerbliche (gewinnorientierte) Organisationen als Leistungsanbieter auftreten. Als „frei“ bezeichnet man diese Träger, weil sie aufgrund ihres autonomen Betätigungsrechts handeln und nicht in Erfüllung staatlicher Aufgaben. Sie sind nicht für die Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen verantwortlich (vgl. z. B. § 3 Abs. 2 S. 2 SGB VIII; § 5 Abs. 5 SGB XII) und damit auch nicht Träger der öffentlichen Sozialverwaltung. Als zivilgesellschaftliche Akteure können sie aus karitativen, humanitären, politischen oder kommerziellen Gründen im Rahmen der Sozialen Arbeit tätig werden, müssen es aber nicht. Freie Träger werden aber gerade im Bereich der Sozialen Arbeit des Sozialrechts sehr häufig von den öffentlichen Sozialleistungsträgern bei der Erbringung von Sozialleistungen, insb. Dienstleistungen, eingebunden und somit die freien Träger durch die öffentliche Hand zumindest teilweise refinanziert, sei es über Zuwendungen (Subventionen) für Projekte (zur Problematik der Subventionszuwendung aufgrund europäischen Rechts s. 1.1.5.1 a. E.; von Boetticher / Münder 2009; Münder / Trenczek 2015, 324 ff.) oder zunehmend aufgrund von Leistungs- und Entgeltvereinbarungen (zum sozialrechtlichen Leistungsdreieck s. III-1.1). Nach dem sog. Subsidiaritätsprinzip (s. 2.1.3), sollen die öffentlichen Träger der Jugend- bzw. Sozialhilfe von der Durchführung eigener Leistungen absehen, wenn diese von freien Trägern erbracht werden (können) (sog. Betätigungsvorrang freier Träger; § 4 Abs. 2 SGB VIII; § 5 Abs. 4 SGB XIII). Die Übertragung von Aufgaben schließt aber die Übertragung von Hoheitsbefugnissen (also die Beleihung) grds. nicht mit ein. Auch wenn freie Träger im Auftrag eines öffentlichen Trägers tätig werden, agieren sie gegenüber ihren Klienten in privatrechtlichen Rechtsformen.
Kirchen und Religionsgemeinschaften
Auch die katholische Kirche und die Mitgliedskirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) sowie der Zentralrat der Juden in Deutschland gelten aus historischen Gründen in Deutschland als Körperschaften des öffentlichen Rechts (vgl.Art. 140 GG i. V. m.Art. 137 Abs. 5 Weimarer Reichsverfassung), sie gehören aber nicht zur mittelbaren Staatsverwaltung. Ihre Wohlfahrtsorganisationen, der Deutsche Caritasverband (und seine Mitgliedsorganisationen), das Diakonische Werk (bzw. seine Landesverbände) sowie die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, sind i. d. R. als Vereine (II-1.1.1) organisiert und werden wie die Kirchen selbst (vgl. z. B. § 75 Abs. 3 SGB VIII) den freien, nicht staatlichen Trägern zugerechnet. Andere Religionsgemeinschaften, wie die muslimischen Glaubensgemeinschaften, kommen nicht in den Genuss des historischen Privilegs und erwerben die Rechtsfähigkeit nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts (Art. 140 GG i. V. m.Art. 137 Abs. 4 Weimarer Reichsverfassung). Sie sind ebenso wie ihre Wohlfahrtsorganisationen i. d. R. als Verein organisiert, z. B. Zentralrat der Muslime in Deutschland e. V., Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland e. V., Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e. V. (DITIB) und Verband Islamischer Kulturzentren e. V. (VIKZ).

Blanke et al. 2011; Bogumil / Holtkamp 2013; Maurer / Waldhoff 2017; Papenheim et al. 2015, Kap. 5 – 15; Wolff / Bachof et al. 2010/2017
4.2 Rechtsberatung
Recht haben und Recht bekommen ist zweierlei – so lautet ein geflügeltes Wort. Viele Menschen wissen nicht, welche Rechte und Pflichten sie haben. Intellektuelle, emotionale und materielle Zugangshindernisse verhindern oft, dass Hilfe- und Ratsuchende zu ihrem Recht kommen. Die Sprache der öffentlichen Verwaltung und Justiz ist die Rechtssprache und als solche überwiegend schriftlich fixiert. Fachkräfte der psychosozialen Arbeit müssen deshalb hier sehr häufig eine Dolmetscherfunktion übernehmen. Die Information über die den Bürgern zustehenden Rechte und Wege zu ihrer Verwirklichung gehört deshalb zu den Grundpfeilern eines sozialen Rechtsstaats.
Beratung
Nach § 13 SGB I sind alle Sozialleistungsträger und ihre Verbände im Rahmen ihrer Zuständigkeit verpflichtet, die Bevölkerung über ihre Rechte und Pflichten nach dem SGB aufzuklären. Dies tun sie in der Regel mit Informationsbroschüren, Plakaten, der Internetpräsenz, mit Informationsveranstaltungen oder durch die Erteilung von Auskünften (vgl. § 15 SGB I). Darüber hinaus hat aber jeder Bürger Anspruch auf individuelle Beratung über seine Rechte und Pflichten nach dem SGB (§ 14 SGB I, vgl. auch §§ 10 Abs. 2, 11 SGB XII). Beratung als wesentlicher Bestandteil der Sozialen Arbeit besteht also nicht nur in der non-direktiven Vermittlung neuer Einsichten zur Bewältigung von Lebensschwierigkeiten, sondern ist in vielen Fällen vor allem Rechtsberatung. Oft sind beide Bereiche, Lebens- und Rechtsberatung, untrennbar miteinander verknüpft, z. B. in der Schuldnerberatung, der Trennungs- und Scheidungsberatung, der Pflege- sowie der unabhängigen Teilhabeberatung (§ 32 SGB IX, tritt zum 01.01.2018 in Kraft). Auch die Rechtsberatung ist eine Form der persönlichen Hilfe, die den Ratsuchenden neue Handlungsoptionen erschließen kann. Schon deshalb müssen Sozialarbeiter in Rechtsfragen besonders bewandert sein. Gerade hierin liegt ihre spezifische, die psychosozialen Qualifikationen ergänzende Handlungskompetenz. Beratung geht über die bloße Information über zustehende Rechte hinaus und beinhaltet auch die Aktivierung des Leistungsberechtigten, sodass er ihm zustehende Ansprüche geltend machen kann (u. U. kann hier sogar eine Formulierungshilfe geboten sein). Von wesentlicher Bedeutung ist aber vor allem die Klärungshilfe im Hinblick auf den zugrunde liegenden Konflikt (zur Mediation vgl. 6.3).
Читать дальше