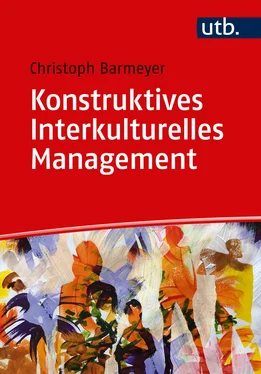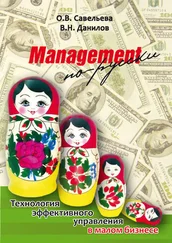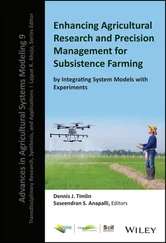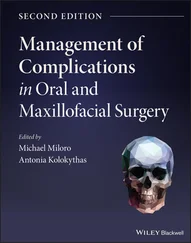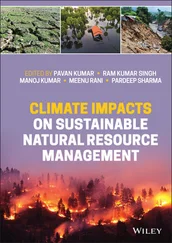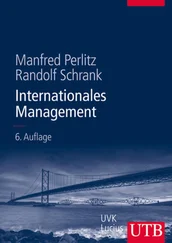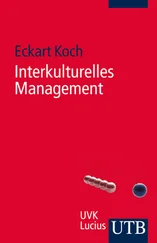Christoph Barmeyer - Konstruktives Interkulturelles Management
Здесь есть возможность читать онлайн «Christoph Barmeyer - Konstruktives Interkulturelles Management» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Konstruktives Interkulturelles Management
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Konstruktives Interkulturelles Management: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Konstruktives Interkulturelles Management»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Konstruktives Interkulturelles Management — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Konstruktives Interkulturelles Management», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Konstruktiver Umgang mit Kultur-Konzepten
Im Sinne Konstruktiver Interkulturalität illustrieren die drei vorgestellten Kultur-Konzepte die identitätsbildende und sinnstiftende Orientierungs- und Ordnungsfunktion, die Kultur hat, und es Individuen ermöglicht, sich innerhalb eines sozialen Systems zurechtzufinden und in einer Gruppe oder Gesellschaft dauerhaft mit möglichst wenigen Widersprüchen miteinander zu leben.
Einerseits stellt sich die Frage der Entwicklung und Veränderung bezüglich der drei Kulturkonzepte, denn mit der Entwicklung von Gesellschaften sind auch Kulturkonzepte einem Wandel unterworfen. Inwiefern sind sie davon betroffen? Aufgrund zunehmender Multikulturalität von Gesellschaften durch Zuwanderung von Menschen mit Migrationshintergrund wird sich eine Plurikulturalität herausbilden, mit vielen bikulturellen Menschen, der sogenannten Third Culture Individuals (TCI) (Moore/Barker 2012) oder Third Culture Kids (TCK) (Pollock et al. 2003). TCI bzw. TCK bezeichnet Jugendliche, die in der Phase des Heranwachsens diversen interkulturellen Einflüssen ausgesetzt sind, etwa aufgrund häufiger Wohnortwechsel und Schulbesuchen in unterschiedlichen Ländern oder der Erziehung durch Elternteile, die aus unterschiedlichen Gesellschaften stammen.
Anderseits ist die Überlegung interessant, wie Akteure auf Kultur und Interkulturalität einwirken können. Hier wird deutlich, dass es unterschiedliche Beeinflussungsgrade gibt: Das Wertesystem eines Menschen ist nur schwer und langsam entwickelbar. Es gilt vor allem, dieses zu kennen und zu verstehen. Bedeutungssysteme dagegen lassen sich durch kulturelles Wissen – vor allem Sprache – erweitern und nach und nach durchdringen. Was Problemlösungen betrifft, so gibt es viele Möglichkeiten der Einwirkung: Welche neuen, alternativen Lösungen lassen sich finden, um konstruktiv zielführend zu handeln? Es ist wichtig, sich der komplementären drei Kulturbegriffe bewusst zu sein und diese anzuerkennen, um sie dann gestalterisch zu nutzen. Um die Kulturkonzepte konstruktiv zu behandeln, braucht es vor allem kulturelle Mittler, Boundary Spanner, die an – interdisziplinären und internationalen – Schnittstellen sozialer Systeme agieren, v. a. beim Übersetzen zwischen den unterschiedlichen Zeichensystemen (Barner-Rasmussen et al. 2014). Hier wiederum spielen TCI bzw. TCK eine zentrale Rolle: Durch ihre interkulturelle Sozialisation haben sie mehrere kulturelle Wertesysteme verinnerlicht, die ihnen eine offenere und ethnorelativistische Weltsicht bieten. Ebenso beziehen sie sich auf unterschiedliche Referenz- und Orientierungssysteme, die es ihnen ermöglichen, verbales und nonverbales Verhalten bewusster wahrzunehmen und vielleicht treffender zu interpretieren. Bezogen auf die Problemlösung steht ihnen ein großes Handlungsrepertoire zu Verfügung, in interkulturellen Situationen kreativ und auch integrativ zu wirken. Somit sind TCK insofern konstruktiv, als dass genau sie als Personen an Schnittstellen zwischen Kulturen eingesetzt werden können, um zwischen a) Wertesystemen, b) Bedeutungssystemen und c) Problemlösungssystemen zu vermitteln und zu schlichten.
Multiple Kulturen und kulturelle Dynamik
Seit langer Zeit äußern sowohl die Wissenschaftler der Interkulturalität als auch Sozial- und Geisteswissenschaftler Kritik an den in Forschung und Praxis verwendeten Kulturkonzepten, die sich vor allem auf Nationalkulturen beziehen (McSweeney 2009). Dabei wird vor allem kritisiert, dass sich Kulturkonzepte häufig auf eine mehr oder weniger homogene Gesellschaft beziehen und diese als ›autonome Insel‹ betrachten, die von äußeren Einflüssen nicht oder kaum tangiert werden. Metaphorisch ausgedrückt stellen viele Kulturbegriffe ›Korsette‹ dar, die von der Mannigfaltigkeit moderner kultureller Systeme gesprengt werden. Deshalb kritisieren einige wissenschaftliche Vertreter generell an interkultureller Praxis und Forschung die als zu homogen eingestuften Kulturbegriffe (Dahlén 1997; Moosmüller 2004). D’Iribarne unterstreicht, dass der Bezugspunkt der Nationalkultur nicht dazu dient, ihre Spezifika »nur« hervorzuheben, sondern dass es um die Analyse und das Verstehen von Besonderheiten geht:
»When national cultures are concerned, the aim is not to highlight the supposedly persisting characteristics of certain cultures. It is rather a matter of analysing how, within a given organisation, the encounter of people coming from different societies and with different habits leads to the emergence of a specific culture, understood as a common way of doing things.« (D’Iribarne 2009, 310–311)
Multiple Kulturen
Eine zentrale Frage ist, in welchem Ausmaß Individuen ihre kulturelle Prägung in Denken, Fühlen und Handeln auch leben, also inwiefern sie »typische« Repräsentanten ihrer Kultur sind – oder nicht. Brannen (1998) verweist darauf, dass nicht nur der Kontext zu beachten ist, in dem Interkulturalität stattfindet, sondern auch die kulturellen Charakteristika der Akteure. Zurecht wird der monolitisch-funktionalistische und nationale Kulturbegriff als zu deterministisch kritisiert. Akteure in interkulturellen Organisationen sind durch viele unterschiedliche kulturelle Einflüsse geprägt und weisen insofern viele pluralistische kulturelle und identitäre Bezugspunkte auf, die weit vielfältiger sind als nur die Prägung durch eine nationale Kultur. Diese Pluralität wird u. a. von verschiedenen Ansätzen thematisiert: multiple cultures (Sackmann/Phillips 2004), Fuzzy Diversity (Bolten 2010b) oder Fuzzy Cultures (Bolten 2011, 2014).
Entsprechend dem Ansatz der multiplen Kulturen beschäftigt sich die interkulturelle Forschung zunehmend nicht nur mit Nationalkultur, sondern auch mit anderen Kulturen wie Branchen-, Organisations-, Abteilungs- und Berufskulturen. In Organisationen betreffen sie die auch aus dem Diversity Management (Özbilgin/Tatli 2008; Genkova/Ringeisen 2016) bekannte Kategorien wie Geschlecht, Alter, soziale Klassen, hierarchische Position (Mitarbeiter, Führungskraft), Abteilung/Bereiche (Forschung, Marketing), Profession (Ingenieur, Jurist) sowie Organisationskulturen (flexibel, verschlossen). Solche kulturellen Gruppierungen werden auch als Stratifizierung subkultureller Merkmale (Zander/Romani 2004) bezeichnet oder als kulturelles Mosaik (Chao/Moon 2005). Von den vielen kulturellen Gruppierungen werden folgend drei genannt, die das Interkulturelle Management besonders betreffen:
Organisationskultur ist seit den 1980er Jahren ein vielbeachtetes Thema der (Interkulturellen) Managementforschung und -praxis (Schein 1986). Auch Hofstede (1980) initiierte seine große Studie Culture’s Consequences unter anderem, um das Einfluss- und Spannungsverhältnis zwischen Nationalkultur und Organisationskultur zu untersuchen. Ausgehend von den USA ist das Konzept der Organisationskultur zu einem breiten Forschungsfeld mit zahlreichen Publikationen geworden. Organisationskultur, zu verstehen als ein Subsystem von Kultur, erfüllt wichtige Funktionen in Organisationen: Sie konstituiert die gemeinsame Identität der Organisationsmitglieder, gibt Orientierung und Entscheidungshilfen und prägt das Handeln der Mitarbeiter (Scholz 2000). Somit zeigt sie Koordinations-, Integrations- und sogar Motivationsfunktionen auf (Brown 1998). Im Sinne der konstruktiven Interkulturalität kann Organisationskultur als eine Ressource verstanden werden, die zur Erhöhung der Wertschöpfung der Organisation und der Zufriedenheit der Mitarbeiter beiträgt. Dies kann durch eine »starke« Organisationskultur begünstigt werden, in der eine hohe Kohärenz gemeinsamer Orientierungsmuster existiert, die Transaktionskosten verringert (Schreyögg 2003). Insofern ist Organisationskultur ein zentrales Element des Konstruktiven Interkulturellen Managements.
Bereichskultur ist eine bisher wenig erforschte (Sub-)Kultur. Sie betrifft kollektive Grundannahmen innerhalb eines Bereichs (Abteilung) einer Organisation, die sich in bereichsspezifischen Werten, Praktiken und Artefakten niederschlagen (Zander/Romani 2004; Sachseneder 2013). Diese Grundannahmen betreffen z. B. spezifische Ziele, Verhaltensweisen oder Sprachen von Funktionsbereichen wie Marketing, Forschung & Entwicklung, Vertrieb oder IT. Bereichskultur kann eine identitätsstiftende Wirkung für das Kollektiv bewirken, so auch durch Abgrenzung: »Wir im Marketing gegen die in der Entwicklung«. Die bereichskulturelle Identität speist sich primär aus diesen Aufgaben und Zielen eines Bereichs (Sachseneder 2013). In einem konstruktiven Verständnis von Interkulturalität können sie jedoch auch positive Auswirkungen aufweisen: Eigenheiten der Bereiche und ihre unterschiedlichen Sichtweisen erzeugen durch gegenseitige Reibung auch ein fruchtbares Spannungsverhältnis. Gelingt es Organisationen, konstruktiv mit Bereichskulturen umzugehen, so entstehen positive Impulse und bereichernde Diskussionen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Konstruktives Interkulturelles Management»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Konstruktives Interkulturelles Management» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Konstruktives Interkulturelles Management» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.