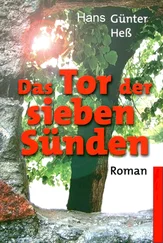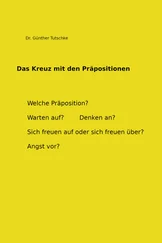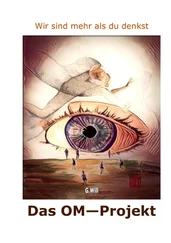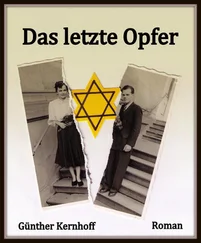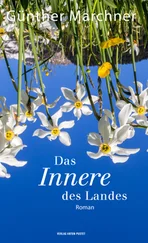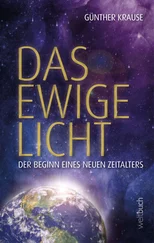Hinzu kamen Sammlungen – zunehmend gebunden –, die durch ihren Reihentitel „entweder an ein möglichst breites soziales Spektrum appellierten oder sich auf eine möglichst kleine Zielgruppe beschränkten“ wie die Familienbibliothek fürs deutsche Volk Familienbibliothek fürs deutsche Volk, Für Palast und Hütte Palast und Hütte, Für, Für den Feierabend Feierabend, Für den, Deutsche Volksbibliothek für Leseverereine und Haus Volksbibliothek für Leseverereine und Haus, Deutsche oder Deutsche Handwerker-Bibliothek Handwerker-Bibliothek, Deutsche (Wittmann 1982b: 131f.).
Auch die literarischen Verlage brachten gegen Ende des Jahrhunderts Reihen mit gemeinfreien Werken oder als Zweitverwertung von bereits veröffentlichten Werken heraus. CottaCotta startete bereits 1882 seine Bibliothek der Weltliteratur Bibliothek der Weltliteratur. S. FischerFischer folgte mit der Nordischen Bibliothek Bibliothek, Nordische (ab 1889), der Collection Fischer Collection Fischer (ab 1894) und mit Fischers Bibliothek zeitgenössischer Romane Fischers Bibliothek zeitgenössischer Romane (ab 1910). LangenLangen brachte seine Kleine Bibliothek ab 1897 auf den Markt, Langewiesche-BrandtLangewiesche-Brandt die Bücher der Rose Bücher der Rose ab 1909, UllsteinUllstein die Ullstein-Bücher Ullstein-Bücher ab 1910 und Anton Kippenberg die Insel-Bücherei Insel-Bücherei ab 1912 (Estermann/Füssel 2003: 275–280). Alle diese preisgünstigen Reihen erschienen als kleinformatige Hardcover.
Zu diesen mit wenigen Ausnahmen (etwa den Reisebibliotheken) belletristischen Collectionen erschienen nach der Jahrhundertmitte Reihen mit nonfiktionalen Inhalten verschiedenster Art. Nach dem frühen Vorläufer Unsere Zeit, oder geschichtliche Übersicht der merkwürdigsten Ereignisse von 1789–1830 Zeit, oder geschichtliche Übersicht der merkwürdigsten Ereignisse von 1789–1830, Unsere bei Emanuel SchweizerbartSchweizerbart (ab 1826) kamen Meyers Volksbibliothek für Länder- Völker- und Naturkunde Meyers Volksbibliothek für Länder- Völker- und Naturkunde aus dem Bibliographischen Institut (ab 1853) und die Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens bei Hermann SchönleinSchönlein (ab 1876) auf den Markt, später im Jahrhundert die Sammlung Göschen Sammlung GöschenGöschen in der Göschen’schen Verlagsbuchhandlung (ab 1889) und Aus Natur und Geisteswelt Natur und Geisteswelt, Aus im TeubnerTeubner Verlag (ab 1898).
Im nächsten Kapitel wird zu betrachten sein, welche dieser Reihen aufgrund ihrer Strukturmerkmale als Taschenbuchreihen einzuordnen sind.
Neben den Collectionen, Bibliotheken oder Sammlungen sind für das 19. Jahrhundert die Volksbücherals Reihe typisch. Wie bereits gesagt, sind nicht alle populären Lesestoffe des 19. Jahrhunderts in Reihen erschienen. Es geht hier nicht im weiteren Sinn um „‚Volksbücher‘, ‚Bibliothèque BleueBibliothèque Bleue‘, ‚Volksbüchlein‘, ‚Heftchen‘, ‚Broschüren‘ – wie immer mvan diese Gattung nennen mag“, die „im 19. Jahrhundert in großen Teilen Europas den bedeutendsten nichtperiodischen Lesestoff der gesamten lesenden Bevölkerung“ darstellen (Schenda 1970: 305). Zwar trug die im 18. Jahrhundert in Frankreich entstandene Bibliothèque bleue Bibliothèque bleue durch ihren blauen Umschlag Reihencharakter, doch diese Lesestoffe, die in England chapbook und in Italien libretto populare hießen, waren nicht nummeriert, erschienen nicht periodisch und hatte keine standardisierte Aufmachung.
 Unter diesen populären Lesestoffen, die man besser „Volksbüchlein“ als „Volksbücher“ nennen sollte (Schenda 1968: 137), hatte nach den Romanen – vor allem Ritter- und Liebesromane – das religiöse Schrifttum mit Andachtsbüchern, Liederbüchern, Gebetsbüchern und erbaulichem Schrifttum den größten Anteil (Andries/Bollème 2003: 23). Hinzu kamen Märchen, Fabeln und Sagen, Sammlungen von Witzen und Anekdoten, Traumdeutungsbücher, aber auch praktische Ratgeber für Gesundheit und Haushalt oder für den Landmann. Es handelte sich „um eine massenhaft hergestellte Art von Lesestoffen, um Heftchen von 8 bis 128 Seiten, etwa 14 mal 9 cm groß, um Massenlektüren auf billigstem Papier zu billigstem Verkaufspreis“ (Schenda 1968a: 140). Eine erste Einführung gibt Mandrou 1975; eine rund 1.000seitige Beispielsammlung von Texten der Bibliothèque bleueBibliothèque bleue findet sich bei Andries/Bollème 2003. Schenda 1968b verzeichnet bibliografisch 1.000 französische Volksbüchlein aus dem 19. Jahrhundert. Vergleichbares für den deutschen Sprachraum gibt es nicht. Zu den chapbooks siehe Weiss 1969 und Schöwerling 1980.
Unter diesen populären Lesestoffen, die man besser „Volksbüchlein“ als „Volksbücher“ nennen sollte (Schenda 1968: 137), hatte nach den Romanen – vor allem Ritter- und Liebesromane – das religiöse Schrifttum mit Andachtsbüchern, Liederbüchern, Gebetsbüchern und erbaulichem Schrifttum den größten Anteil (Andries/Bollème 2003: 23). Hinzu kamen Märchen, Fabeln und Sagen, Sammlungen von Witzen und Anekdoten, Traumdeutungsbücher, aber auch praktische Ratgeber für Gesundheit und Haushalt oder für den Landmann. Es handelte sich „um eine massenhaft hergestellte Art von Lesestoffen, um Heftchen von 8 bis 128 Seiten, etwa 14 mal 9 cm groß, um Massenlektüren auf billigstem Papier zu billigstem Verkaufspreis“ (Schenda 1968a: 140). Eine erste Einführung gibt Mandrou 1975; eine rund 1.000seitige Beispielsammlung von Texten der Bibliothèque bleueBibliothèque bleue findet sich bei Andries/Bollème 2003. Schenda 1968b verzeichnet bibliografisch 1.000 französische Volksbüchlein aus dem 19. Jahrhundert. Vergleichbares für den deutschen Sprachraum gibt es nicht. Zu den chapbooks siehe Weiss 1969 und Schöwerling 1980.
In unserem Kontext geht es um die Volksbücher im engeren Sinn, wie sie in Reihen im 19. Jahrhundert auf den Markt gebracht wurden. Ein Schlüsselwerk dabei ist die die Schrift Die teutschen Volksbücher von Joseph Görres aus dem Jahr 1807. Wie der Untertitel des Buchs zeigt, ging es Görres nicht nur um die Tradierung spätmittelalterlicher und frühneuzeitlicher Epen: Nähere Würdigung der schönen Historien- Wetter- und Arzneybüchlein, welche theils innerer Werth, theils Zufall, Jahrhunderte hindurch bis auf unsere Zeit erhalten hat . Die beiden bedeutendsten Reihen, die in dieser Tradition entstanden, wurden von dem Philologen Karl Simrock (1802–1876) und dem Autor, Philosophen und Bankier Gotthard Oswald Marbach (1810–1890) herausgegeben.
Karl Simrocks Reihe Die deutschen Volksbücher Volksbücher, Die deutschen erschien zwischen 1838 und 1850 im Verlag Heinrich Ludwig BrönnerBrönner in Frankfurt und umfasste 57 Titel. Neben den ‚klassischen‘ Stoffen wie Die schöne Magelone , Reineke Fuchs , Genoveva und Dr. Johannes Faust erschienen auch Sammlungen von Sprichwörtern, Rätseln, Volksliedern und Weissagungen, aber auch Büttner-Handwerksgewohnheiten und Der Huf- und Waffenschmiede-Gesellen Handwerksgewohnheit . Die broschierten Bände hatten einen Umfang zwischen 50 und über 600 Seiten, sie waren mit Holzschnitten illustriert und hatten ein Format von circa 11 cm x 18 cm.
Am bekanntesten ist wohl die Sammlung Volksbücher von Gotthard Oswald Marbach, die ebenfalls 1838 im Verlag Otto WigandWigand in Leipzig zu erscheinen begann. In der Zusammenstellung gleicht sie weitgehend der Simrockschen Reihe, doch sind das keine Ausgaben, die auch Philologen ansprechen wollten, sondern vor allem auf das Unterhaltungsbedürfnis des Publikums zielten (Rautenberg 1985: 223f.). Von den insgesamt 53 Bänden erschienen bis 1842 vierunddreißig unter der Herausgeberschaft Marbachs, danach bis 1848 weitere 19 Bände, zum Teil durch Oskar Ludwig Bernhard Wolff herausgegeben, einige auch ohne Nennung eines Herausgebers. Zum Erfolg der Reihe hat sicher beigetragen, dass 31 Titel mit Holzschnitten von Ludwig Richter illustriert waren. Die Bände erschienen in Heftform, also ohne festen Einband, und wurden auf billigstem Papier gedruckt. Die Umfänge schwankten zwischen 40 und 250 Seiten; das Format betrug 12,5 cm x 18 cm.
Für den ökonomischen Erfolg beider Reihen sprechen die Tatsachen, dass Simrocks Die deutschen Volksbücher Volksbücher, Die deutschen zwischen 1845 und 1867 in 13 Sammelbänden erneut herausgebracht wurden und dass Marbachs Volksbücher bis zur Jahrhundertwende immer wieder nachgedruckt wurden (Galle 2006b: 19).
 Der Begriff „Volksbücher“ erscheint auch – oft in Kombination mit geografischen Bezeichnungen – in vielen anderen Reihennamen wie Münchener Volksbücher Volksbücher, Münchener, Rheinische Volksbücher Volksbücher, Rheinische, Rosenheimer Volksbücher Volksbücher, Rosenheimer, Wiener Volksbücher Volksbücher, Wiener, Wiesbadener Volksbücher Volksbücher, Wiesbadener etc. Wie das Beispiel Meyers Volksbücher Meyers Volksbücher zeigt, handelt es sich jedoch nicht immer um Volksbücher in dem hier behandelten Sinn. Meyers Volksbücher versammeln vielmehr neben wenigen nichtfiktionalen Titeln vor allem in- und ausländische Klassiker sowie Autoren der Zeit. Mit „Volksbibliotheken“ wiederum wurden vor allem gegen Ende des Jahrhunderts Reihen für Jugendliche bezeichnet (Galle 2006b: 110–133).
Der Begriff „Volksbücher“ erscheint auch – oft in Kombination mit geografischen Bezeichnungen – in vielen anderen Reihennamen wie Münchener Volksbücher Volksbücher, Münchener, Rheinische Volksbücher Volksbücher, Rheinische, Rosenheimer Volksbücher Volksbücher, Rosenheimer, Wiener Volksbücher Volksbücher, Wiener, Wiesbadener Volksbücher Volksbücher, Wiesbadener etc. Wie das Beispiel Meyers Volksbücher Meyers Volksbücher zeigt, handelt es sich jedoch nicht immer um Volksbücher in dem hier behandelten Sinn. Meyers Volksbücher versammeln vielmehr neben wenigen nichtfiktionalen Titeln vor allem in- und ausländische Klassiker sowie Autoren der Zeit. Mit „Volksbibliotheken“ wiederum wurden vor allem gegen Ende des Jahrhunderts Reihen für Jugendliche bezeichnet (Galle 2006b: 110–133).
Читать дальше
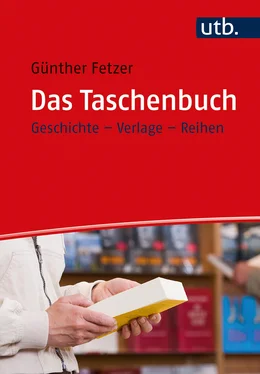
 Unter diesen populären Lesestoffen, die man besser „Volksbüchlein“ als „Volksbücher“ nennen sollte (Schenda 1968: 137), hatte nach den Romanen – vor allem Ritter- und Liebesromane – das religiöse Schrifttum mit Andachtsbüchern, Liederbüchern, Gebetsbüchern und erbaulichem Schrifttum den größten Anteil (Andries/Bollème 2003: 23). Hinzu kamen Märchen, Fabeln und Sagen, Sammlungen von Witzen und Anekdoten, Traumdeutungsbücher, aber auch praktische Ratgeber für Gesundheit und Haushalt oder für den Landmann. Es handelte sich „um eine massenhaft hergestellte Art von Lesestoffen, um Heftchen von 8 bis 128 Seiten, etwa 14 mal 9 cm groß, um Massenlektüren auf billigstem Papier zu billigstem Verkaufspreis“ (Schenda 1968a: 140). Eine erste Einführung gibt Mandrou 1975; eine rund 1.000seitige Beispielsammlung von Texten der Bibliothèque bleueBibliothèque bleue findet sich bei Andries/Bollème 2003. Schenda 1968b verzeichnet bibliografisch 1.000 französische Volksbüchlein aus dem 19. Jahrhundert. Vergleichbares für den deutschen Sprachraum gibt es nicht. Zu den chapbooks siehe Weiss 1969 und Schöwerling 1980.
Unter diesen populären Lesestoffen, die man besser „Volksbüchlein“ als „Volksbücher“ nennen sollte (Schenda 1968: 137), hatte nach den Romanen – vor allem Ritter- und Liebesromane – das religiöse Schrifttum mit Andachtsbüchern, Liederbüchern, Gebetsbüchern und erbaulichem Schrifttum den größten Anteil (Andries/Bollème 2003: 23). Hinzu kamen Märchen, Fabeln und Sagen, Sammlungen von Witzen und Anekdoten, Traumdeutungsbücher, aber auch praktische Ratgeber für Gesundheit und Haushalt oder für den Landmann. Es handelte sich „um eine massenhaft hergestellte Art von Lesestoffen, um Heftchen von 8 bis 128 Seiten, etwa 14 mal 9 cm groß, um Massenlektüren auf billigstem Papier zu billigstem Verkaufspreis“ (Schenda 1968a: 140). Eine erste Einführung gibt Mandrou 1975; eine rund 1.000seitige Beispielsammlung von Texten der Bibliothèque bleueBibliothèque bleue findet sich bei Andries/Bollème 2003. Schenda 1968b verzeichnet bibliografisch 1.000 französische Volksbüchlein aus dem 19. Jahrhundert. Vergleichbares für den deutschen Sprachraum gibt es nicht. Zu den chapbooks siehe Weiss 1969 und Schöwerling 1980.