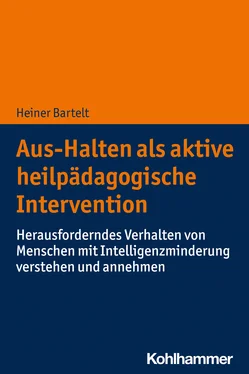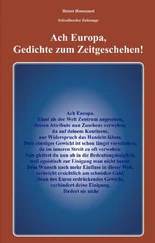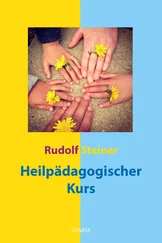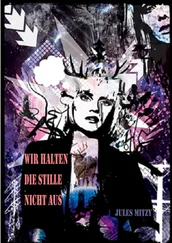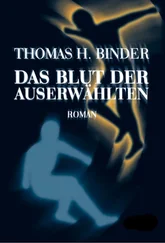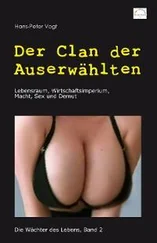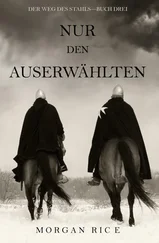Besonders überraschend ist es für mich, dass auch Forschung und Lehre sich (fast) überhaupt nicht mit der Teilhabesituation dieser Menschen befassen. Es hat den Anschein, als ob hier ein unausgesprochener Konsens besteht, die nicht stattfindende Einbeziehung dieser Menschen in die Inklusionsüberlegungen zu tabuisieren. Theoretisch fundierte Betreuungskonzepte, die wissenschaftliche Begleitung und Supervision von Praxisangeboten für diese Menschen stellen nach wie vor die große Ausnahme dar.
Deutlich wird dies bei der aktuellen Umsetzung von Betreuungsangeboten in unterschiedlichen Bundesländern. Menschen mit geringerem Hilfebedarf sind in den letzten Jahren ihrem Wunsch folgend in eigene Wohnungen oder Wohnangebote gezogen, die sozialräumlich Möglichkeiten der Partizipation bieten.
In die dadurch frei gewordenen ehemaligen Wohnheime sind nicht selten Betreuungsgruppen mit Menschen mit komplexen Behinderungen oder eben herausfordernden Verhaltensweisen nachgefolgt. Diese Angebote ebenso wie neu errichtete Wohnanlagen werden verstärkt mit einem ergänzenden Konzept zur Tagesstruktur ausgestattet, die den Besuch einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung nicht mehr nötig machen. In nicht wenigen dieser Angebote ist der Ausschluss eines Besuches einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung sogar Aufnahmevoraussetzung. (Eigentlich gibt es damit keinen Grund mehr, das Gebäude je zu verlassen…).
Das bedeutet konkret, dass wir im Bereich des Wohnens von Menschen mit Behinderung für die hier benannten Menschen Konzepte favorisieren, die unmittelbar aus den 1970er Jahren stammen.
Zu dieser Haltung passt dann auch die Zunahme der »Intensivgruppen« in Einrichtungen, ohne dass eine ausreichende individuelle und kritische Reflexion ihrer unabänderlichen »alternativlosen« Notwendigkeit stattfindet. Während der Aspekt der Teilhabe und Inklusion in der Öffentlichkeit stetig an Bedeutung gewinnt, steigt gleichzeitig in den letzten Jahren die Zahl der Spezial- und Intensivgruppen in Einrichtungen und dies bereits für Kinder und Jugendliche. Diese Wohnangebote stellen dabei nicht nur vorübergehend einen engen Betreuungsrahmen mit Vorgaben und Regeln sicher, sondern sind häufig langfristig angelegte Lebensräume, die oft mit mangelnder Teilhabe und geringen Anteilen an Selbstbestimmung einhergehen, sprich mit Exklusion.
Das bedeutet weiterhin, dass Werkstätten für Menschen mit Behinderung, die sich der Kritik ausgesetzt sehen, zu wenig teilhabeorientiert zu sein und perspektivisch durch den »ersten Arbeitsmarkt« abgelöst werden sollen, oft hinsichtlich der Beschäftigung von Menschen mit diesem besonderen Betreuungsbedarf an die Grenzen ihrer Möglichkeiten kommen.
Das bedeutet ebenso, dass wir in einer Zeit, in der der Besuch einer Regelschule für Kinder mit Behinderung der Normalfall werden soll, weiterhin Schüler*innen haben, die nicht einmal eine Förderschule in Begleitung einer Assistenzkraft (ganztags) besuchen können.
Als Folge dieser Entwicklung verschärft die derzeitig stattfindende Inklusionspraxis die Segregation und Exklusion einer Gruppe von Menschen, deren Ausgrenzung wissentlich oder – und das ist nicht weniger problematisch – unwissentlich in Kauf genommen wird. Wir laufen damit Gefahr zuzulassen, dass im »Schatten der Inklusion« eine eigene Parallelwelt von Einrichtungen und Angeboten für diese Menschen entsteht, für die die Erklärung der Rechte der UNO-Behindertenrechtskonvention scheinbar nicht gilt, ja, die vielmehr Gefahr laufen, zu »Resteinrichtungen« für die »Nicht-Inklusionsfähigen« zu werden.
Diese Entwicklung hat unmittelbare Auswirkungen auf die fachliche Begleitung dieser Menschen und damit eine große Relevanz für das Thema dieses Buches: Die Art und Weise meines Engagements für Menschen mit Unterstützungsbedarf wird wesentlich von meiner beruflichen Identität geprägt (vgl. Rene Hofer 2007, S. 25 ff). Je mehr ich durch mein Handeln in der Praxis eine Bestätigung meiner fachlichen Überzeugungen und Fertigkeiten erfahre, um so förderlicher wird sich dies auf meine berufliche Identität auswirken. Diese Identität findet ihren Ausdruck in der Haltung, die meinem Handeln zugrunde liegt.
In der (Heil-)Pädagogik, analog zu den benachbarten Disziplinen der Psychologie, Psychiatrie und weiterer therapeutische Disziplinen – und oft verstärkt durch diese –, scheint das »Heilen«, im Sinne einer Minderung bis hin zur Befreiung von einem belastenden Zustand, eine von Beginn des Studiums an dominierende Rolle für die Entwicklung der beruflichen »Identität« zu spielen. Das Erreichen von »Entwicklungsfortschritten« scheint das wesentliche Ziel allen beruflichen Handelns zu sein.
Entsprechend prüft ein Teil der begleitenden Disziplinen eine »Therapiefähigkeit« und schließt Menschen mit starker Intelligenzminderung und herausfordernden Verhaltensweisen von ihren Angeboten aus. Trotz steigender Zahlen von betroffenen Menschen mit sogenannter »Doppeldiagnose« werden die Gründe für eine Krise und die damit verbundene Aufnahme in eine psychiatrische Klinik oft als »pädagogisches Problem« definiert, und entsprechend beschränkt sich das Angebot auf eine reine Krisenintervention mit entsprechend kurzer Interventions- und Aufenthaltszeit.
Dieses Erleben – sowohl der scheinbaren eigenen (heil-)pädagogischen Wirkungslosigkeit als auch der vermeintlich mangelnden Unterstützung durch andere Hilfesysteme – führt bei vielen gut ausgebildeten (Heil-)Pädagog*innen zu einem Gefühl der Ohnmacht und Frustration bei der Begleitung dieser Menschen.
In der Folge bedeutet dies, dass Empathie und Wertschätzung für mein Gegenüber im Alltag schwinden, oder es führt zum Beenden meiner beruflichen Arbeit in diesem Bereich und den Wechsel in ein (scheinbar) »wirkmächtigeres« Arbeitsfeld, etwa die Frühförderung, eine Autismus-Ambulanz oder das ambulant betreute Wohnen.
Und damit verfestigt sich der Teufelskreis: Hohe Fluktuation, Resignation oder Frustration der Begleitenden und die daraus folgende erneute Bestätigung der Erfahrung der betroffenen Menschen »Mit mir hält es niemand aus« führen unweigerlich zu einer weiteren Verfestigung bestimmter Verhaltensmuster als Ergebnis dieser sich wiederholenden Lebenserfahrung.
Wenn diese Kurzanalyse zutrifft, bleiben nur zwei berufliche Handlungsoptionen, die unsere Haltung wesentlich bestimmen. Horst-Eberhard Richter (1976) hat dies vor vielen Jahren die Alternative zwischen »Flüchten« oder »Standhalten« genannt.
Eine Flucht kann, auf unser (heil-)pädagogisches Tun übertragen, nach außen oder innen erfolgen. Als äußere Kündigung bedeutet sie einen Arbeitsplatzwechsel, hin zu einem Bereich, in dem ich glaube, meine Kompetenzen, Vorstellungen und Wünsche eher einbringen zu können. Die innere Kündigung stellt hingegen ein Verweilen am jetzigen Ort dar, ist jedoch gekennzeichnet von einer Krise der eigenen beruflichen Identität, hervorgerufen durch das Gefühl der Wirkungslosigkeit, letztlich gar Beliebigkeit meines fachlichen Handelns, und den mangelnden Glauben an meine erlernte Kompetenz. An ihre Stelle tritt dann Erfahrungspädagogik und manchmal auch eine Gleichgültigkeit, die als Gelassenheit ausgegeben wird (»Soll sie doch machen, was sie will. Ich rege mich darüber nicht mehr auf.«). An diesem Punkt entsteht dann Raum für eine »dämonischen Sichtweise« (Haim Omer 2007) als Erklärungsmuster.
Oder ich entscheide mich – in der Praxis eher das Ergebnis eines längeren Prozesses als eine rationale Entscheidung – dafür, standzuhalten. Ich schaffe mir strukturelle und persönliche Bedingungen, die es mir erlauben, eine fachliche Haltung zu entwickeln, es mit dem anderen Menschen auszuhalten und dies als aktiven Prozess zu gestalten. Das ist eine anstrengende Option, die aber nicht nur Kraft kostet, sondern auch sehr viel Energie freisetzen kann – bei beiden Beteiligten. Das Einnehmen einer »tragischen Sichtweise« (ebd.) kann dabei eine wichtige Stütze sein.
Читать дальше