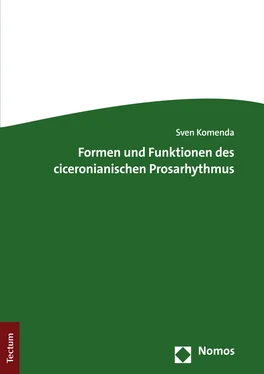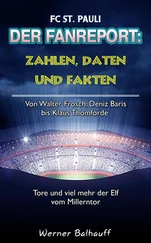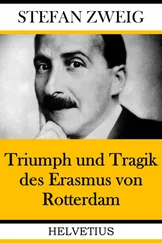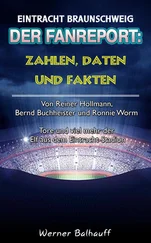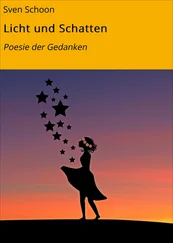Ferner werden wir auch auf Gemeinsamkeiten (vorrangig in unmittelbar aufeinander folgenden Kola) hinweisen, welche über die eigentlichen Klauseln hinausgehen, und nicht beim frühestmöglichen Punkt mit der Messung aufhören. Also beispielsweise, um Übereinstimmungen wie das aus Perspektive unseres Notationssystems schlicht übergroße Akzentmuster „12–10–8–4–2“84 oder Vergleichbares dokumentieren zu können.
Ferner setzen wir fest, dass im Falle eines letzten Wortakzentes auf der Pänultima und Antepänultima beide möglichen Messungen immer gegeneinander abgewogen werden müssen. Deswegen, weil im Falle einer Wendung wie des fiktiven „míser dúx fúgit“ zwar eine Ab- und Eingrenzung der infrage kommenden Klauseln möglich ist, da aber andererseits a priori schlicht keine Anhaltspunkte vorliegen, welche Messung (Pγδ oder Mγδ) die richtige ist.
2.4 Die Kolometrie lateinischer und griechischer Texte
Um einen Zugang zum Prosarhythmus zu finden, müssen wir ganz abgesehen von den eben besprochenen Fragestellungen im Zusammenhang mit der Notation klären, an welchen Stellen im Text eine Messung der Klauseln überhaupt stattzufinden hat. Es handelt sich, wie bereits erwähnt wurde, um die Ausgänge sogenannter „Kola“. Was verstehen wir also unter diesem Begriff?
Wir werden uns bei der Klärung dieser Frage vorrangig um die moderne Kolontheorie bemühen, während sowohl des Aristoteles als auch Ciceros Aussagen nicht ausschließlich, aber vor allem mit Hinsicht auf Konzinnität und die „παρομοίωσις“ herangezogen werden sollen. Damit möchten wir einer zu weit gehenden Verästelung der Materie vorbeugen, da die antike Kolometrie zu stark abweichenden Ergebnissen in einem zeitlich bis in die Spätantike ausgedehnten Diskurs geführt hat.85 Eine Begrenzung ist also notwendig. Zuerst sprechen wir über die modernen kolometrischen Ansätze, und nach einer ersten Voruntersuchung werden wir wie gesagt zumindest auf Aristoteles und Cicero zurückkommen, vor allem um darstellen zu können, wie verschiedene auch für moderne Rezipienten weitgehend gut erkennbare Gleichklangsphänomene von diesen beiden Autoren auf Ebene der Kolometrie behandelt worden sind und für unsere Analyse nutzbar gemacht werden können.
Objektive, zunächst primär syntaktische Kriterien wurden erst durch die moderne Kolometrie zugänglich. Eduard FRAENKEL hat diese allen voran, so wird man wohl sagen können, mit einem ersten Aufsatz 1932 überhaupt erst ins Leben gerufen. FRAENKEL gewann seine ersten Erkenntnisse allerdings durch die Untersuchung lateinischer elegischer Distichen.86 Seine Frage war, wie im Falle eines über den Pentameter hinausreichenden Enjambements die formale Geschlossenheit des Distichons gewahrt bleibe, wenn nach der üblichen Regel doch ein Distichonende mit einem Satzende einhergehen müsse.87 Neben der Tatsache, dass gerade bei Catull Fälle vorliegen, in denen die besagte Regel ganz einfach ohne Kompensation nicht beachtet wurde, ist seine Antwort auf diese Frage, dass in solchen Fällen ein Segment, das er selbst als „Kolon“ bezeichnet, das Distichon abschließe. FRAENKEL meint damit eine syntaktisch (und inhaltlich) geschlossene Wortgruppe, deren Grenze klar mit dem Pentameterschluss zusammenfalle. Die Fragestellung war also, welche Konstruktionen die notwendige Geschlossenheit und das notwendige semantische Gewicht an den Tag legen, sodass die bekannte Regel nicht im eigentlichen Sinne verletzt wird.
Anhand zweier Beispiele wird der Unterschied zwischen einem Enjambement dieses Typs und dem von FRAENKEL so bezeichneten „echten Enjambement“ deutlich. Zuerst Catull 68, 70f.: Quo mea se molli candida diva pede // intulit.88 Zwischen diesen beiden Versen ist keine plausible Grenze auszumachen, weder formal noch inhaltlich. Diese Form ist nach FRAENKEL für Catull noch üblich, wohingegen sie von späteren Dichtern gemieden worden sei. Ein Beispiel für ein Enjambement, welches mithilfe eines „Kolons“ realisiert wurde, hat allerdings auch Catull zu bieten. So etwa 113, 2: Consule Pompeio primum duo, Cinna, solebant / Maciliam; facto consule nunc iterum // manserunt duo, […].89 Der Unterschied, der durch einen Schluss auf einen syntaktisch geschlossenen, autonomen Sinnabschnitt bewirkt wird, ist mit Händen zu greifen. Auf diese Form eines provisorischen Abschlusses haben die lateinischen Elegiker nach FRAENKEL regelmäßig hingearbeitet. Andere Satzglieder, die von FRAENKEL in der Rolle von Kola beobachtet wurden, sind Infinitivkonstruktionen, Participia coniuncta, Ablativi absoluti, (attributiv erweiterte) Subjekte, Objekte und adverbial erweiterte Attribute, sowie Adverbiale und korrespondierende Satzglieder (etwa in Aufzählungen)90 und eben auch (Teil-)sätze. In einem zweiten Aufsatz gelang es FRAENKEL anhand des Wackernagel’schen Gesetzes Kola auch im Griechischen zu bestimmen. Vokative, Partikeln und enklitische Personalpronomina wurden von ihm als formale Kriterien herangezogen.91
Einen weiteren Aspekt hat PEARCE 1966 ins Licht gebracht, indem er u. a. der Frage nachging, wie sich Hyperbata unter Anwendung einer kolometrischen Analyse beschreiben ließen. Er entdeckte anhand von Stichproben aus der lateinischen Dichtung und Cicero die deutliche Tendenz eines Hyperbatons, sich um die von FRAENKEL beschriebenen Kolontypen herum zu gruppieren. Z. B. bei Cat. 64, 207 ipse autem caeca mentem caligine Theseus […].92 Diese Ergebnisse sind später für das Griechische bestätigt worden. Hyperbata umschließen entweder ein Kolon oder stehen häufig am Anfang des ersten und am Ende des folgenden Kolons.93
FRAENKEL habe insgesamt, so schließt ferner HABINEK im Zuge seiner Verarbeitung des FRAENKELSCHEN Materials, im Verlauf seiner Untersuchungen größtenteils eine bestimmte (syntaktische) Kategorie differenziert, nämlich Konstituenten. HABINEKS Ergänzungen des Systems liegen (neben der besagten Präzisierung) zum einen in der Kolondifferenzierung (etwa die kolometrische Zusammengehörigkeit der Wendung „is, qui…“),94 zum anderen konnte er anhand einer Untersuchung antiker Interpunktionsformen, etwa die optionale Assoziation des Prädikats zu einem jeweils angrenzenden Kolon nachweisen.95
Diese weitgehende theoretische Übereinstimmung von Kola und Intonationseinheiten ist zum ersten Mal von Frank SCHEPPERS thematisiert worden.96 Die von Eduard FRAENKEL erarbeitete Kolontypologie wurde auch von ihm einer Revision unterzogen, welche sich ebenso an dem Begriff der Konstituente orientiert.
SCHEPPERS hat hierbei jüngst auf Grundlage aller lysianischen Reden und der platonischen Dialoge Kratylos, Sophistes, Theaitet und Politikos97 die bisherigen Erkenntnisse zur Kolometrie griechischer Texte ausgeweitet. Er hat eine Neudefinition der Kola durchgeführt, mit dem erklärten Ziel, gewisse Inkonsequenzen der bisherigen Definitionen zu beseitigen98 und es ist ihm gelungen, die heterogene Typologie der Kola, die zuvor syntaktische, semantische und allgemein kontextbedingte Kriterien der Segmentierung umfasste, stark zu vereinfachen und zu begrenzen. Er unterscheidet vorläufig99 zwischen Teilsätzen und teilsatzwertigen Konstruktionen, zwischen adversativen, parallelen oder andersartig syntaktisch korrespondierenden Kola, „nicht integrierten“ Segmenten (Appositionen und Parenthesen) und solchen Elementen, die „fronted“, also in Spitzenstellung an den Satzanfang gesetzt sind. Als nur ein Beispiel sei das folgende genannt: Lys. 3, 15 μετὰ δὲ ταῦτα | τὸ μὲν μειράκιον εἰς γναφεῖον κατέφυγεν (Der Fettdruck wurde von uns hinzugefügt). Hier offenbart die Partikel μέν den Kolonwechsel.100
Auch seine Kolometrie bleibt nicht ohne ein subjektives Moment (und wird selbstverständlich von unserem Referat auch nicht annähernd vollständig wiedergegeben), doch die Segmentierung anhand formaler Kriterien hat SCHEPPERS durch seine umfangreiche Grundlagenarbeit entscheidend vorangebracht. Durch eine detaillierte Stellungsanalyse der griechischen Partikeln, Personal- und Demonstrativpronomina, der einfachen und komplexen Negationen, der Sub- und Konjunktionen, sowie Adverbien und verschiedener Adjektive auf Teilsatzbasis konnte er die Regeln ihrer Stellung identifizieren.101 Auf Teilsatzbasis (Teilsätze sind, wie erwähnt, ebenfalls eine Kolonkategorie) wurde gearbeitet, um sich an die Interpunktion der kritischen Editionen halten und selbst konstruierte Zirkelschlüsse bei der Abgrenzung der etwaigen Kola umgehen zu können.102 Die besagten Regeln gelten aber ebenfalls bei anderen Kolontypen103 und können im Zweifelsfall Anhaltspunkte für eine Trennung oder Zusammenfassung von Segmenten im Griechischen geben. An seiner insgesamt überzeugenden überarbeiteten Typologie werden wir uns auch im Lateinischen orientieren.104
Читать дальше