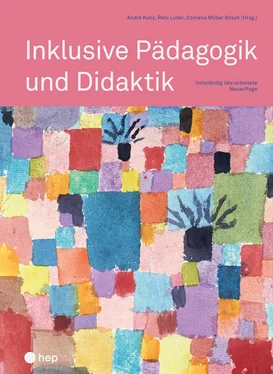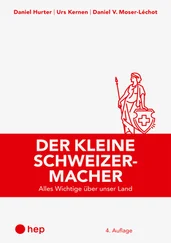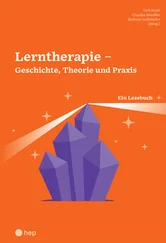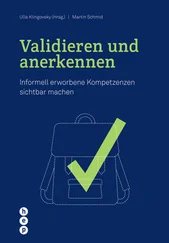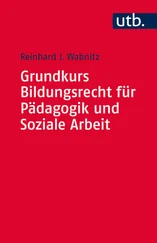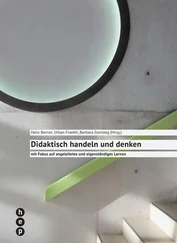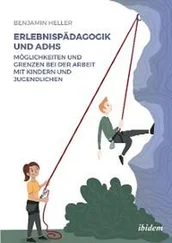Realität schulischer Anforderungsstrukturen
Die Frage, wo genau denn nun Funktionsfähigkeit endet und Behinderung beginnt, lässt sich mithin nur vor dem Hintergrund je gegebener Umwelten beantworten. Deren implizite und explizite Anforderungsstrukturen, so der Soziologe Kastl (2010, S. 126), «müssen und können […] auf ihre soziale Bedeutung und Änderbarkeit hin befragt werden», sind jedoch «so real wie Kaffeemaschinen» (ebd.). Wer sich vergewissern möchte, wie real allein die expliziten Anforderungsstrukturen von Bildungssystemen sind, wird in der baulichen Struktur und der Infrastruktur von Schulgebäuden ebenso fündig wie in Lehrplänen, Lehrmitteln, Testverfahren, in Beschreibungen von Performanz- oder Kompetenzstandards für fachliche und überfachliche Fähigkeiten, in Beobachtungsinstrumenten zuhanden von Lehrpersonen oder in Schul- und Klassenregeln.
So wird zum Beispiel eine psychodiagnostische Kategorie wie «Lese-/Rechtschreibstörung» nur im Kontext eines Schulsystems relevant, das spezifische Anforderungen an die Fähigkeit des Lesens und Schreibens richtet und Ressourcen für deren Diagnose und Förderung zur Verfügung stellt. Diese Anforderungen sind in Lehrplänen recht genau festgeschrieben, werden regelmäßig erfasst und bewertet und können auch mittels Tests diagnostisch überprüft werden. Weicht die Performanz einer Schülerin in einem definierten Ausmaß von diesen Anforderungen ab, können Angehörige einer hierzu ermächtigten Profession (Schulpsychologie, Logopädie, Medizin oder Heil-/Sonderpädagogik) möglicherweise eine Lese-/Rechtschreibstörung diagnostizieren, einen entsprechenden besonderen Förderbedarf feststellen und damit bewirken, dass die Schülerin oder der Schüler von Fachpersonen gefördert wird. Verlässt die Schülerin aber das Schulzimmer und spielt mit Freunden im Wald, dann ist sie dabei in keiner Weise eingeschränkt oder behindert. Und wenn ihre schulische Performanz nicht mehr von Mindestanforderungen abweicht, dann endet grundsätzlich auch ihre besondere pädagogische Förderung in einem (hypothetischen) «Förderschwerpunkt Lesen und Schreiben».
Kategoriale Organisation von schulischen Behinderungsstatus
Das Beispiel zeigt noch ein weiteres Charakteristikum schulischer Behinderungsstatus auf: Sie sind fast immer kategorial organisiert. Selbst wenn Lehrpersonen Behinderung und Performanz als etwas Situiertes und Kontinuierliches verstehen, so erfordert die administrative Logik für die Feststellung besonderer Bedarfe doch in der Regel eine Transformation in eine Ja-nein-Entscheidung. Eine Schülerin «hat» nach einer vorgegebenen Bedarfsfeststellungsprozedur einen formellen Förderstatus oder Nachteilsausgleich – oder sie «hat» ihn eben nicht. Ist ihre Performanz im Lesen und Schreiben zwar deutlich beeinträchtigt, weicht aber gerade nicht so weit von Mindeststandards ab, wie dies für die Erlangung eines schulischen Behinderungsstatus erforderlich ist, dann bleibt es bei der «normalen» Förderung, es wird kein Nachteilsausgleich gewährt und so weiter.
Probleme von kategorialen Status
Kategoriale Behinderungsstatus sind Grundlage für die Sicherung individueller Anspruchsberechtigungen auf Unterstützung, Förderung oder Nachteilsausgleich und die damit verbundene Zuweisung von Ressourcen. Sie haben aber auch zahlreiche problematische Nebenwirkungen: Sie können zu einer Stigmatisierung gewisser Kinder und Jugendlicher führen, Erwartungen an deren Performanz absenken, eine Exklusionsdrift in Richtung segregierter Förderorte bewirken oder, wie das vorangehende Beispiel zeigt, auch dazu führen, dass durchaus sinnvolle und notwendige Förderungsmaßnahmen nicht gewährt werden.
Status auch innerhalb des Systems nicht permanent
Doch auch für kategorial verfasste schulische Behinderungsstatus trifft zu, was Barnartt (2010) als «Fluidität von Behinderung» kennzeichnet. Selbst wenn man in Rechnung stellt, Behinderung sei ein zwar relationaler, aber letztlich an Personen innerhalb ihrer jeweiligen Umwelt gebundener Status – die Rede von «Menschen mit Behinderung» legt dies ebenso nahe wie fast alle schulisch-administrativen Behinderungskategorien –, so wäre es doch irreführend, solche Status als grundsätzlich permanente zu verstehen, erst recht innerhalb einer Umwelt, wie sie die Schulsysteme darstellen. Es gehört zum Kernprogramm der Schule, menschliche Fähigkeiten und Performanz als fluid und veränderbar zu betrachten und so umfassend wie möglich zu fördern, wenn nötig auch durch kompensatorische Maßnahmen, Hilfsmittel oder die Variation von Anforderungen. → Siehe Beitrag von Luder und Kunz. Verbessert sich die schulspezifische «Performanz» (ICF) von Schülerinnen und Schülern, weil barrieren- oder individuell-funktionsbezogene Interventionen, auch und gerade jene, die durch kategoriale Bedarfsstatus ausgelöst werden, genau das bewirken, was sie ihrem Anspruch nach bewirken sollen, dann kann die Grundlage für die Zuschreibung schulischer Behinderungsstatus entfallen. Treten Jugendliche mit dem Ende des Pflichtschulalters aus dem Schulsystem aus, dann enden schulspezifische Behinderungsstatus ohnehin.
Schulische Behinderung kann nach wie vor Exklusion legitimieren
Auf schulische Anforderungsstrukturen und deren hohes Maß an öffentlicher und politischer Legitimität ist ein Phänomen zurückzuführen, das gleichsam auf die Schattenseite der Institution der schulischen Behinderung verweist: anhaltende Exklusion. Denn nicht nur Anforderungsstrukturen, Ziele und Förderstrategien von Pflichtschulsystemen sind im Kern performanz- und fähigkeitsbasiert, sondern auch die formalen In- und Exklusionsregeln ihrer Organisationen.
UN-BRK: «Gleichberechtigt mit anderen»
Behinderung ist in allen gängigen, rechtlich relevanten Listen von Diskriminierungsmerkmalen aufgeführt, mittels deren Diskriminierung in Bildungssystemen reduziert werden soll. So hat die Schweiz 2014 das Übereinkommen der UNO über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (kurz: UN-BRK) ratifiziert, einen verbindlichen Völkerrechtspakt, dessen Vertragsstaaten mit der Ratifizierung konkrete Verpflichtungen eingegangen sind (ausführlich: Bielefeldt, 2011; Degener, 2009; Kälin et al., 2008). Zu diesen Verpflichtungen gehören die in Pädagogik und Bildungspolitik intensiv diskutierten Verpflichtungen in Artikel 24, ein «inclusive education system at all levels» ebenso sicherzustellen wie den Zugang aller Schülerinnen und Schüler mit Behinderung zu «inclusive, quality and free primary education and secondary education on an equal basis with others in the communities in which they live» – gleichberechtigt mit anderen, in der Gemeinde, in der sie leben.
Für Schulsysteme, die auf das Vorliegen eines schulischen Behinderungsstatus über Jahrzehnte fast automatisch mit Exklusion in Sonderschulen und Sonderklassen reagiert hatten, brachte die UN-BRK einen deutlichen Veränderungsdruck. Sonderschulen, erwartete die Juristin Degener im Jahr 2009, würden «durch die BRK zwar nicht kategorisch verboten, die systematische Aussonderung behinderter Personen aus dem allgemeinen Bildungssystem stellt allerdings eine Vertragsverletzung dar» (Degener, 2009, S. 216 f.).
Sonderstellung der Differenzdimension «schulische Behinderung »
Doch kommt trotz der UN-BRK auch in Staaten wie der Schweiz, Deutschland, Liechtenstein und Österreich Kategorien schulischer Behinderung nach wie vor eine einzigartige Stellung zu. Obgleich eine nahezu automatische Exklusion allein wegen des Vorliegens eines schulischen Behinderungsstatus der Vergangenheit angehört, kann Kindern und Jugendlichen nach wie vor ausschließlich unter Rückgriff auf a) spezifische diagnostizierte Performanzdefizite oder b) spezifische Bedürfnisse und Bedarfe, von denen angenommen wird, dass ihnen nur an besonderen Förderorten entsprochen werden kann, der Zugang zu öffentlichen Regelschulen und Regelklassen verwehrt werden. Dies auch dann, wenn an Förderorten Kinder mit externalisierend-aggressivem Verhalten zusammengeführt werden; möglicherweise wird dann eine ungünstigere Entwicklung der Fähigkeiten und Lebenschancen des betroffenen Kindes oder Jugendlichen in Kauf genommen.
Читать дальше