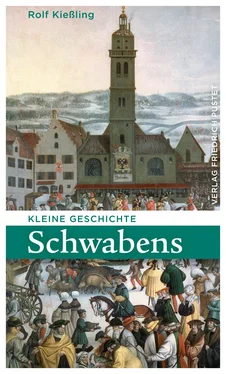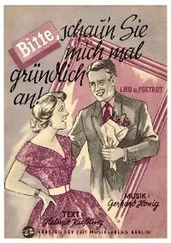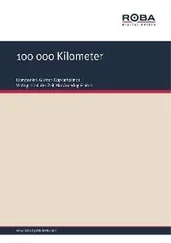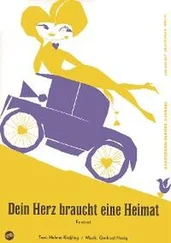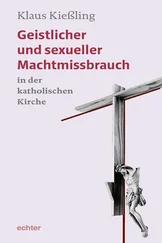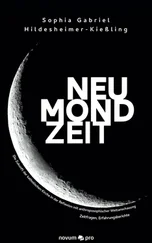Die Weiterentwicklung blieb freilich stecken: Welf VI., dessen Sohn 1167 auf einem Italienzug Barbarossas wie so viele andere Adelige an einer Seuche gestorben war, sah sich erbenlos. Sein Leben hatte einen Bruch bekommen, von dem er sich nicht mehr erholte: Er schickte seine Ehefrau Uta nach Calw zurück und führte ein Leben in „maßloser Trauer und grenzenloser Vergnügungssucht“.
„Anderen Lüsten zu frönen …“
„Der ältere Welf konnte nach dem Tode seines Sohnes keinesfalls mehr darauf rechnen, von seiner Gattin noch einen Erben zu bekommen, zumal seine Liebe zu ihr gering war und er den Verkehr mit anderen Frauen vorzog. So hatte er nur noch das eine Streben, ein glänzendes Leben zu führen, dem Waidwerk zu obliegen, Tafelfreuden und anderen Lüsten zu frönen und durch Festlichkeiten und wahllose Vergabungen sich den Ruf der Freigebigkeit zu erwerben.“ (Historia Welforum, Fortsetzung)
Am Lebensende erblindet, holte er seine Frau zurück und starb 1191. Seinen Besitz erhielt aber nicht sein welfischer Neffe Heinrich der Löwe, sondern er war schon 1178/79 an seinen anderen Neffen Friedrich Barbarossa gegangen, den Sohn seiner Schwester Judith, und damit an die Staufer als rechtmäßige Erben, vorbehaltlich einer lebenslangen Nutzung.
Die Folgen für Schwaben waren immens: Zusammen mit dem eigenen Besitz und dem Reichsgut gelang den Staufern damit eine herrschaftliche Durchdringung, die Schwaben eindeutig zu ihrer Region machte. Die Instrumente waren dieselben wie bei den Welfen, aber die Dimensionen waren ungleich ausgreifender. Die welfischen Burgen und präurbanen Siedlungen wurden eingebaut in eine zunehmend flächige staufische Besitzlandschaft. Sie wurde unter den späten Stauferkönigen Friedrich II. und Konrad IV. weiter verdichtet. Die Zahl der Ministerialen erhöhte sich sprunghaft; ein ganzes Spektrum von derartigen Funktionsträgern, teilweise aus der Unfreiheit, teilweise aus dem niederen Adel stammend, zählte zur staufischen Dienstmannschaft – und sie erhielt nun die Chance zum gesellschaftlichen Aufstieg im Reich. Zu den Spitzen dieser Reichsministerialität gehörten etwa die Reichsmarschälle von Kallentin-Pappenheim, die neben ihrem Stammsitz an der Altmühl auch zeitweise im Donaumoos um Neuburg, dann in Biberbach, Druisheim und Rechbergreuthen zwischen Augsburg und Donauwörth saßen. Volkmar II. der Weise von Kemnat war als Kämmerer des Herzogtums Schwaben im Gebiet der Reichsstraße um Buchloe begütert. Im westlichen Oberschwaben bauten die Reichstruchsessen von Waldburg samt ihren Zweigen der Herren von Tanne und der Schenken von Winterstetten ihre eigene weit verzweigte Herrschaftsbasis auf. Eng verbunden waren auch die Vasallen, die ihrerseits durchaus eigenständige Adelsherrschaften besaßen, aber Reichsdienste z. B. bei den Italienzügen leisteten: die Markgrafen von Ursin-Ronsberg, von Berg-Burgau. Ganz neue Impulse nutzten die Staufer aber mit der Städtepolitik, die vom Allgäu bis ins Ries eine wirtschaftliche Dynamik entfaltete.
Gelingen konnte diese flächige Ausbreitung auch deshalb, weil die Staufer das Herzogtum Schwaben in ihre Reichspolitik integrierten und Schwaben zu einer zentralen Region ihrer weit ausgreifenden ‚Reichslandpolitik‘ machten: Nach der Übernahme der Königswürde, wurde das Herzogtum zunächst in der Familie weitergegeben, dann aber seit Kaiser Heinrich VI. (1190–1197) als Bestandteil der Königsherrschaft behandelt. Die Kehrseite der Medaille ergab sich zwangsläufig, als die staufische Linie ins Trudeln geriet.
Konradin – Land ohne Herzog
König Konrad IV. (1250–1254) starb schon mit 26 Jahren, seine Nachfolge war strittig – es begann die Zeit des ‚Interregnums‘, in dem die Königswürde zwischen den Interessengruppen zerrieben wurde. Sein Sohn und Nachfolger, der junge Konradin, hatte bereits den Rückhalt in Schwaben verloren. Er war auf wittelsbachischen Burgen aufgewachsen, weil seine Mutter Elisabeth, eine Schwester Herzog Ludwigs des Strengen, als Witwe in ihre Heimat zurückgekehrt war. Nach ihrer Wiederverheiratung mit Graf Meinrad von Tirol übernahm der Onkel die Erziehung – und es war Ludwig sehr daran gelegen, das schwäbische Herzogtum an sich zu ziehen. Zehnjährig war Konradin 1262 zwar zum Herzog von Schwaben erhoben worden, doch es gelang ihm nicht mehr, die Lage zu stabilisieren. Das sizilianische Abenteuer, das dortige Erbe der Staufer gegen Karl von Anjou zu behaupten, kostete ihn 1268 in Neapel auf dem Schafott das Leben – die staufische Dynastie starb mit ihm aus.
Vor der Abreise hatte Konradin seinen Onkel Ludwig als Erben eingesetzt – und nun erhielt dieser zumindest einen beachtlichen Teil am Lechrain und an der Donau zwischen Lauingen und Neuburg, als ‚konradinischer Erbe‘. Andere Inhaber von Herrschaften versuchten ihre Selbständigkeit unter dem unmittelbaren Schutz des Reiches zu behaupten, und daraus entwickelten sich die zahlreichen Einzelherrschaften in Ostschwaben, die bis zum Ende um 1800 dem Reich zugeordnet blieben, weil alle Versuche, das schwäbische Herzogtum wieder zu erwecken, an den Widerständen der jeweiligen Gegenpartei scheiterten.
Hatte Ostschwaben in der frühen Karolingerzeit und in der Zeit des römisch-deutschen Kaiserreiches seit den Ottonen eher ein Randdasein geführt, war es selbst in Zeiten des frühen Herzogtums zwischen den Zentrallandschaften des schwäbischen und bayerischen Dukats zu liegen gekommen, so war es seit den Staufern zu einen Schwerpunkt des Königtums in Süddeutschland geworden. Nun aber bestimmte die herrschaftliche Vielgestaltigkeit Schwabens für weitere Jahrhunderte seine Geschichte.
Mit dem Aufstieg der Ministerialität gewann die Welt des Adels in dieser Zeit eine neue Dynamik; dieses Verwaltungsinstrument der Könige, Herzöge und großen Dynasten, an der Spitze die Welfen und Staufer, wurde nicht zuletzt zum Träger der höfischen Kultur – am Welfenhof in Peiting, aber auch auf der Burg eines Reichsministerialen wie Volkmar dem Weisen auf Kemnat. Schwaben hatte Anteil an der höfischen Literatur dieser Zeit. Freilich sind es nicht die großen genialen Dichterfiguren, die wir in Schwaben finden, aber doch markante Vertreter wie die Minnesänger Meinrad von Sevelingen (Söflingen bei Ulm), Hiltbold von Schwangau und Ulrich von Winterstetten (bei Waldsee) oder Ulrich von Thürheim (bei Wertingen), dem Fortsetzer der großen Epen von Gottfried von Straßburg und Wolfram von Eschenbach.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.