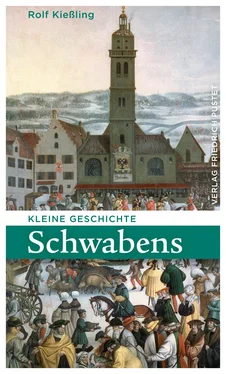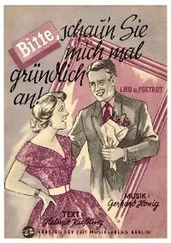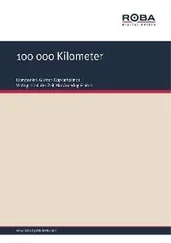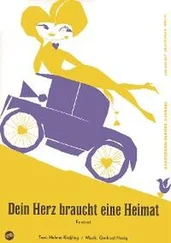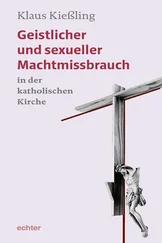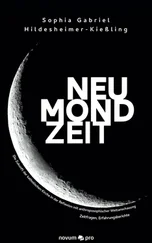Frühmittelalter: Bistum und Herzogtum
Nach dem Tod des Statthalters Aetius 454, der noch einmal den römischen Herrschaftsanspruch durchsetzen konnte, geriet Schwaben endgültig an den sich auflösenden Rand des Römischen Reiches. Abgesehen von der kurzzeitigen Episode eines Protektorats Theoderichs (493–526) über die Alemannen beider Rätien – die allerdings keine stärkeren Spuren hinterlassen hat – stand es nun im Spannungsfeld zwischen Italien und dem Frankenreich, das sich seit dem ausgehenden 5. Jahrhundert im Nordwesten etabliert hatte. Die Dynastie der Merowinger, die mit Chlodwig (481–511) gegen die Alemannen 496 siegreich geblieben war, dehnte ihren Einflussbereich systematisch nach Südosten bis zu den Bajuwaren aus: In beiden Gebieten etablierte sich ein eigenes ‚Stammesherzogtum‘ unter fränkischer Oberhoheit. Ostschwaben zählte zum alemannischen mit Schwerpunkt weiter im Westen um den Bodensee.
Die alemannische ‚Landnahme‘
Die ‚Landnahme‘ der Alemannen gestaltete sich weiterhin als wenig spektakulärer Prozess. Das Einsickern von Gruppen setzte sich bis ins 7. Jahrhundert fort, wobei die Ortsnamen auf -ingen und -heim (soweit sie echt sind) und die Reihengräberbestattungen die Leitlinien aufzeigen: Von den alten Schwerpunkten des Ries und der nördlichen Donauterrassen sowie des unteren Lech, der Wertach und der Iller gingen sie talaufwärts voran, erschlossen dann auch das obere Illertal. Im Mindeltal lässt sich der Besiedlungsvorgang genauer verfolgen: Er begann in Salgen um 500 und rückte bis Mitte des 7. Jahrhunderts über Mindelheim bis zum Ausbauort Dirlewang am Südende des Tales voran, getragen von einer „nur durchschnittlich wohlhabenden“ Schicht (Volker Babucke). Im 7. Jahrhundert treten als Träger zunehmend Adelige mit Herrenhöfen und qualitätvollen Grabbeigaben hervor wie in Schlingen oder Jengen. Pforzen (Forzheim) an einer Wertachfurt oder Spötting am Lech (heute ein Ortsteil von Landsberg) markieren die bevorzugte Lage an Flussübergängen bzw. Straßen; interessanterweise überschritten wohl alemannische Gruppen den Lech, ohne dass damit eine dauerhafte Entwicklung ausgelöst worden wäre.
In der fränkischen Zeit nach der Mitte des 8. Jahrhunderts folgte dann eine erste Phase der Binnenkolonisation mit den jüngeren Ortsnamen auf -dorf, -hofen, -hausen, -heim, -stetten, -beuren. Im Zuge einer ‚fränkischen Staatskolonisation‘ entstanden zudem wohl eine Reihe von heim-Orten mit charakteristischen Himmelsrichtungen (Sontheim, Westheim etc.) oder mit dem Bestimmungswort Franken-, aber auch Friesen-, Sachsen- oder Wenden-.
Seit der Mitte des 6. Jahrhunderts war die Situation bereits durch Verfestigungen bestimmt, die sich in den Benennungen und Lokalisierungen niederschlugen. So schrieb der ostgotische Geschichtsschreiber Jordanes um 551/52: Das Land der Schwaben (regio illa Suavorum) hat im Osten die Bayern (Baibaros) zu Nachbarn, im Westen die Franken, im Süden die Burgunder, im Norden die Thüringer; und wenig später, um 565, berichtete Venantius Fortunatus auf der Rückreise von einer Pilgerfahrt zum Grab des hl. Martin von Tours: Von Augsburg aus, wo du die Gebeine der heiligen Märtyrerin Afra verehren wirst, ziehe weiter gegen die Alpen, dort, wo die Sitze der Breonen liegen, wenn der Weg frei ist und der Bayer dir nicht entgegentritt . Feste Grenzen zu ziehen, wäre freilich voreilig, denn der Prozess der Ethnogenese war noch keineswegs abgeschlossen.
Christianisierung und Kirchenorganisation
Wie die Erwähnung des Afrakultes deutlich macht, gehörte zu den großen kulturprägenden Faktoren in dieser Zeit die Christianisierung. Ihre Anfänge liegen freilich im Dunkeln. So lässt sich nur schwer abschätzen, wie weit die antike Kulttradition, die mit Chur und Säben auch zwei Bischofssitze hatte, hier tatsächlich ins Mittelalter reichte. Die archäologischen Funde von Goldblattkreuzen und anderen christlichen Zeichen auf Gürteln weisen ins 7. Jahrhundert, das Zentrum Augsburg dürfte wohl in die gleiche Zeit zu setzen sein, auch wenn der erste urkundlich genannte Bischof erst mit Wikterp (um 740–772) sicher belegt ist. Man vermutet, dass König Dagobert I. (623–639) zusammen mit der Festlegung des Bistumssprengels Konstanz auch das östlich der Iller benachbarte Bistum Augsburg organisiert haben wird – immerhin verzeichnet ihn der Nekrolog, das Totengedenkbuch, von St. Ulrich und Afra unter seinen Stiftern. Bischofssitze und ihre Sprengel waren strategisch wichtige Machtfaktoren des Frankenreiches. Und so diente Wikterp neben Augsburg auch der alte Lechübergang Epfach als zeitweiliger Aufenthaltsort – an der Grenze zu Bayern.
Die Missionswellen der Irofranken sind für Schwaben eng mit dem heiligen Magnus verbunden, der allerdings erst zur zweiten Welle gehörte. Vorher war Columban mit Gallus um 610 vom fränkischen Königshof nach Bregenz zu den nationes Suevarum gekommen. Während er nach Italien weiter zog, blieb sein Gefährte Gallus in Arbon und gründete die Zelle an der Steinach, das Kloster St. Gallen (um 719) – und stand dabei in enger Verbindung mit dem Alemannenherzog Gunzo von Überlingen; bezeichnenderweise war sein erster Abt Othmar auch ein Alemanne, der seine Ausbildung in Chur erhalten hatte. Von dort aus zogen dann um die Mitte des 8. Jahrhunderts Magnus und Theodor ins Allgäu; Magnus wirkte in dem antiken Ort Epfach, gründete wohl eine Kirche mit Zelle in Füssen (nach 741) und das Kloster in Kempten (um 750), Theodor in Ottobeuren, das nach der Klosterüberlieferung 764 entstanden ist. Die Vita Sancti Magni schildert anschaulich die Weihe der Kirche des hl. Magnus in Kempten durch Bischof Wikterp und erwähnt dabei Audegarius als Gründer und ersten Abt des Klosters; dabei ist auch von einem castrum Campidonensis und von der Anwesenheit einer Menge an ‚Volk‘ (multitudine populis) die Rede. Freilich ist diese Quelle höchst umstritten, vielfach als legendär, als ‚Fälschung‘ auf die Seite geschoben worden, wird aber heute immerhin in ihrem Kern wieder als einigermaßen wahrscheinlich akzeptiert.
Der ‚monastische Aufbruch‘ in größeren und kleineren Niederlassungen war bedeutsam für die entstehende Kirchenorganisation. Die Besetzung der Bistümer aber war eine politische Frage. Das Augsburger Bistum war spätestens im 9. Jahrhundert fest in fränkischer Hand. Besonders wichtig wurde hier bereits Simpert (778–807), der das besondere Vertrauen Karls des Großen genoss; zu seiner Zeit wurde auch der Sprengel jenseits des Lech in Bayern und einschließlich des Ries bis Dinkelsbühl stabilisiert und dem Metropoliten in Mainz unterstellt. Die Ausbildung des Pfarreisystems betonte nicht zufällig mit einer Reihe von Martinspatrozinien, dem fränkischen Reichsheiligen, die politische Verbindung nach Westen.
Das alemannische Herzogtum
Die Herrschaft in Alemannien spiegelt sich im Kampf um das Herzogtum, auch wenn es erst nach und nach klarere Konturen bekommt: 536/37 vom Ostgotenkönig Witigis an den Merowingerkönig Theudebert I. (533–547) abgetreten, hatte es als Provinz des Frankenreiches zunächst eigene Führungsfiguren – die beiden ersten Heerführer, die Brüder Leuthari und Butilinus, waren zwar fränkische Amtsherzöge, handelten aber offenbar mit einer gewissen Selbständigkeit. Mit Gunzo von Überlingen, familiär mit den Merowingern verbunden, der um 680 zu einer Kirchensynode nach Konstanz einlud, wird sein Gebiet genauer greifbar: es war offenbar weitgehend identisch mit dem Bistum Konstanz.
Die Durchdringung des Landes durch die Franken geschah von den romanisierten Rändern aus in das Innere Alemanniens, Herzog Gottfried († 709) residierte dann um 700 bereits in Cannstatt am Neckar. Er war es auch, der versuchte, mit seinem Geschlecht ein eigenes Herzogshaus zu etablieren – wie es den mit ihm verwandten Nachbarn, den Agilolfingern in Bayern, schon seit langem gelungen war –, doch damit geriet er in einen massiven Gegensatz zu den fränkischen Hausmeiern aus dem Geschlecht der Karolinger, die die Herrschaft im Frankenreich nach und nach an sich gezogen hatten und sie nun expandierten. Unter Gottfrieds Söhnen, den Brüdern Lantfrid († 730) und Theudebald (reg. bis 746), kam es zum Machtkampf: Fränkische Adelige wurden als Grafen eingesetzt, um die Macht der Herzöge einzugrenzen; das Kloster Reichenau sollte als karolingische Gründung 724 einen geistlichen Gegenpol zum alemannischen St. Gallen bilden. Dann führten die karolingischen Brüder Karlmann und Pippin d. J. 742/43 erste Feldzüge gegen Herzog Theudebald – und gegen Herzog Odilo von Bayern; beide standen an der Spitze einer ‚Koalition der Unzufriedenen‘. Nach weiteren Niederlagen Theudebalds in den folgenden Jahren schlug Karlmann eine letzte Empörung blutig nieder. Von dem anschließenden Gerichtstag 746 wurde bald als dem ‚Blutgericht von Cannstatt‘ berichtet, bei dem Tausende von Adeligen wegen Hochverrats hingerichtet worden seien – die Quellen dazu sind freilich widersprüchlich. Tatsächlich aber war nach einer schrittweisen Entmachtung des alemannischen Herzogtums dessen Ende gekommen: Nun waren es fränkische Adelige, die den Ton angaben, sich aber mit dem Rest des alemannischen Adels vermischten – ein typischer Vorgang der Integration in das Karolingerreich. Das Ziel der Karolinger, den Zugang zu den Alpen auf breiter Front zu sichern, war erreicht.
Читать дальше