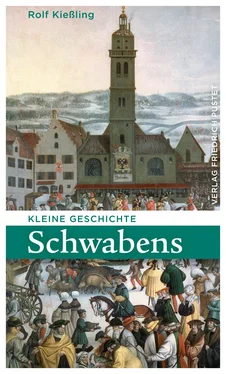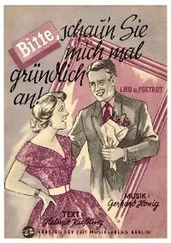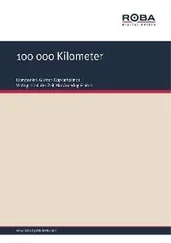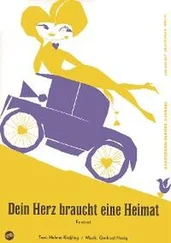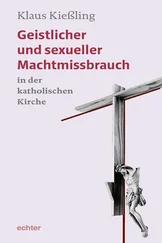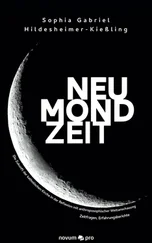Viel über das alltägliche Leben erfahren wir auch aus den Grabdenkmälern der bürgerlichen Oberschicht, die am Ende des 2. Jahrhunderts ihre Handelsgewohnheiten abbildeten. Die Gräber in den Landfriedhöfen bei den Villen und Dörfern fielen mitunter sehr aufwendig aus, etwa das einer Frau unter einem runden Erdhügel von 15 m Durchmesser an der Straßenstation bei Wehringen mit einer Urne der Toten, Resten von Holzmöbeln, Geschirr aus Bronze, Keramik und Glas und einer Kosmetikausstattung. Auf dem gleichen Friedhof war auch ein Arzt bestattet worden, dem man sein chirurgisches Besteck, Medikamente und eine Tageskasse beigegeben hatte.

Tempel des Apollo Grannus in Phoebiana (Faimingen), erste Hälfte des 2. Jhs. (Teilrekonstruktion).
Die Verehrung der Götter galt in Rätien neben Jupiter als ‚Vater der Götter und Menschen‘ vor allem dem Merkur, dem Patron der Kaufleute. Einen guten Eindruck vom römischen Götterhimmel in der Provinz eröffnet der berühmte Weißenburger Schatzfund des 2./3. Jahrhunderts, der 1979 in einem Spargelbeet entdeckt wurde und heute Teil des Museums ist. Eine besonders ausgeprägte Bedeutung hatte der Heil- und Quellgott Apollo Grannus, dem man in Phoebiana (Faimingen), einem Ort bei Lauingen, einen eigenen Tempel weihte. Hier suchte sogar Kaiser Caracalla während seines Feldzugs gegen die Alemannen 212/13 Heilung.
Diese recht ruhige Phase ging mit der Krise des 3. Jahrhunderts zu Ende, die sich im gesamten Römischen Reich von den Rändern her immer deutlicher bemerkbar machte. In Rätien waren es seit 233 die Alemannen und die Juthungen – sie siedelten nördlich der Donau im Anschluss an die Alemannen –, die für permanente Unruhe sorgten. Auch ein spektakulärer Sieg im April 260 vor den Toren Augsburgs „über die Barbaren des Stammes der Semnonen oder/und Juthungen“ – an dem übrigens auch Germaniciani beteiligt waren – offenbart die „wirren und desolaten Zustände in Rätien“ zu dieser Zeit (Lothar Bakker). Er kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine Rücknahme der Grenze die einzige Chance zur Stabilisierung bot: Es entstand der ‚nasse Limes‘ vom Rhein über den Bodensee und die Iller entlang der Donau; das nördlicher gelegene Gebiet wurde verlassen – aber nie offiziell aufgegeben, was sich in der Fortdauer des Namens Rätien in ‚Ries‘ zeigen mag. Der verbliebene Teil wurde systematisch befestigt: Binnenplätze wie der Lorenzberg bei Epfach (Abodiacum) oder der Goldberg bei Türkheim stehen dafür ebenso wie die Aufgabe der Stadt Kempten zugunsten eines kleineren Areals unterhalb der Burghalde. Zivile Plätze wie Günzburg (Guntia) oder die neuen Kastelle Kellmünz (Caelius Mons) , Bürgle bei Gundremmingen (Pinianis) oder Burghöfe bei Mertingen (Sumuntorio) , dazu die zahlreichen Wachttürme markierten die Grenze.
Die letzte Phase des Römerreiches nördlich der Alpen in ‚Schwaben‘ war von Rückzug und Auflösung bestimmt, aber auch von einem zunehmenden Verwischen der Konturen gegenüber den Germanen. Trotz einer gewissen Beruhigung in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts unter Konstantin (306–337), einer Zeit, in der die Provinz Rätien geteilt wurde und Augsburg nunmehr als Hauptstadt der Provinz Raetia secunda fungierte, wird erkennbar, dass zunehmend auch alemannischjuthungische Kohorten das rätische Grenzheer stellten – man spricht zugespitzt von einem ‚Bruderkrieg an der Grenze‘.
Gleichzeitig wurden Germanen aber auch im Inneren angesiedelt, um als eine Art ‚Bauernmiliz‘ rasch mobilisiert werden zu können. Dennoch war die Abwanderung nach Süden für viele Romanen der einzige Ausweg, und von den einst blühenden Siedlungen blieben nur noch verkümmerte Reste, sodass selbst die Versorgung der Provinz weitgehend aus Italien erfolgen musste. Nur mehr Augsburg war so etwas wie eine ‚romanische Hochburg‘, nicht zuletzt als Rückzugsort für die Landbevölkerung, während das flache Land immer mehr unter den Einfluss der Alemannen geriet.
Wer waren diese Alemannen? Die Namensüberlieferung und Deutung als ‚zusammengelaufene und vermischte Leute‘ stammt von dem antiken Schriftsteller Asinius Quadratus. Entgegen der romantischen Vorstellung vom einheitlichen alten Großstamm ist man heute einhellig der Meinung, dass das Selbstverständnis, das sich in diesem Namen spiegelt, auf eine „Ethnogenese der Alemannen aus verschiedenen, ethnisch unterschiedlichen Personengruppen“ im Vorfeld des Limes hinweist (Dieter Geuenich). Schon die Spitzenstellung von mehreren reges (Anführer, Könige) und dazu noch regales (Unterkönige) und optimates (Adelige), belegt in der Schlacht bei Straßburg 357, zeigt eine sehr differenzierte innere Struktur. Sie bildet sich in den archäologisch fassbaren Funden auf den zahlreichen Höhenburgen der Oberschicht im heutigen Württemberg ab – der ‚Runde Berg‘ bei Urach ist der bekannteste.
Die Herkunft der Alemannen ist freilich nur in Umrissen erkennbar, doch lassen die Ausgrabungsfunde immerhin den Schluss einer engen Verwandtschaft mit elbgermanischen Gruppen zu, vor allem aus dem Mittelelbe-Saale-Gebiet. Im Bestattungsritus hatten sie allerdings bereits einen Traditionsbruch vollzogen, nämlich die Körperbestattung in durchaus aufwendigen Grabbauten, während die Elbgermanen vorwiegend Urnenbestattungen vornahmen. Außerdem ist eine Abgrenzung zu den Juthungen, die wohl schon im späten 5. Jahrhundert in den Alemannen aufgegangen sind, bislang nicht möglich – also tatsächlich ein ‚zusammengewürfeltes Mischvolk‘.
Zudem finden sich untrügliche Zeichen einer kulturellen Angleichung bis hin zur ‚friedlichen Koexistenz‘ mit den Römern. Rätische Grabfunde belegen eine Mischung aus provinzialrömischen und germanischen Formen. Aber auch einzelne Gräber auf dem flachen Land – wie der Bestattungsplatz einer Kleinsiedlung bei Westendorf – enthalten noch Waffenbeigaben eindeutig germanischer Tradition. Auf eine Nachahmung römischer Lebensweise deuten andererseits die Verwendung von Keramik und die Metallverarbeitung, wie sie auf den alemannischen Höhensiedlungen üblich wurden. Der Gedanke ist nicht weit hergeholt, dass die aus schriftlichen Quellen belegten römischen Gefangenen der Alemannen auch Handwerker gewesen sein könnten. Selbst die befestigten Burganlagen lassen sich möglicherweise auf römische Vorbilder zurückführen.
Die breite Phase des Übergangs von der Antike zum Mittelalter wird in Rätien somit nicht nur als Abwehrkampf, sondern auch als langer friedlicher Akkulturationsprozess begreifbar. Dass Namensmaterial – die Fluss- und einige Ortsnamen – und zivilisatorische Techniken handwerklicher Arbeit wie agrarische Methoden dazugehören, ist unbestritten. Siedlungskontinuitäten sind schon wesentlich schwerer zu fassen, wie das Beispiel Augsburg zeigt: Hier ist es sehr plausibel, die weitere Existenz provinzialrömischer Bevölkerung anzunehmen, beim Gräberfeld von St. Ulrich und Afra gibt es Brücken bei der Bestattung bis ins 6. Jahrhundert, und jüngst ist nicht nur die Ausgrabung eines alemannischen Siedlungskomplexes in der Nähe des Domes an der südlichen römischen Stadtmauer gelungen, sondern im Dombezirk selbst wurde eine Schichtenfolge bis ins Mittelalter nachgewiesen. Auf dem Land muss man von der Nutzung römischer Villenbauten und ihrer agrarischen Ressourcen ausgehen – und sei es nur als Steinbruch –, ohne dass direkte Kontinuitäten nachweisbar wären; lediglich bei den spätrömischen befestigten Siedlungen, etwa dem Lorenzberg bei Epfach, ist eine solche Annahme begründet, weil hier in den Ruinen einer spätantiken Kapelle alemannische Siedler der Merowingerzeit einen Friedhof anlegten. Eindringende Germanengruppen, vor allem Alemannen, lebten zwischen Resten romanischer Bevölkerung.
Читать дальше