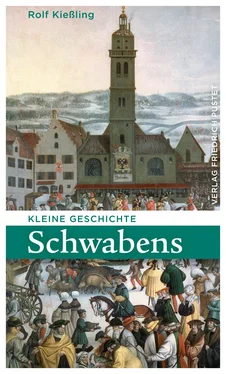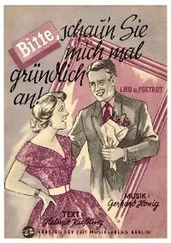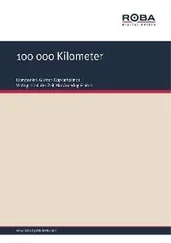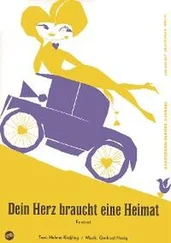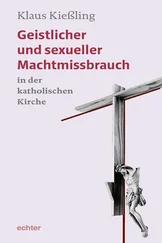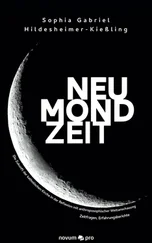Dieses ‚ältere Stammesherzogtum‘ gewinnt durchaus deutliche Konturen: An die Spitze des herrschenden Adels hatte sich ein Herzogshaus gesetzt, es hatte den Aufbau der Kirche vorangetrieben und mit der Lex Alamannorum ein Gesetzbuch erlassen. Wie die anderen germanischen ‚Volksrechte‘ auch – etwa die Lex Baiuwariorum oder die fränkische Lex Salica – zielte es darauf, mit einer schriftlichen Rechtsgrundlage wenigstens die „primitive Friedensordnung“ eines Bußenkatalogs als verbindliche Verfahrensform gegen die „destabilisierenden Rachemechanismen“ zu setzen (Clausdieter Schott). Der ältere Pactus wohl aus dem beginnenden 7. Jahrhundert wurde unter Herzog Lantfrid um 730 zur Lex erweitert – damals noch in engem Zusammenwirken mit dem fränkischen Königtum. Sie handelt vom Schutz der Kirche, von der Rolle des Herzogs als Gerichtsherr und Friedensgarant sowie als Heerführer und schließlich von den ‚Volkssachen‘ mit verschiedenen Rechtsfällen. Sie unterschied die Menschen in Unfreie und Freie, die wiederum in verschiedene Stände gegliedert waren: die ‚minderbemittelten Freien‘ (baro minoflidis) , die ‚mittleren Standes‘ (medianus) und die ‚hohen Standes‘ (primus Alemannus) . Das ‚Wergeld‘, das als Buße bei den verschiedenen Vergehen zu entrichten war, war entsprechend abgestuft. Auch wenn es sich um rechtliche Kategorien handelte, so spiegelt sich in ihnen doch auch die soziale Gliederung. Sie wurde ihrerseits nach Rang und Vermögen bemessen, nach der Größe der Hausgemeinschaften und der Nähe zum Herrscher, erkennbar nicht zuletzt auch am Wert der Grabbeigaben.
Schwaben als Teil des Frankenreichs
Mit den Karolingern setzte um 760 eine administrative Neuordnung an Oberrhein, Bodensee und Donau ein; sie ist mit den beiden fränkischen Grafen Warin und Rudhart eng verbunden. Ein wichtiges Instrument war die Einrichtung von Grafschaften, in denen das Reichsgut verwaltet wurde und sich die Reichspräsenz personalisierte; bei ihrer Besetzung rang die fränkische ‚Reichsaristokratie‘ mit den einheimischen Geschlechtern um Einfluss. Erst in der Zeit Kaiser Ludwigs des Frommen (817–843) konnte aber die königliche Herrschaft so verdichtet werden, dass die Grafschaften „zur Verwaltung eines ausgedehnten Siedelgebietes“ wurden. Dennoch hat es eine „restlose Einteilung Alemanniens in königsherrschaftliche Grafschaften“ nicht gegeben (Michael Borgolte).
Beobachtungen, wie das in Ostschwaben aussah, lassen sich freilich nur andeutungsweise machen. Zwar wissen wir, dass nördlich des Bodensees der Linz- und der Argengau lagen, östlich anschließend um Leutkirch der Nibelgau und nördlich davon der Rammagau um Laupheim sowie der schwer lokalisierbare Haistergau als Herrschaftsbereiche fungierten, zu denen etwas später auch der Alpgau, das Allgäu, kam. Diesseits der Iller lagen der Duriagau (vermutlich im Ulmer Winkel) und der Illergau im Raum Kempten-Memmingen. Im äußersten Osten, beiderseits des Lech, findet sich der Augstgau, der von Augsburg bis zum Ammersee und den Kaufbeurer Raum reichte. Im nördlichen Teil lag der Riesgau.
In diesem ausgedehnten Gebiet um den Bodensee und seinen östlich anschließenden Bereichen schoben sich einige große Adelsgeschlechter in den Vordergrund. Die ‚Udalrichinger‘, wie sie nach ihrem Leitnamen Udalrich/Ulrich genannt wurden, waren bis ins 9. Jahrhundert hinein dominierend; sie ließen sich einerseits auf das alemannische Herzogshaus zurückführen, waren aber andererseits über Hildegard, die zweite Ehefrau Karls d. G., mit den Karolingern verschwägert und gewannen schon deshalb an Einfluss, bewiesen aber auch Loyalität gegenüber dem fränkischen Königtum. Als Ludwig der Fromme 819 Judith heiratete, stiegen die Welfen als konkurrierende Hochadelsfamilie auf; ihre Besitzschwerpunkte lagen einerseits im Linzgau in Oberschwaben und andererseits am Lechrain südlich von Augsburg.
Der königliche Grundbesitz lässt sich dagegen nur schwer fassen; man muss ihn aus der ‚Negativfolie‘ rekonstruieren, nämlich aus den Schenkungen, die weitergereicht wurden. Das Netz der Königshöfe findet sich vielfach in späteren Städten, so etwa in Kaufbeuren oder Mindelheim; eine gewichtige Königspfalz lag in Ulm. Besser erkennbar wegen der guten klösterlichen Überlieferung ist die zweite prägende Kraft, die Reichskirche. Für das Bistum Augsburg, dessen Bischöfe zunehmend zu wichtigen Stützen der Reichspolitik wurden, ist um 810 ein Verzeichnis des Grundbesitzes überliefert, das einen quantitativen Eindruck vermittelt: Es umfasste nicht weniger als 1006 von Freien und 421 von Leibeigenen bebaute, dazu 80 unbebaute Hofgüter. Die großen Klöster – abgesehen vom Besitz außerhalb Ostschwabens gelegener Abteien wie Reichenau oder St. Gallen, aber auch des weit entfernten Fulda, das im Ries begütert war – entfalteten sich zu weiteren wichtigen Stützpunkten des Reiches. Allen voran stand Kempten, das von der Kaisergemahlin Hildegard und ihrem Sohn Ludwig dem Frommen große Güterkomplexe geschenkt erhielt und damit aufstieg; ähnlich wurde auch Ottobeuren durch die Karolinger gefördert.
So ist es wohl nicht übertrieben, Ostschwaben in dieser fränkischen Zeit als ausgeprägtes Reichsland zu charakterisieren – auch wenn es nur zeitweise wie unter Ludwig dem Deutschen (826–876), der sich sehr häufig in seiner Regensburger Residenz aufhielt, auch räumlich in die Nähe des Herrscherhauses rückte.
Hochmittelalter: Herrschaftsbildung in der Region
Der Untergang des Karolingischen Großreiches an der Wende zum 10. Jahrhundert ging überall mit einer stärkeren Regionalisierung der Politik einher, nicht zuletzt auch deshalb, weil die Gefährdung von außen, in Süddeutschland durch die zahlreichen und verheerenden Einfälle der Ungarn, nur über die regionale Politik aufgehalten werden konnte. In Schwaben bedeutete das – wie im benachbarten Bayern – das Wiederaufleben der herzoglichen Gewalt in einem karolingischen Teilreich, nun unter dem Namen ‚Herzogtum Schwaben‘. Das Gegenüber mit der Reichskirche aber blieb als Grundkonstante bestehen, sodass das Reichsbistum Augsburg in dem Moment zum Gegengewicht werden konnte, als die Herzogsgewalt sich zu verselbständigen drohte.
Noch einmal: Herzogtum Schwaben und Reichsbistum Augsburg
Erneut war der Bodenseeraum das Zentrum der Entwicklung – die Pfalz Bodman, die Wahlwies und der Hohentwiel gelten als herzogliche Vororte; wieder war also unser Schwaben nur der östliche Teil. Denn das Herzogtum, der ducatus als Amtsgewalt, reichte so weit, wie die Lex Alamannorum angewandt wurde; diese provincia oder regio Schwaben hatte freilich nur mehr bedingt mit alten ‚Stammesgrenzen‘ zu tun, sondern war durch politische und rechtliche Grenzen definiert. Dazu gehörte – sehen wir vom Elsass ab, dessen Zugehörigkeit schwankte – neben dem zentralen Bodenseegebiet sowie Oberrätien mit der alten Bischofsstadt Chur zeitweise auch der Vinschgau; die Grenze gegen Bayern im Osten war durch die Zugehörigkeit der Klöster St. Mang, Kempten und Ottobeuren bis hinauf nach Ellwangen zu Schwaben belegt. Die Herzöge stammten alle aus der karolingischen Reichsaristokratie und stützten sich auf Reichsgut; sie waren ‚Amtsherzöge‘ der königlichen Gewalt. Auch wenn der wahrscheinliche erste Herzog Burkhard († 911) aus dem einheimischen Adel stammte, so konnte dieses Geschlecht der Hunfridinger doch keine ausgeprägte Dynastie bilden, denn der Wechsel der Familienzugehörigkeit vollzog sich relativ schnell. Schon Burkhard II. (917–926) unterwarf sich 919 dem König, 926 kam mit Hermann I. aber ein Landfremder zum Zuge, und das blieb mit wenigen Ausnahmen so bis in die Mitte des 11. Jahrhunderts – nur in Zeiten schwacher Könige pochte der einheimische Adel auf die Wahl aus seinen Reihen. Auch wenn die Herzöge auf die Mitwirkung des regionalen Adels angewiesen waren, dem sie vorstanden, so blieben sie doch primär auf das Königtum orientiert, von dem sie ihre Legitimation erhielten.
Читать дальше