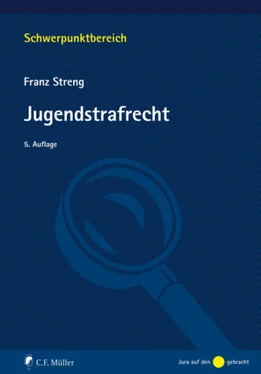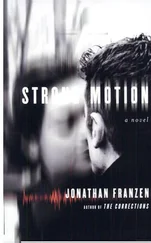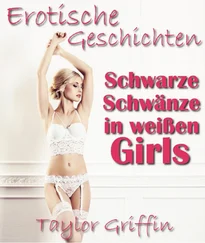II. Persönlicher Anwendungsbereich
42
Das JGG ist gem. § 1 I JGG auf Jugendliche und Heranwachsende anwendbar. Jugendlicherist gem. § 1 II JGG, „wer zur Zeit der Tat vierzehn, aber noch nicht achtzehn… Jahre alt ist“; Heranwachsenderist, „wer zur Zeit der Tat achtzehn, aber noch nicht einundzwanzig Jahre alt ist“. Knapper ausgedrückt gilt das JGG für diejenigen Personen, die zur Zeit der Tat[3] schon 14, aber noch nicht 21 Jahre alt sind. Das Alter bei Aburteilung ist unerheblich, weshalb etwa auch 50-Jährige wegen ihrer als Jugendlicher oder Heranwachsender begangenen Taten vor den Jugendrichter kommen können – wenn die Verjährungsfrist noch nicht abgelaufen ist (vgl § 78 II, III StGB). Auch bezüglich der Rechtsfolgen bei Taten Heranwachsender sind die Regelungen der §§ 105 – 106 JGG auf den Tatzeitpunkt bezogen.
Für die Berechnung des Altersdes Täters gelten die Regeln der §§ 186 ff BGB. Es zählt daher gem. § 187 II BGB der Tag der Geburt ab null Uhr bei der Altersberechnung mit[4]. Bei nicht in Deutschland Geborenen kommt es vor, dass die Altersbestimmung Probleme bereitet; auf die Angaben in den Papieren des Heimatlandes ist nicht immer Verlass[5]. Hier kann gem. § 81a StPO eine Begutachtung angeordnet werden, bei welcher regelmäßig eine röntgenologische Skelettuntersuchung durchgeführt wird[6].
43
Die Unterteilung in Jugendliche und Heranwachsende ist insofern bedeutsam, als für Heranwachsendedas materielle wie das formelle Jugendstrafrecht nur mit Einschränkungen gilt. § 105 I JGG enthält eine Weichenstellung hinein ins materielle Jugendstrafrecht mit seinem spezifischen Rechtsfolgensystemoder – bei Verneinung der Voraussetzungen von § 105 I – ins Erwachsenenstrafrecht (vgl auch § 106 JGG). Welche der Verfahrensvorschriftendes JGG auch auf Heranwachsende anwendbar sind, ergibt sich aus § 109 JGG, wobei es teilweise relevant ist, ob die Tat des Heranwachsenden nach Jugendstrafrecht oder nach Allgemeinem Strafrecht (Erwachsenenstrafrecht) sanktioniert wird (§ 109 I, II iVm § 105 I JGG). – Die Struktur des Gesetzes, das zunächst ganz auf die Jugendlichen abstellt, und die Heranwachsenden nur in einem Anhang (§§ 105 – 112 JGG) berücksichtigt, findet ihre Erklärung darin, dass die Heranwachsenden erst nachträglich, nämlich im Jahr 1953, in den Geltungsbereich des JGG aufgenommen wurden.
44
Für Kinder, also die unter 14-Jährigen, gilt das JGG nicht. Gem. § 19 StGB ist schuldunfähig, wer bei Begehung der Tat noch Kind ist. In verfahrensrechtlicher Hinsicht ist absolute Strafunmündigkeit ein Prozesshindernis[7]. Es darf schon gar kein Strafverfahren eingeleitet werden. Ist dies doch geschehen, so ist bei Feststellung von (möglicher) Strafunmündigkeit das Verfahren einzustellen. Es gilt der Grundsatz „in dubio pro reo“. Die Staatsanwaltschaft verfährt gem. § 170 II StPO. Ist bereits Anklage erhoben, darf das Gericht das Hauptverfahren nicht eröffnen (Beschluss gem. § 204 StPO). Nach Eröffnung des Hauptverfahrens wird das Verfahren gem. § 206a StPO (Beschluss; außerhalb der Hauptverhandlung) oder gem. § 260 III StPO (Urteil; in der Hauptverhandlung) eingestellt. – Die Strafbarkeit von Mittätern und Teilnehmern des strafunmündigen Kindes bleibt unberührt. Das Kind kann Vortäter einer Hehlerei (§ 259 StGB) sein. Im Zusammenwirken des Kindes mit einem strafmündigen Täter kann eine Körperverletzung für diesen wegen Beteiligung mehrerer (mindestens zwei) zu einer gefährlichen Körperverletzung werden (§ 224 I Nr 4 StGB). Es ist umstritten, ob in Beleidigungsfällen eine Aufrechnung (Kompensation: § 199 StGB) möglich ist, wenn der Gegner ein Kind war[8].
Auch wenn Kinder nicht strafrechtlich für ihre Taten verantwortlich gemacht werden können, werden Straftaten doch vielfach Anlass für Maßnahmen des Jugendamtesoder des Familiengerichtsgeben. RL 2 zu § 1 JGG verpflichtet denn auch den Staatsanwalt, der wegen Schuldunfähigkeit gem. § 19 StGB keine Anklage erhebt, in geeigneten Fällen das Familiengericht oder andere in Frage kommende Stellen zu benachrichtigen.
Exkurs:Die Richtlinien (RL) zum JGG stellen Vereinbarungen der Landesjustizverwaltungen dar; die derzeit gültige Fassung wurde vom Strafrechtsausschuss der Landesjustizministerkonferenz im April 1994 verabschiedet. Die Richtlinien binden die weisungsgebundenen Staatsanwälte. Den unabhängigen Richtern können sie nur unverbindliche Hinweise und Empfehlungen geben.
45
Für Taten Erwachsenergilt das JGG grundsätzlich nicht. Dennoch stehen häufig Erwachsene vor dem Jugendrichter – zumeist für ihre Taten im Alter bis 21 Jahren. Denn für die Zuständigkeit der Jugendgerichte kommt es gem. §§ 1, 33 ff, 107 f JGG auf das Tatzeit-Alter an[9]. Werden gem. § 103 JGG Verfahren gegen Jugendliche und Erwachsene verbunden, was auch bei mehreren Taten einer Person in verschiedenen Altersstufen der Fall sein kann, dann ist regelmäßig das Jugendgericht zuständig. Eine Ausnahme regelt § 103 II S. 2 JGG bezüglich der Zuständigkeit von Wirtschaftsstrafkammern sowie von Kammern für Staatschutzsachen (vgl auch § 104 JGG). Für das Verfahren gegen Erwachsene vor dem Jugendgericht gilt Jugendrecht, soweit das Gesetz nichts anderes vorgibt[10]. Jedoch ist für die Rechtsfolgenbestimmung bezüglich der zur Tatzeit Erwachsenen das materielle Allgemeine Strafrecht maßgeblich – falls nicht ausnahmsweise die Anwendung von § 32 JGG etwas anderes ergibt (dazu unten Rn 284 ff).
46
Das JGG gilt auch für Soldaten der Bundeswehr. Allerdings enthalten die §§ 112a – 112e JGG Sondervorschriften, die der besonderen Lage des jungen Soldaten und den besonderen Bedürfnissen der militärischen Disziplin Rechnung tragen sollen.
[1]
Vgl etwa BGH, NStZ 2006, 574; BGH, NStZ 2008, 625 f.
[2]
Vgl BGH, ZJJ 2005, 205 mit Anm. Ostendorf ; weitergehend Ostendorf , in: BMJ, Jugendstrafrechtsreform, S. 325, 331 ff; ferner Lüderssen , in: FS Schreiber, S. 289 ff; Eisenberg , DRiZ 2006, 120 ff.
[3]
Dazu näher Laubenthal/Baier/Nestler , JugStrR, Rn 59.
[4]
Vgl RGSt 35, 37, 40; Brunner/Dölling , JGG, § 1 Rn 22; MünK-StGB/ Laue , § 1 JGG Rn 7; Laubenthal/Baier/Nestler , JugStrR, Rn 60.
[5]
Vgl BGHSt 47, 311, 312 f; BGH, StV 1997, 623 f; Zieger/Nöding , Verteidigung, Rn 192; BeckOK-JGG/ Putzke , § 1 Rn 13 f.
[6]
Vgl Henninger , Nichtdeutsche, S. 153 ff; T. Jung , StV 2013, 51 ff; MünK-StGB/ Streng , § 19 Rn 6; Ostendorf/ Ostendorf , JGG, § 1 Rn 12; OLG Hamburg, StraFo 2005, 121 f; dazu krit. Gundelach , ZJJ 2018, 139, 141 ff; BeckOK-JGG/ Putzke , § 1 Rn 13.
[7]
Vgl RGSt 57, 206, 207 f; Jescheck/Weigend , AT, § 40 II 1; Streng , in: FS Gössel, S. 501, 503 ff; MünK-StGB/ Streng , § 19 Rn 5, 11; Ostendorf , in: FS Heinz, S. 464 ff; Schönke/Schröder/ Perron/Weißer , StGB, § 19 Rn 5.
[8]
Vgl zum Ganzen LK/ Schöch , § 19 Rn 2; NomK-StGB/ Schild , § 19 Rn 7 f; MünK-StGB/ Streng , § 19 Rn 9 f.
[9]
Dazu ausführl. und kritisch Budelmann , Jugendstrafrecht, S. 80 ff.
[10]
Vgl Brunner/Dölling , JGG, § 103 Rn 25.
Teil II Der Geltungsbereich des JGG› § 4 Die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Jugendlichen
§ 4 Die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Jugendlichen
Читать дальше