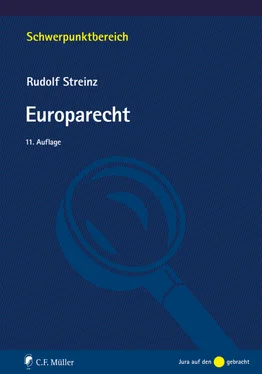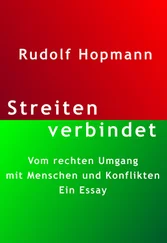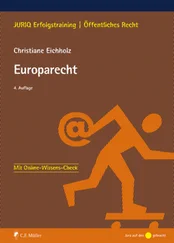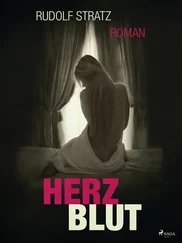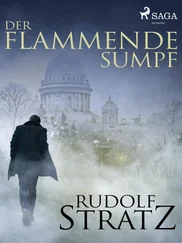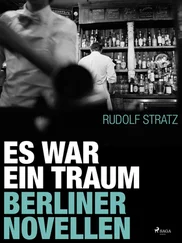Lösung Fall 3:
In Betracht käme eine Nichtigkeitsklage gemäß Art. 263 AEUV.
I. Art. 263 Abs. 2 AEUV :Privilegiert klagebefugt gemäß Art. 263 Abs. 2 AEUV sind nur die „Mitgliedstaaten“. Mitgliedstaat ist aber allein B, nicht der Gliedstaat W. Man kann auch nicht annehmen, dass in den Bereichen, die nach der innerstaatlichen Kompetenzverteilung den Gliedstaaten obliegen, B durch W „vertreten“ wird. Denn dies sieht das („landesblinde“) Unionsrecht nicht vor[127].
II. Art. 263 Abs. 4 AEUV :
1. Juristische Person: Der (unionsrechtliche[128]) Begriff der juristischen Person ist weit zu fassen (Wortlaut: „Jede“; Umkehrschluss aus Art. 33 EGKSV , wonach nur „Unternehmen“ und „Verbände von Unternehmen“ klagebefugt sind). Daher fallen auch juristische Personen des öffentlichen Rechts darunter, soweit ihnen das nationale Recht Rechtspersönlichkeit verleiht. Dies ist bei W als autonomer Gebietskörperschaft der Fall.
2. Zulässiger Klagegrund: (Voraussetzungen des Art. 263 Abs. 2 AEUV). W muss die angebliche Verletzung des AEUV rügen.
III.Unmittelbare und individuelle Betroffenheit durch den Klagegegenstand: Der nicht privilegierte Klageberechtigte muss eine besondere Klagebefugnis, die sich auf die geltend gemachten Klagegründe bezieht, dartun (s. Rn 665). Der Beschluss ist zwar an den Mitgliedstaat B gerichtet. Durch die Untersagung wird jedoch auch der Gliedstaat W unmittelbar und individuell betroffen, da ihm der Mitgliedstaat B die Gewährung der Beihilfe untersagen muss.
Ergebnis:Die Klage ist zulässig.
195
Der EuGH hat die Klage zugelassen, da die Kommission dagegen keine Einwände erhoben und er (fehlerhaft) keine Veranlassung gesehen hat, die Klagebefugnis von Amts wegen zu prüfen. Der Generalanwalt hatte die Klagebefugnis gemäß Art. 263 Abs. 4 AEUV bejaht[129].
196
Im Primärrecht festgelegte Kompetenzverluste können autonome Gebietskörperschaften (wie die deutschen Bundesländer) mit der Nichtigkeitsklage, die sich nur gegen sekundäres Unionsrecht richten kann, nicht abwehren. Kompetenzverluste durch sekundäres Unionsrecht (Verordnungen oder Richtlinien von Rat oder Kommission) könnten aber mit der Begründung angegriffen werden, dass für den betreffenden Rechtsakt die Verbandskompetenz der Union fehle, dieser daher von den Gründungsverträgen nicht gedeckt und somit nicht rechtmäßig iSv Art. 263 AEUV sei. Seit Inkrafttreten des Unionsvertrages ist auch eine Rüge der Verletzung des Subsidiaritätsprinzips (Art. 5 Abs. 3 EUV) oder des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes (Art. 5 Abs. 4 EUV) denkbar. Das Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit zum Vertrag von Lissabon[130] sieht darüber hinaus vor, dass in Mitgliedstaaten mit Zwei-Kammer-Parlamenten jede dieser Kammern eine Subsidiaritätsrüge (Art. 6 SubsProt) bzw Subsidiaritätsklage (Art. 8 SubsProt) gegen Rechtsakte der Union erheben kann. Auch wenn der Bundesrat keine echte „zweite Kammer“ bildet, sieht § 11 IntVG[131] hinsichtlich der Subsidiaritätsrüge und Art. 23 Abs. 1a GG und § 12 IntVG hinsichtlich der Subsidiaritätsklage vor, dass Bundestag und Bundesrat von dieser Möglichkeit unabhängig voneinander Gebrauch machen können. Unionsrechtlich ist dies wegen der Verfassungsautonomie der Mitgliedstaaten zulässig.
197
Gemäß Art. 263 Abs. 4 AEUV besteht die Klagebefugnis jetzt gegen „Handlungen“. Darunter können auch Richtlinien fallen, die die Gebietskörperschaften unmittelbar und individuell betreffen. Dies ist dann der Fall, wenn eine an den Mitgliedstaat gerichtete Richtlinie innerstaatlich nur von den Gebietskörperschaften (legislativ) vollzogen werden kann.
Literatur (s. auch Rn 180und 391):
Albin , S., Das Subsidiaritätsprinzip in der EU – Anspruch und Rechtswirklichkeit, NVwZ 2006, 629; Blumenwitz, D ., Das Subsidiaritätsprinzip und die Stellung der Länder und Regionen in der Europäischen Union, in: GS Grabitz, 1995, S. 1 ff; Häberle, P ., Das Prinzip der Subsidiarität aus der Sicht der vergleichenden Verfassungslehre, AöR 119 (1994), 133; Ipsen, H.P. , Als Bundesstaat in der Gemeinschaft, in: FS Hallstein, 1966, S. 248 ff; Isensee, J ., Bundesland in Europa. Schwierigkeiten einer dritten Ebene in der Europäischen Union, NdsVBl. 2015, 1; Reich, D.O ., Zum Einfluss des Europäischen Gemeinschaftsrechts auf die Kompetenzen der deutschen Bundesländer, EuGRZ 2001, 1; Ritzer, C./Ruttloff, M ., Die Kontrolle des Subsidiaritätsprinzips: Geltende Rechtslage und Reformperspektiven, EuR 2006, 116; Schäfer, T ., Die deutsche kommunale Selbstverwaltung in der Europäischen Union, 1998; Schelter, K./Wuermeling, J ., Europa der Regionen, 1995; Silberhorn, T ., Die Neugestaltung der Beteiligung des Deutschen Bundestages in Angelegenheiten der Europäischen Union, in: Busek, E./Hummer, W . (Hrsg.), Die Konstitutionalisierung der Verbandsgewalt in der (neuen) Europäischen Union, 2006, S. 173 ff; Streinz, R ., Die Abgrenzung der Kompetenzen zwischen der EU und den Mitgliedstaaten unter besonderer Berücksichtigung der Regionen, BayVBl. 2001, 481; Zuleeg, M ., Die föderativen Grundsätze der Europäischen Union, NJW 2000, 2846.
§ 3 Grundlagen der Europäischen Union› VII. Das Verhältnis von Unionsrecht und nationalem Recht
VII. Das Verhältnis von Unionsrecht und nationalem Recht
198
Fall 4 (Nach EuGH, Rs 6/64, Costa/ENEL, Slg 1964, 1251 = HVL , S. 35 f = Pechstein Nr 1):
Italien verstaatlichte 1962 die Erzeugung und Verteilung des elektrischen Stroms und gründete zu diesem Zweck die ENEL, der als juristischer Person die Betriebsanlagen der verstaatlichten Elektrizitätsunternehmen übereignet wurden. Costa war Aktionär der von der Verstaatlichung betroffenen Aktiengesellschaft Edisonvolta. Er weigerte sich, die Stromrechnung der ENEL zu bezahlen und machte in dem daraufhin anhängigen Rechtsstreit geltend, die Verstaatlichung verstoße gegen das Unionsrecht.
Welche Auswirkungen hätte ein solcher Verstoß, wenn er tatsächlich vorliegt, auf das italienische Gesetz? (Lösung: Rn 224 )
199
Fall 5 (Nach BVerfGE 73, 339 – „Solange II“ = HVL , S. 49 f):
Die deutsche Firma W beantragte eine Einfuhrlizenz für Champignonkonserven aus dem Drittstaat Taiwan. Dies wurde von der zuständigen deutschen Behörde, gestützt auf Verordnungen der EU, verweigert. Die dagegen erhobene verwaltungsgerichtliche Klage blieb in allen Instanzen erfolglos. Das BVerwG hatte eine Vorabentscheidung des EuGH gemäß Art. 267 Abs. 3 AEUV eingeholt, der die Rechtmäßigkeit der EU-Verordnungen bestätigte. W hielt diese Auslegung der Verordnungen durch den EuGH für unvereinbar mit deutschem Verfassungsrecht und regte ein erneutes Vorabentscheidungsersuchen sowie eine Normenkontrollvorlage an das BVerfG gemäß Art. 100 Abs. 1 GG an. Da das BVerwG dem nicht gefolgt war, erhob W gegen dessen Urteil Verfassungsbeschwerde zum BVerfG ua mit der Begründung, das BVerwG habe sie durch das Unterlassen einer erneuten Vorlage an den EuGH ihrem gesetzlichen Richter (Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG) entzogen.
Hat die Verfassungsbeschwerde Aussicht auf Erfolg? (Lösung: Rn 268 )
200
Fall 6 (Nach BVerfG, EuGRZ 1989, 339 f):
Die EU-Kommission hat eine Richtlinie über die Etikettierung von Tabakerzeugnissen vorgeschlagen, der zufolge ua für Zigarettenpackungen bestimmte obligatorische und fakultative Warnhinweise vorgeschrieben werden sollen. Mehrere Tabakhersteller sehen sich dadurch in ihren Grundrechten gefährdet und beantragen beim BVerfG den Erlass einer einstweiligen Anordnung gegen die Bundesregierung, mit der dieser aufgegeben werden soll, im Rat der EU gegen den Vorschlag dieser EU-Richtlinie zu stimmen und sich auch gegenüber den anderen Mitgliedstaaten für die Ablehnung dieser Richtlinie einzusetzen.
Читать дальше