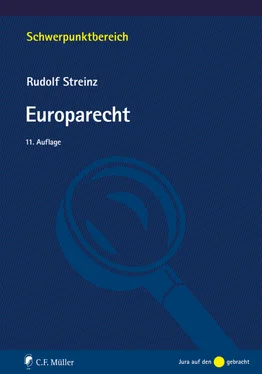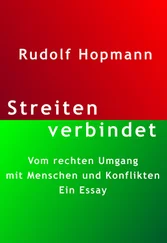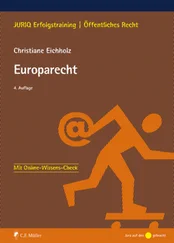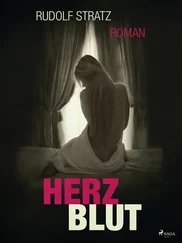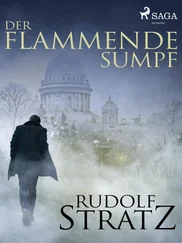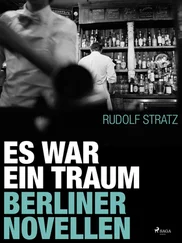211
Letztlich trifft dieser Ansatz auch auf die von H.P. Ipsen entwickelte sog. Gesamtakttheorie(s. Rn 129) zu. Diese verweist zwar auf Art. 24 Abs. 1 GG (jetzt Art. 23 Abs. 1 GG) als unentbehrlichen „Integrationshebel“, sieht dessen Funktion aber mit der Errichtung der Gemeinschaften als erschöpft an.
212
Basis dieser Theorien ist die behauptete Loslösungdes Unionsrechts von seiner völkerrechtlichen Grundlage, bei deren Vorliegen es in der Tat auf die verfassungsrechtlichen Ermächtigungen nicht mehr ankäme. Diese Loslösung ist bislang aber nicht erfolgt (vgl Rn 130).
213
Die Eigenständigkeitdes Unionsrechts ist kein tragendes Argument, da die Eigenständigkeit einer Rechtsordnung noch nichts über ihr Verhältnis zu anderen Rechtsordnungen besagt.
214
Auch die Theorien, die einen Vorrang des Unionsrechts kraft verfassungsrechtlicher Ermächtigungannehmen, bejahen die genannten (s. Rn 210) Kollisionsregeln im Unionsrecht. Diese bedürften jedoch einer Ergänzung im Verfassungsrecht der Mitgliedstaaten, das zur Einräumung eines solchen Vorrangs in einem völkerrechtlichen Vertrag wie den EU-Gründungsverträgen ermächtigen müsse[142]. Dies steht, wie die Anwendung völkerrechtlicher Kategorien überhaupt, der erforderlichen Funktionsfähigkeit der Union nicht entgegen, wenn die Besonderheiten eines Integrationsvertrages berücksichtigt werden, was auf dieser Basis auch geschehen kann (s. Rn 131). Zur Realisierung im GG s. Rn 228 ff.
215
Der Unterschied beider Theorien liegt darin, dass ein Vorrang kraft verfassungsrechtlicher Ermächtigung nur so weit reicht wie diese Ermächtigung, deren Schranken bestimmt und beachtet werden müssen. Besteht in einem Mitgliedstaat eine Verfassungsgerichtsbarkeit, kann diese die Einhaltung dieser Schranken kontrollieren. Bei einem Vorrang kraft Eigenständigkeit wäre dies nicht mehr möglich.
Beispiel:
Deutsche Landesverfassungsgerichte (zB der Bayerische Verfassungsgerichtshof) üben keine Kontrolle über Bundesrecht am Maßstab des Landesverfassungsrechts (zB Bayerische Verfassung) aus[143].
216
Probleme könnten sich ergeben, wenn die Schranken der Integrationsermächtigung in den Mitgliedstaaten verschieden sind. Damit die Union funktioniert, muss sich das nationale Verfassungsrecht entsprechend öffnen, was in allen Mitgliedstaaten erfolgt ist[144].
217
Die verfassungsrechtlichen Schranken und die Kontrolle ihrer Einhaltung (s. dazu Rn 236, 241) können eine präventive Warnfunktion gegenüber Unionsorganen in der Wahrnehmung ihrer Kompetenzen erfüllen.
bb) Die Rechtsprechung des EuGH
218
Der EuGH vertritt einen Vorrang des Unionsrechts kraft Eigenständigkeit. Grundlegend dafür ist das Urteil im Fall Costa/ENEL (s. Rn 198, 224). Darin begründet der EuGH zunächst die „Eigenständigkeit“ der Gemeinschaften (jetzt Union):
„Zum Unterschied von gewöhnlichen internationalen Verträgen hat der EWG-Vertrag eine eigene Rechtsordnung geschaffen, die bei seinem Inkrafttreten in die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten aufgenommen worden und von ihren Gerichten anzuwenden ist. Denn durch die Gründung einer Gemeinschaft für unbegrenzte Zeit, die mit eigenen Organen, mit der Rechts- und Geschäftsfähigkeit, mit internationaler Handlungsfähigkeit und insbesondere mit echten, aus der Beschränkung der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten oder der Übertragung von Hoheitsrechten der Mitgliedstaaten auf die Gemeinschaft herrührenden Hoheitsrechten ausgestattet ist, haben die Mitgliedstaaten, wenn auch auf einem begrenzten Gebiet, ihre Souveränitätsrechte beschränkt und so einen Rechtskörper geschaffen, der für ihre Angehörigen und sie selbst verbindlich ist“ [145].
219
Er verfolgt damit das Ziel, Vorrang und einheitliche Geltung des Unionsrechts zu sichern:
„Diese Aufnahme der Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts in das Recht der einzelnen Mitgliedstaaten und, allgemeiner, Wortlaut und Geist des Vertrages haben zur Folge, dass es den Staaten unmöglich ist, gegen eine von ihnen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit angenommene Rechtsordnung nachträglich einseitige Maßnahmen ins Feld zu führen. Solche Maßnahmen stehen der Anwendbarkeit der Gemeinschaftsrechtsordnung daher nicht entgegen. Denn es würde eine Gefahr für die Verwirklichung der in Art. 5 Abs. 2 (jetzt Art. 4 Abs. 3 EUV) aufgeführten Ziele des Vertrages bedeuten und dem Verbot des Art. 7 (jetzt Art. 18 AEUV) widersprechende Diskriminierungen zur Folge haben, wenn das Gemeinschaftsrecht je nach der nachträglichen innerstaatlichen Gesetzgebung von einem Staat zum anderen verschiedene Geltung haben könnte“ [146].
220
Der Vorrang des Unionsrechts werde auch durch Art. 288 AEUV bestätigt. Zusammenfassend stellt der EuGH fest:
„Aus alledem folgt, dass dem vom Vertrag geschaffenen, somit aus einer autonomen Rechtsquelle fließenden Recht wegen dieser seiner Eigenständigkeit keine wie immer gearteten innerstaatlichen Rechtsvorschriften vorgehen können, wenn ihm nicht sein Charakter als Gemeinschaftsrecht aberkannt und wenn nicht die Rechtsgrundlage der Gemeinschaft selbst in Frage gestellt werden soll“ [147].
221
Diese These vom Vorrang des Unionsrechts hat der EuGH in ständiger Rechtsprechung wiederholt, im Simmenthal II-Urteil auch gegenüber nationalem Verfassungsrecht[148]. Dort schien er auch zu einem Geltungsvorrang zu tendieren. Demgegenüber hat er sich in der Entscheidung IN.CO.GE. deutlich im Sinne eines Anwendungsvorrangs geäußert[149]. Auf diese Rechtsprechung des EuGH verweist die Erklärung Nr 17 der Schlussakte zum Vertrag von Lissabon (s. Rn 201, Fn. 132).
222
Die in dieser Erklärung erwähnten „Bedingungen“ deuten auf Schranken des Vorrangs auch aus unionaler Sicht hin. Ansätze dafür gäbe die Achtung der jeweiligen nationalen Identität der Mitgliedstaaten (Art. 4 Abs. 2 S. 1 EUV)[150]. Als der italienische Verfassungsgerichtshof Zweifel hatte, ob die von italienischen Gerichten realisierte Befolgung des Urteils des EuGH im Fall Taricco[151] mit den obersten Grundsätzen der italienischen Verfassungsordnung und der Beachtung der unveräußerlichen Rechte der Person vereinbar ist und damit den sog. „Controlimiti“-Vorbehalt[152] aktivierte, legte er dem EuGH die Fragen nach der Auslegung des Art. 325 Abs. 1 und 2 AEUV vor. Er wollte auch wissen, ob eine bestimmte Auslegung des Taricco-Urteils zu dessen Befolgung, indem entgegenstehende nationale Vorschriften unangewendet bleiben, auch dann verpflichte, wenn diese Nichtanwendung mit den obersten Grundsätzen des Verfassungsrechts des Mitgliedstaats oder mit den in der Verfassung des Mitgliedstaats anerkannten unveräußerlichen Grundrechten unvereinbar ist[153]. Der EuGH bejahte zwar die Pflicht, dem Unionsrecht widersprechende Bestimmungen unangewendet zu lassen; dies gelte allerdings nicht, wenn die Nichtanwendung wegen mangelnder Bestimmtheit der anwendbaren Rechtsnorm oder wegen der rückwirkenden Anwendung von Rechtsvorschriften, die strengere Strafbarkeitsbestimmungen aufstellen als die zum Zeitpunkt der Straftat geltenden Rechtsvorschriften, zu einem Verstoß gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit im Zusammenhang mit Straftaten und Strafen führen würde[154]. Diese Einschränkung entspricht zwar gemeinsamen verfassungsrechtlichen Traditionen der Mitgliedstaaten und ist auch in der EMRK verankert und stellt somit einen allgemeinen Rechtsgrundsatz des Unionsrechts (Art. 6 Abs. 3 EUV) dar, der auch in Art. 49 GRCh aufgegriffen wurde[155]. Bemerkenswert ist aber, dass der EuGH offenbar die italienische Regelung, die im Urteil Taricco wegen der unterschiedlichen Sanktionierung von Betrug zu Lasten des Mitgliedstaates und zu Lasten der Union beanstandet wurde, zur Vermeidung des durch den Controlimiti-Einwands drohenden Konflikts akzeptiert, obwohl das Bestehen des hier entscheidungserheblichen Grundrechts auf Kenntnis des Verjährungszeitpunkts mehr als zweifelhaft ist[156]. Es bleibt abzuwarten, ob der EuGH die absolute Nichtanwendung der Taricco-Regel dulden wird[157], was gegebenenfalls auch ein Anreiz für andere Verfassungsgerichte sein könnte, Verfassungsvorbehalte nicht nur zu postulieren sondern auch zu aktivieren.
Читать дальше