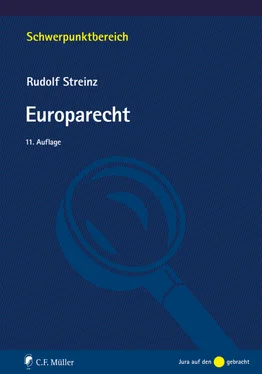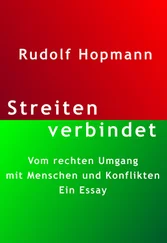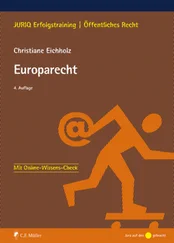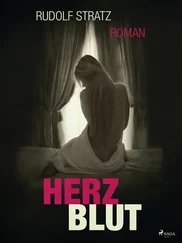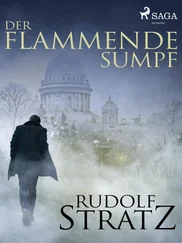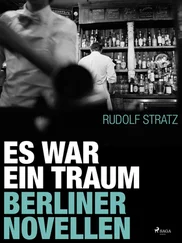182
Diese Unterschiede und das Beharrungsvermögen der ihnen zugrunde liegenden Konzeptionen sowie das Achtungsgebot in Art. 4 Abs. 2 EUV (s. Rn 169) gilt es zu beachten, wenn ein „Europa der Regionen“ unter Absinken der Rolle der zentralen Nationalstaaten postuliert oder prognostiziert wird.
b) Vertretung bei der Europäischen Union
183
Angesichts dieser Unterschiede ist es nicht verwunderlich, dass die Gründungsverträge Länder und Regionen nicht zur Kenntnis nahmen (allein Art. 68 Abs. 3 EWGV erwähnte in hier nicht interessierendem Zusammenhang „Gebietskörperschaften“), „landesblind“[121] waren. Im Grunde trifft dies auch für die Änderungen zu, die der Unionsvertrag und seine Fortentwicklungen brachten. Der Vertrag von Lissabon nimmt auf die unterschiedliche Struktur der Mitgliedstaaten „einschließlich der regionalen und lokalen Selbstverwaltung“ als Teil ihrer nationalen Identität, die die Union gemäß Art. 4 Abs. 2 S. 1 EUV „achtet“, zumindest Bezug. Auch bei der Anwendung des Subsidiaritätsprinzips soll eine mögliche Aufgabenwahrnehmung durch die regionale oder lokale Ebene innerhalb der Mitgliedstaaten in Betracht gezogen werden (Art. 5 Abs. 3 UAbs. 1 EUV).
184
Bis zum Vertrag von Maastricht bestand eine institutionelle Vertretung auf Gemeinschaftsebene lediglich in zwei eher marginalen Einrichtungen[122]. Durch Art. 305–307 AEUV wurde der Ausschuss der Regioneneingeführt. Mangels einer einheitlichen föderalen Struktur in der Union bleibt es weitgehend (vgl aber Rn 437) den Mitgliedstaaten überlassen, wen sie in das Gremium entsenden (vgl Art. 305 Abs. 3 AEUV). Nach relativ heftigem Streit haben in Deutschland die Länder den Kommunen drei der 24 Sitze in diesem Gremium überlassen, dem nur beratende Funktion zukommt (Art. 307 AEUV). Immerhin ist in bestimmten Fällen eine obligatorische Anhörung vorgeschrieben (vgl Art. 307 Abs. 1, 3 AEUV) (s. dazu Rn 439).
185
Die deutschen Länder haben eigene „Büros“in Brüssel errichtet, um mit der Union in ständigen und unmittelbaren Kontakt zu kommen und zu bleiben. Die Zulässigkeit solcher Vertretungen wird heute nicht mehr bestritten, wenngleich die erwogene verfassungs rechtliche Klarstellung in Art. 23 GG unterblieben ist. § 8 des auf Grund von Art. 23 Abs. 7 GG erlassenen Gesetzes über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Angelegenheiten der Europäischen Union[123] sieht die Einrichtung von Länderbüros vor und regelt deren Rechtsstellung im Verhältnis zum Bund.
186
Diese beschränkten Möglichkeiten erklären, warum die deutschen Länder (mit Erfolg, vgl Rn 388) versucht haben, in der deutschen Delegation im Rat vertreten zu sein und in die innerstaatliche Vorbereitung der Ratsentscheidung rechtzeitig und wirksam einbezogen zu werden.
c) Beeinträchtigung durch die Europäische Union
187
Da sich die Verpflichtungen aus dem Unionsrecht an den Gesamtstaat ohne Rücksicht auf dessen innerstaatliche Verfassungsstruktur richten, werden autonome Gemeinschaften dadurch insoweit tangiert, als ihre innerstaatlich begründeten Kompetenzen betroffen werden.
188
Unionsrechtliche Kompetenznormenschließen in ihrer Reichweite und Intensität auch die Gesetzgebungszuständigkeit von Gebietskörperschaften aus. Bei den deutschen Bundesländern ist dadurch zB die Agrarstrukturpolitik betroffen.
189
Unionsrechtliche Sachnormenbeschränken die Möglichkeit der Gebietskörperschaften zu eigenverantwortlicher Politikgestaltung. So setzen zB Art. 107 ff AEUV der Wirtschaftsförderung Schranken (vgl Fall 3, Rn 194). Auch die Bereiche Bildung und Kultur sind davon betroffen (vgl Rn 391). Die unionsrechtliche Kontrolle kann sich ebenfalls auf die Aufgabenerfüllung der Kommunen auswirken (zB Umweltrecht, Vergabe öffentlicher Aufträge[124]).
190
Beispiel (nach EuGH, Rs 103/88, Fratelli Costanzo/Stadt Mailand, Slg 1989, 1839):
Die RL 71/305 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge[125] bestimmt, wann Angebote bei öffentlichen Ausschreibungen auszuschließen sind. 1987 erließ Italien ein Gesetz, das für die Vergabe von Aufträgen zum Bau von Fußballstadien für die Weltmeisterschaft 1990 Bestimmungen enthielt, die von der Richtlinie abwichen. Als eine Firma von der Stadt Mailand auf Grund dieser Bestimmungen vom Vergabeverfahren ausgeschlossen wurde, erhob sie dagegen Klage.
Das zuständige italienische Gericht legte im Vorabentscheidungsverfahren gemäß Art. 267 Abs. 2 AEUV (vgl Rn 700 ff) dem EuGH eine Reihe von Fragen zur Auslegung dieser Richtlinie vor. Der EuGH entschied ua, dass die fraglichen Bestimmungen der Richtlinie unmittelbare Wirkung entfalteten (vgl dazu Rn 493 ff). Wenn sich die Einzelnen unter den dafür geltenden Voraussetzungen auf die Bestimmungen einer Richtlinie berufen könnten, so deshalb, weil die Verpflichtungen, die sich aus diesen Bestimmungen ergeben, für alle Behörden der Mitgliedstaaten gelten. Es wäre widersprüchlich, diese Berufung zuzulassen, die Verpflichtung der Verwaltung aber zu verneinen, die Bestimmungen der Richtlinie dadurch einzuhalten, dass sie die Vorschriften des nationalen Rechts, die damit nicht im Einklang stehen, unangewendet lässt. Folglich seien alle Träger der Verwaltung einschließlich der Gemeinden und der sonstigen Gebietskörperschaften verpflichtet, die Bestimmungen von Richtlinien, die unmittelbare Wirkung entfalten, anzuwenden. Zum Problem der Pflicht nationaler Behörden, unionsrechtswidriges nationales Recht nicht anzuwenden, s. Rn 267.
191
Soweit Gebietskörperschaften an der Gesetzgebung des Zentralstaats mitwirken (zB die deutschen Bundesländer über den Bundesrat an der Gesetzgebung des Bundes, Art. 50 GG), werden diese Kompetenzen auch durch dessen Kompetenzverlust berührt.
192
Soweit Gebietskörperschaften für den Vollzug des Unionsrechts zuständig sind (zB die deutschen Bundesländer einschließlich der Kommunen), haftet dafür der Zentralstaat, weshalb sie dazu verfassungsrechtlich verpflichtet werden (in Deutschland durch den Grundsatz der Bundestreue iVm Art. 23 Abs. 1 GG, vgl dazu Rn 599; für die neuen Bundesländer vgl Art. 10 Abs. 3 Einigungsvertrag[126]). Dadurch wird Verwaltungs- und Finanzkapazität gebunden.
d) Möglichkeiten der autonomen Gebietskörperschaften zur Wahrung ihrer Rechte
193
Da die Vertretung autonomer Gebietskörperschaften auf Unionsebene nur in sehr bescheidenem Umfang vorgesehen ist, bemühen sie sich um Kompensationen auf nationaler Ebene. Diese einzuräumen ist Sache des Verfassungsrechts, das dabei allein unionsrechtliche Schranken beachten muss (Mitwirkung in der nationalen Ratsdelegation, nationale Rückbindung der Vertreter im Rat; s. zur Rechtslage in Deutschland Rn 388 ff). Unmittelbar gegen Unionsakte könnten sich Gebietskörperschaften nur durch Klagen vor dem EuGH wenden. Ein solches allgemeines Klagerecht ist in den Gründungsverträgen und trotz entsprechender Forderungen auch im Unionsvertrag nicht ausdrücklich verankert (zur Subsidiaritätsklage s. Rn 196). Gleichwohl hat der EuGH die Klage von Regionen zugelassen:
194
Fall 3 (nach EuGH, verb Rs 62 und 72/87, Exécutif régional wallon und SA Glaverbel/Kommission, Slg 1988, 1573):
Im Mitgliedstaat B, einem Bundesstaat, sieht ein Gesetz vor, dass durch die Gliedstaaten Beihilfen an Unternehmen gewährt werden können. Als die EU-Kommission davon erfährt, dass dem Unternehmen U durch den Gliedstaat W eine solche Beihilfe gewährt werden soll, richtet sie an den Mitgliedstaat B einen Beschluss, mit dem sie diesem die Gewährung der Beihilfe untersagt. Kann dagegen der Gliedstaat W Klage zum EuGH erheben?
Читать дальше