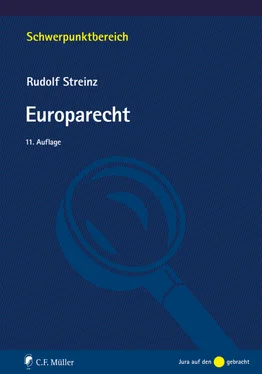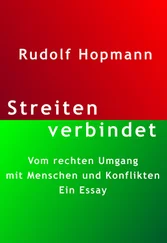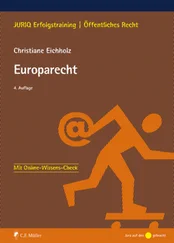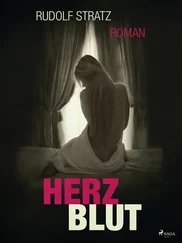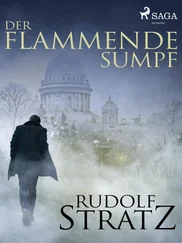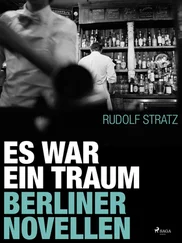129
Großen Einfluss übte hier die sog. „Gesamtakttheorie“ Ipsens aus, wonach nicht auf die Gründungsverträge und die Zustimmungsgesetze zu diesen abzustellen sei, sondern „auf den deutschen Anteil am Gesamtakt der Gemeinschaftserrichtung, der sich auf Art. 24 Abs. 1 GG stützt, seinerseits an das Grundgesetz im Übrigen nicht gebunden war und deshalb auch mit diesem nicht unvereinbar sein konnte“[61]. Damit wird aber auf eine verfassungsrechtliche Ermächtigung abgestellt, nämlich Art. 24 Abs. 1 GG (jetzt Art. 23 Abs. 1 GG), der als „Integrationshebel“ die Anerkennung des Unionsrechts durch die nationale Rechtsordnung bewirke. Das würde voraussetzen, dass sich das Unionsrecht von seiner völkerrechtlichen Grundlage gelöst habe. Dies halten die Vertreter der „Gesamtakttheorie“ deshalb für erforderlich, weil die völkerrechtliche Betrachtungsweise der Besonderheit der unionsrechtlichen Rechtsordnung nicht gerecht werden könne und die Anwendung völkerrechtlicher Grundsätze die Funktionsfähigkeit der Union gefährden würde.
130
Beide Prämissen sind aber unzutreffend. Einer Loslösungdes Unionsrechts von seiner völkerrechtlichen Grundlage steht zwar die Begründung der Gemeinschaften bzw der Union durch völkerrechtliche Verträge nicht entgegen (Beispiel: Gründung eines Bundes- oder auch Einheitsstaates durch völkerrechtlichen Vertrag zwischen den fusionierenden Staaten, die als Völkerrechtssubjekte in diesem aufgehen oder allenfalls als partielle Völkerrechtssubjekte bestehen bleiben). Eine solche normative Verankerung fehlt aber in den Gründungsverträgen. Auch der Vertrag von Lissabon (vgl Art. 48 EUV) sieht gerade keine solche Loslösung vor. Zwar kann eine Loslösung auch ohne normative Ermächtigung erfolgen. Dies setzt jedoch das Eintreten tatsächlicher Vorgänge voraus, die bei der Europäischen Union jedenfalls derzeit (auch nach dem Vertrag von Lissabon) nicht gegeben und auch auf absehbare Zeit nicht zu erwarten sind. Entscheidende Argumente sind hier die Entwicklung der EG/EU hinsichtlich ihrer Supranationalität (teilweise Rückentwicklung zu intergouvernementalen Strukturen, Bestätigung durch die Institutionalisierung des Europäischen Rates in der EEA, im Unionsvertrag und in Art. 15 EUV; Konsensprinzip gemäß Art. 15 Abs. 4 EUV), der verfassungsrechtliche Kontrollvorbehalt in den Mitgliedstaaten (vgl Rn 228 ff) sowie das Erfordernis völkerrechtlicher Verträge zur Ausweitung der Unionskompetenzen. Dieses Prinzip der begrenzten, da durch Zuweisung der Mitgliedstaaten begründeten Ermächtigung wird im Unionsvertrag ausdrücklich bekräftigt (Art. 4 Abs. 1, Art. 5, Art. 48 Abs. 2 S. 2 EUV).
131
Die völkerrechtliche Betrachtungsweise gefährdet auch nicht die Funktionsfähigkeitder Union. Die Hauptsorge der Gesamtakttheorie, die mit der Qualifizierung des Unionsrechts als Völkerrecht angeblich zwangsläufig verbundene Transformation in Verbindung mit der Lex posterior-Regel mache den Vorrang des Unionsrechts und damit seine Effektivität zunichte, war zwar angesichts der in Deutschland verbreiteten und lange herrschenden Transformationstheorie[62] verständlich, ist im Ergebnis aber nicht begründet. Denn das staatliche Recht kann sowohl darüber bestimmen, wie es sich dem Völkerrecht öffnet, als auch, welchen Rang es diesem zuweist. Damit ist das deutsche Recht aber nicht gezwungen, dem Unionsrecht als Völkerrecht über eine Transformation Geltung zu verschaffen; es kann auch der Vollzugslehre[63] folgen und es als Unionsrecht in den innerstaatlichen Rechtsraum einführen. Dabei kann es ihm den verfassungsrechtlich höchstmöglichen Rang verschaffen, was in der Bundesrepublik Deutschland auch geschehen ist (s. Rn 228 ff). Die Europäischen Gemeinschaften bis hin zur jetzigen Union sind somit als eine Entwicklungsstufe des Rechts der internationalen Organisationenim Sinne des Völkerrechts anzusehen (vgl dazu grundlegend Meng ), allerdings als eine qualitativ neue. Denn die Besonderheiten wie die Ausstattung mit eigener Rechtsetzungsbefugnis, die Durchgriffswirkung des sekundären und teilweise auch des primären Unionsrechts, die Einsetzung unabhängiger Organe und die Möglichkeit von Mehrheitsentscheidungen, Merkmale, die die „Supranationalität“ der Union (s. Rn 133 ff) begründen oder kennzeichnen, fanden sich zwar bereits bei anderen zwischen Staaten begründeten internationalen Organisationen, nicht aber in dieser Kumulation, dieser relativen Breite, der in ihnen angelegten Integrationsdynamik und der dadurch anwachsenden oder zumindest ermöglichten Integrationsdichte. Die Einordnung des Unionsrechts als Völkerrecht wird durch die auch in anderen Bereichen erwiesene Dynamik dieser Rechtsordnung ermöglicht und entspricht auch dem Rechtsverständnis der Mitgliedstaaten, das in den Verfassungsbestimmungen einiger von ihnen über die Rechtsgrundlagen für den Abschluss des primären Unionsrechts deutlich zum Ausdruck kommt (vgl Rn 92).
132
Naheliegend ist die Frage, ob diese Einordnung auch von praktischer Bedeutungist. Dies ist insofern zu verneinen, als aus einer Klassifikation allein rechtliche Folgerungen nicht abgeleitet werden können. Jedenfalls dürfen über die konkreten vertraglichen Regelungen hinaus die Grundlage und der Inhalt der Gliedstellung der Mitgliedstaaten nicht unbesehen mit der Stellung von Einzelstaaten im Bundesstaat gleichgesetzt werden[64]. Eine richtige Klassifikation wirkt aber gerade solchen Fehlschlüssen entgegen und bildet eine Argumentationshilfe hinsichtlich Fragen, die substanziell anhand anderer Kriterien und anderer Grundlagen zu entscheiden sind. Insoweit ist die Betonung der völkerrechtlichen Grundlage beachtlich für das Grundverhältnis der Union zu den Mitgliedstaaten („Herren der Verträge“, s. Rn 151) und das Gebot, die Regelungen in den EU-Verträgen völkerrechtlich zu interpretieren. Das Völkerrecht hält durchaus geeignete Instrumentarien für eine adäquate Lösung der besonderen Probleme einer Integrationsgemeinschaft bereit. So kann sich ein Mitgliedstaat zur Rechtfertigung einer Vertragsverletzung vor dem EuGH nicht auf den völkerrechtlichen Grundsatz berufen, wonach die Vertragsverletzung einer Partei die andere zur Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen berechtigt[65]. Dies entspricht aber durchaus den Regeln des allgemeinen Völkerrechts, wonach die Bestimmungen über die Beendigung oder Aussetzung der Wirksamkeit eines Vertrages infolge Vertragsbruchs (vgl Art. 60 Abs. 1–3 WVRK, insbes. Abs. 2 hinsichtlich multilateraler Verträge) keine Vorschriften des Vertrages berühren, die im Falle eines Vertragsbruchs Anwendung finden (vgl Art. 60 Abs. 4 WVRK). Solche abweichenden Bestimmungen enthält aber gerade der AEUV, indem er bei Vertragsverletzungen einem Mitgliedstaat die Möglichkeit zur Klage gemäß Art. 259 AEUV eröffnet und mit dieser abgeschlossenen Regelung andere Sanktionsmöglichkeiten ausschließt. Dies bekräftigt Art. 344 AEUV, der die Mitgliedstaaten verpflichtet, „Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung der Verträge nicht anders als hierin vorgesehen zu regeln“[66].
Literatur:
Bernhardt, R ., Das Recht der Europäischen Gemeinschaften zwischen Völkerrecht und nationalem Recht, in: FS Bindschedler, 1981, S. 229 ff; Meng, W ., Das Recht der internationalen Organisationen – eine Entwicklungsstufe des Völkerrechts. Zugleich eine Untersuchung zur Rechtsnatur des Rechtes der Europäischen Gemeinschaften, 1979; Streinz, R ., Bundesverfassungsgerichtlicher Grundrechtsschutz und Europäisches Gemeinschaftsrecht, 1989, S. 94 ff.
§ 3 Grundlagen der Europäischen Union› V. Die Rechtsnatur der Europäischen Union › 2. Die Besonderheit des hohen Integrationsgrades der Europäischen Union – ihre Supranationalität
Читать дальше