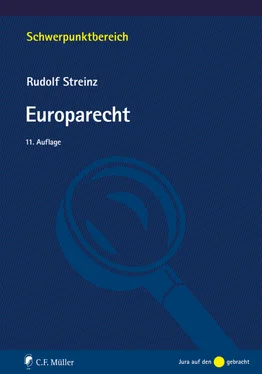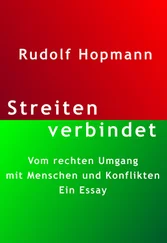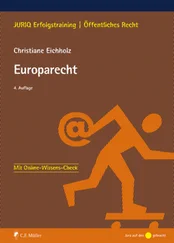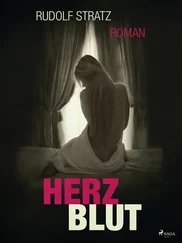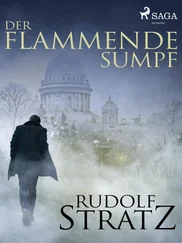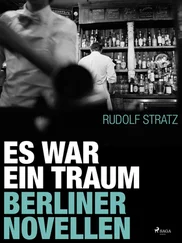123
Fall 1 (nach EuGH, verb Rs 89, 104, 114, 116, 117, 125–129/85, Ahlström ua/Kommission („Zellstoff“), Slg 1988, 5193 = HVL , S. 478 ff = Pechstein Nr 242):
Hersteller von Zellstoff mit Sitz im Vereinigten Königreich und einigen Drittstaaten hatten ein internationales Kartell gebildet und Absprachen zur einheitlichen Preisgestaltung getroffen, die auch für Verkäufe in der Union gelten sollten. Dadurch wurden über 60 Prozent des Zellstoffabsatzes innerhalb der Union beeinträchtigt. Die Kommission sah darin einen Verstoß gegen Art. 101 AEUV und verhängte Geldbußen gegen alle Teilnehmer des Kartells. Die Firmen erhoben Nichtigkeitsklage gemäß Art. 263 Abs. 4 AEUV ua mit der Begründung, die Union könne ihre Jurisdiktion nach allgemeinem Völkerrecht nicht auf Staatsangehörige dritter Staaten und solche Verhaltensweisen ausdehnen, die außerhalb der Union stattgefunden haben.
Zu Recht?
Lösung Fall 1:
I. Zulässigkeit der Klage
Die Nichtigkeitsklage gemäß Art. 263 Abs. 4 AEUV ist zulässig. Auch eine ausländische juristische Person ist klageberechtigt, wenn sie Adressatin eines Beschlusses der Kommission ist (s. Rn 651, 667 f).
II. Begründetheit der Klage
1. Unionsrechtliche Beurteilung der Zugrundelegung des Auswirkungsprinzips
Art. 101 AEUV verbietet Maßnahmen, die eine Einschränkung des Wettbewerbs innerhalb des Binnenmarktes bewirken. Wenn man die Anwendbarkeit der wettbewerbsrechtlichen Verbote von dem Ort der Bildung des Kartells abhängig machen würde, so liefe dies offensichtlich darauf hinaus, dass den Unternehmern ein einfaches Mittel an die Hand gegeben würde, sich diesen Verboten zu entziehen. Entscheidend ist somit der Ort, an dem das Kartell durchgeführt wird. Der EuGH hat jedenfalls bei Tätigwerden innerhalb der Union das Auswirkungsprinzip zugrunde gelegt[55].
2. Völkerrechtliche Zulässigkeit
Der EuGH legitimiert die Bußgeldentscheidungen der Kommission gegenüber den ausländischen Unternehmen mit dem völkerrechtlich anerkannten Territorialitätsprinzip. Diese Begründung, die nur auf den Erfolgsort und nicht auf die die Wettbewerbsstörung hervorrufende Handlung abstellt, genügt aber nicht, da sie das Problem der Setzung von Hoheitsakten gegenüber im Ausland ansässigen Ausländern übergeht. Das an die vorgeworfene Handlung anknüpfende Auswirkungsprinzip, das über das reine Territorialitätsprinzip hinausgeht, lässt sich aber völkerrechtlich durchaus rechtfertigen. Wie das internationale Strafrecht (vgl §§ 4 ff StGB sowie § 1 VStGB[56]) zeigt, ist die Anknüpfung nationaler Jurisdiktionsgewalt an internationale Sachverhalte völkerrechtlich nicht unzulässig. Vielmehr lässt das Völkerrecht den Staaten insoweit einen gewissen Spielraum.
Die dem internationalen Strafrecht zugrunde liegenden Prinzipien tragen allerdings nicht das Auswirkungsprinzip. Damit ist dieses allerdings noch nicht völkerrechtlich unzulässig. Die Grenze des völkerrechtlich Zulässigen ist erst bei dem Verbot erreicht, Hoheitsakte auf fremdem Territorium zu setzen. Da das unionsrechtliche Prinzip der Inlandsauswirkung einen juristisch präzise fassbaren Inlandsbezug hat, auf Einzelentscheidungen begrenzt bleibt und lediglich der Beseitigung der Inlandsauswirkung dient, bemüht es sich um den gebotenen Interessenausgleich der betroffenen Staaten und ist völkerrechtlich akzeptabel. Das Problem möglicher Doppelsanktionen bleibt der nationalen Rechtsordnung des Heimatstaates des betreffenden Ausländers zur Regelung überlassen. Die Vollstreckung einer Entscheidung der Kommission ist nur mithilfe des Heimatstaates möglich, es sei denn, sie kann sich an im Unionsgebiet belegene Gegenstände halten.
Literatur:
Knebel, H.-W ., Die Extraterritorialität des Europäischen Kartellrechts, EuZW 1991, 265; K.M. Meessen (Hrsg.), Extraterritorial Jurisdiction in Theory and Practice, 1996; Meng, W ., Extraterritoriale Anwendung des EU-Rechts, in: von der Groeben/Thiesing/Ehlermann (Hrsg.), Kommentar zum EU-/EG-Vertrag, 5. Aufl., 1997, Bd. 5, S. 1207 ff.
§ 3 Grundlagen der Europäischen Union› IV. Zeitlicher Geltungsbereich
IV. Zeitlicher Geltungsbereich
124
Der EGKSV (Art. 97) war für die Dauer von 50 Jahren abgeschlossen worden. Nach dem 23.7.2002 wurde die EGKS abgewickelt und ihr Vermögen auf die EG übertragen[57]. Die Verträge (Art. 53 EUV; Art. 356 AEUV) und der EAGV (Art. 208) sind hingegen ausdrücklich auf unbestimmte Zeit abgeschlossen worden. Ein Austritt aus der Union ist gemäß Art. 50 EUV möglich (s. Rn 107 f). Gemäß Art. 1 Abs. 3 EUV tritt die (Europäische) Union an die Stelle der EG, deren Rechtsnachfolgerin sie ist, mit dem EUV und dem AEUV (s. Rn 89) als Grundlagen (vgl auch Art. 1 Abs. 2 AEUV).
§ 3 Grundlagen der Europäischen Union› V. Die Rechtsnatur der Europäischen Union
V. Die Rechtsnatur der Europäischen Union
§ 3 Grundlagen der Europäischen Union› V. Die Rechtsnatur der Europäischen Union › 1. Europarecht und Völkerrecht
1. Europarecht und Völkerrecht
125
Die bereits zu den Europäischen Gemeinschaften diskutierte Frage nach der Rechtsnatur der Europäischen Union und damit auch der Rechtsnatur des Unionsrechts ist streitig. Im Wesentlichen lassen sich zwei Hauptrichtungen unterscheiden. Streitpunkt und Kriterium ist die Frage, ob das Gemeinschaftsrecht (jetzt Unionsrecht) dem Völkerrecht zuzuordnen ist oder nicht.
126
Nach der insbesondere von Europarechtlern, die auch Völkerrechtler sind, vertretenen Auffassung (in der Terminologie von Schweitzer/Hummer/Obwexer , Rn 234: „Traditionalisten“) ist das Gemeinschaftsrecht (jetzt Unionsrecht) Völkerrecht. Denn das primäre Gemeinschaftsrecht sei durch völkerrechtliche Verträge entstanden und entstehe (vgl Art. 48 EUV) weiterhin durch völkerrechtliche Verträge zwischen den Mitgliedstaaten als Völkerrechtssubjekten. Auch das sekundäre Unionsrecht sei Völkerrecht, und zwar als aus den Ermächtigungen des primären Unionsrechts abgeleitetes Recht.
127
Nach der Auffassung der sog. „Autonomisten“ (Terminologie von Schweitzer/Hummer/Obwexer , Rn 235) stellt das Unionsrecht kein Völkerrecht dar, sondern eine „eigenständige“ Rechtsordnung sui generis. Denn aus der vertraglichen Entstehungsgrundlage der Gemeinschaftsordnung sei nicht unbedingt auf den vertraglich-obligatorischen Inhalt der Ordnung selbst zu schließen. Entscheidend sei vielmehr die sich aus dem Gesamtzusammenhang der Verträge ergebende Struktur, die erhebliche Unterschiede zu anderen völkerrechtlichen Verträgen aufweise. Daraus folge, dass es sich bei primärem Unionsrecht nicht mehr um Völkerrecht handle, sondern um ein Recht mit Doppelnatur, das gleichzeitig vertragsrechtlichen und verfassungsrechtlichen Charakter habe, oder aber, dass es sich um ein Recht mit Verfassungscharakter handle, dem allerdings nicht Staatscharakter oder staatsartiger Charakter zukomme[58] (zum Unionsrecht als Verfassungsrecht s. Rn 145 ff). Einige Vertreter dieser Richtung (Grabitz , Ophüls) sahen die Europäischen Gemeinschaften allerdings als (unvollendeten) Bundesstaat oder bundesstaatsähnliches Gebilde an. Diese zum primären Unionsrecht vertretene Auffassung schlägt zwangsläufig auch auf das sekundäre Unionsrecht durch.
128
Für die Ansicht der „Autonomisten“ spricht, dass das Unionsrecht in der Tat Besonderheiten aufweist, die zwar im Grunde und in einzelnen Elementen durchaus Vorbilder in anderen internationalen Organisationen haben, in dieser Intensität und Kombination aber bisher allein in der Europäischen Union verwirklicht sind. Die Ansicht von der „Eigenständigkeit“ des Gemeinschafts- bzw Unionsrechts hat sich auch in der Rechtsprechung des EuGH[59] und in der Rechtsprechung des BVerfG durchgesetzt – in Letzterer allerdings nur terminologisch, letztlich aber nicht in der Sache, da das BVerfG die Normenkontrolle über die Zustimmungsgesetze zu den Gründungsverträgen und damit mittelbar über das Primärrecht nach wie vor in Anspruch nimmt und die völkerrechtlichen Grundlagen des Unionsrechts und die fortbestehende Bedeutung der Zustimmungsgesetze für seine Geltung und Anwendung im innerstaatlichen Bereich ausdrücklich hervorhebt[60].
Читать дальше