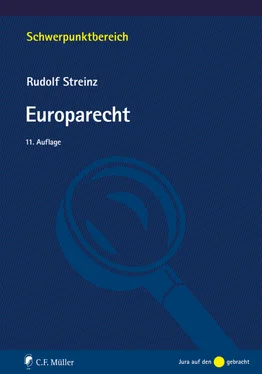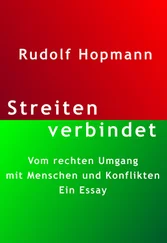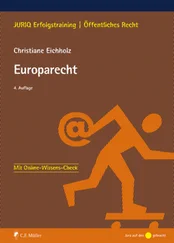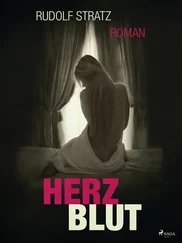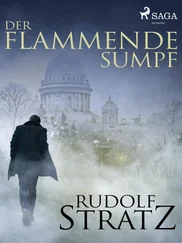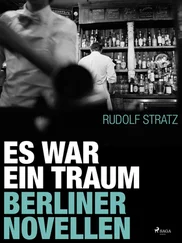§ 3 Grundlagen der Europäischen Union› II. Verfassungsrechtliche Grundlagen der Gründungsverträge › 2. Bundesrepublik Deutschland
2. Bundesrepublik Deutschland
94
Für die Gründung von Integrationsgemeinschaften sind völkerrechtliche Verträge erforderlich. Die Befugnis zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge weist Art. 59 Abs. 1 GG dem Bundespräsidenten zu[20]. Praktisch bedeutsamer ist die Regelung des Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG, wonach Verträge, welche die politischen Beziehungen des Bundes regeln oder sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung beziehen, der Zustimmung bzw Mitwirkung der für die Bundesgesetzgebung zuständigen Körperschaften in Form eines Bundesgesetzes bedürfen. Unter diese Voraussetzungen fallen auch die Gründungsverträge der Europäischen Gemeinschaften und der Europäischen Union, da sie als „hochpolitische“ Verträge die politischen Beziehungen des Bundes regeln und darüber hinaus zu ihrer Verwirklichung Gesetze im formellen Sinn (Parlamentsgesetze) erfordern. Das Vertragsgesetz gibt dem Bundespräsidenten die Erlaubnis zur Ratifikation des völkerrechtlichen Vertrages. Ob zu einem solchen Vertragsgesetz die Zustimmung des Bundesrates erforderlich ist oder seine bloße Mitwirkung genügt, bestimmt sich nach dem Inhalt des völkerrechtlichen Vertrages, zu dem es ergeht, anhand der Kriterien, die das Grundgesetz für die Zustimmungsbedürftigkeit vorsieht[21]. Hinsichtlich des Zustimmungs-(= Vertrags-)Gesetzes zur EEA wurde vom Bund die Zustimmungsbedürftigkeit konzediert, die von den Ländern zur Durchsetzung einer Verbesserung ihrer Position bei der Vorbereitung der Ratsentscheidung genutzt wurde (s. Rn 388). Der Unionsvertrag bedurfte schon wegen des 1992 eingefügten Art. 23 Abs. 1 S. 2 GG der Zustimmung des Bundesrats. Gleiches galt für seine Fortentwicklungen (Amsterdam und Nizza) und für den Vertrag von Lissabon.
95
Das Zustimmungsgesetz zum Vertrag von Maastricht bedurfte wegen der dadurch notwendigen Änderungen des GG (Art. 23 Abs. 1, Art. 28 Abs. 1 S. 4 sowie Art. 88 S. 2 GG) einer verfassungsändernden Mehrheit (Art. 79 Abs. 2 GG). Seither richtet sich das Mehrheitserfordernis gemäß Art. 23 Abs. 1 S. 3 GG nach Art. 79 Abs. 2 GG, soweit durch eine Änderung des Primärrechts oder vergleichbare Regelungen das Grundgesetz seinem Inhalt nach geändert oder ergänzt wird. Das ist zu bejahen, soweit durch eine Vertragsänderung Hoheitsrechte übertragen werden[22]. Dies traf auf die Zustimmungsgesetze zu den Verträgen von Amsterdam und Nizza[23] und auf das Zustimmungsgesetz zum Vertrag von Lissabon[24] zu.
96
Für die Gründung von Integrationsgemeinschaften, denen Hoheitsrechte übertragen werden, findet daneben Art. 24 Abs. 1 GG Anwendung. Dieser ermächtigt den Bund zur Übertragung von Hoheitsrechten durch Gesetz. Das Zustimmungsgesetz zu einem solchen Integrationsvertrag ist zugleich Gesetz im Sinn des Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG und Gesetz im Sinn des Art. 24 Abs. 1 GG (Doppelfunktion)[25]. Hinsichtlich der Verwirklichung der Europäischen Union wurde in Art. 23 Abs. 1 GGeine eigene Integrationskompetenzdes Bundes geschaffen, die insoweit lex specialis zu Art. 24 Abs. 1 GG und hinsichtlich der gesteigerten Anforderungen auch zu Art. 59 Abs. 2 GG ist. Diese kommt schon wegen Art. 48 EUV auch bei der Fortentwicklung der Europäischen Union zum Tragen[26]. Von Art. 23 GG erfasst werden auch völkerrechtliche Verträge, die „in einem Ergänzungs- oder besonderen Näheverhältnis“ zum Recht der EU stehen, wenn die darin geschaffenen Befugnisse der Übertragung von Hoheitsrechten gleichkommt[27]
97
Die Integrationsermächtigung des Art. 24 Abs. 1 GG ist nicht schrankenlos. Hinsichtlich der Verwirklichung der Europäischen Union sind die Schranken der Integrationsermächtigung in Art. 23 Abs. 1 GG ausdrücklich festgeschrieben. S. dazu Rn 232 ff.
§ 3 Grundlagen der Europäischen Union› III. Räumlicher Geltungsbereich
III. Räumlicher Geltungsbereich
§ 3 Grundlagen der Europäischen Union› III. Räumlicher Geltungsbereich › 1. Mitgliedstaaten
98
Gemäß Art. 52 Abs. 1 EUV gilt dieser Vertrag für die dort aufgeführten 27 Mitgliedstaaten sowie das 2013 beigetretene Kroatien. Damit erstreckt sich der räumliche Geltungsbereich des Unionsrechts grundsätzlich, dh abgesehen von den in Art. 52 Abs. 2 iVm Art. 355 AEUV aufgeführten Ausnahmen, auf das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten. Insoweit kann man auch von „Unionsgebiet“ sprechen.
§ 3 Grundlagen der Europäischen Union› III. Räumlicher Geltungsbereich › 2. Änderung des räumlichen Geltungsbereichs
2. Änderung des räumlichen Geltungsbereichs
99
Gemäß Art. 49 Abs. 1 S. 1 EUV kann jeder europäische Staat die Mitgliedschaft in der Europäischen Union beantragen. Er wird dadurch zugleich Mitglied der EAG. Durch den Amsterdamer Vertrag wurde klargestellt, dass der Beitrittskandidat die Grundsätze der Freiheit, der Demokratie, der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit achten muss, was jetzt durch den Verweis auf die in Art. 2 EUV genannten Werte, die er achten und sich für ihre Förderung einsetzen muss, zum Ausdruck kommt. Ob diese rechtlichen Kriterien erfüllt sind, ist im Wesentlichen sicher eine politische Bewertung[28]. Einen Anspruch auf Beitritt gewährt Art. 49 Abs. 1 S. 1 EUV jedenfalls nicht. Soll die Union als Rechtsgemeinschaft glaubwürdig sein, muss diese Bewertung aber ernst genommen werden und nach objektiven Kriterien in gleicher Weise gegenüber allen Beitrittskandidaten erfolgen. Diese müssen ggf ihre Rechtsordnung in Einklang mit dem geforderten europäischen Standard bringen. Zum Problem der Sicherung der Achtung der Werte der EU durch diese gegenüber den Mitgliedstaaten nach erfolgtem Beitritt s. Rn 111 ff.
100
Über den Antrag entscheidet der Rat einstimmig nach Anhörung der Kommission und nach Zustimmung der absoluten Mehrheit der Mitglieder des Europäischen Parlaments. Ferner bedarf es des Abschlusses eines Vertrages über die Aufnahmebedingungen und die durch eine Aufnahme erforderlich werdenden Anpassungen der Verträge, auf denen die Europäische Union beruht. Dieser muss von allen Mitgliedstaaten gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften ratifiziert werden. Man kann also einen unionsrechtlichen und einen völkerrechtlichen Teil des Beitrittsverfahrens unterscheiden.
101
Grundprinzip der Beitrittsbedingungen ist die Übernahme des sog. „acquis communautaire“, dh der Gesamtheit des Unionsbestandes (zB an politischen Zielsetzungen) und des Unionsrechts (Primärrecht, Sekundärrecht, ungeschriebenes Recht). Die bestehenden Bestimmungen werden zwar in der jeweiligen sog. Beitrittsakte[29] angepasst; soweit erforderlich werden auch Übergangszeiten eingeräumt. Eine grundsätzliche materielle Veränderung kommt aber ebenso wenig in Frage wie eine dauerhafte Nichtanwendung von Kernelementen des acquis communautaire auf ein Neumitglied („diskriminierende Mitgliedschaft“).
b) Änderung des Hoheitsgebiets eines Mitgliedstaates
102
Art. 52 Abs. 1 EUV führt die einzelnen Mitgliedstaaten mit ihren offiziellen Bezeichnungen auf und weist damit auf ihre Eigenschaft als Rechtssubjekte des Völkerrechts hin.
103
Dieses fordert für die Staatsqualität das Bestehen der Staatsgewalt in einem geographisch abgegrenzten Gebiet[30]. Für die Mitgliedstaaten als Subjekte des Völkerrechts sind EUV und AEUV unabhängig von etwaigen Veränderungen im Bestand ihrer Hoheitsgebiete verbindlich, da nach dem Grundsatz der „beweglichen Vertragsgrenzen“[31] ein Staat in seinem jeweiligen territorialen Bestand[32] Vertragspartner ist bzw bleibt. Die völkerrechtliche Identität eines Staates wird durch Änderungen seines Staatsgebietes grundsätzlich nicht berührt. Für das aus einem Staatsverband ausscheidende Gebiet gelten die Bestimmungen über die Staatensukzession und die Nachfolge in völkerrechtliche Verträge. Entsprechendes gilt für das zu einem Staatsverband kommende Gebiet. Von diesem Grundsatz der beweglichen Vertragsgrenzen geht Art. 52 Abs. 1 EUV aus.
Читать дальше